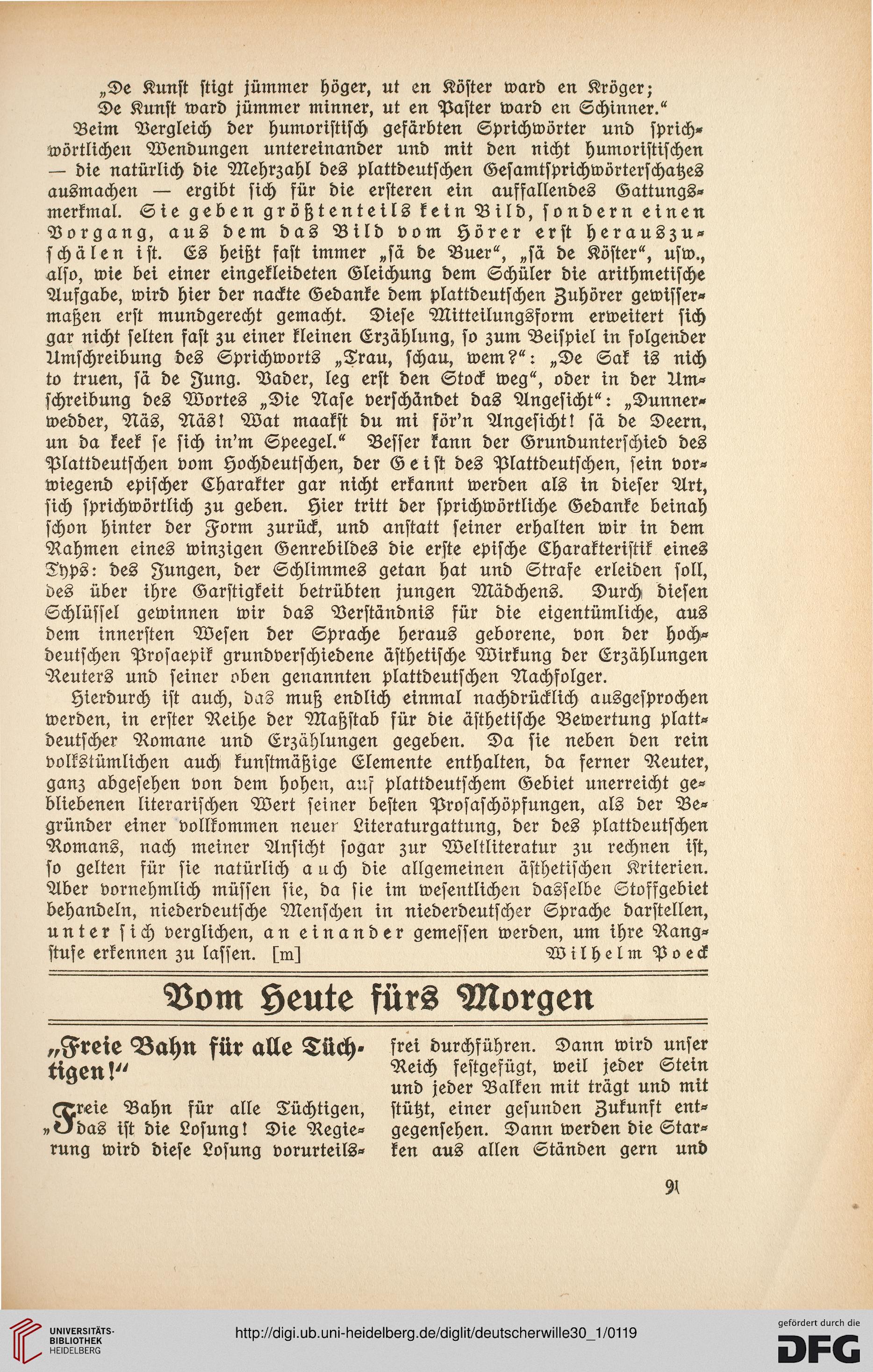„De Kunst stigt jümmer höger, ut en Köster ward en Kröger;
De Kunst ward jümmer minner, ut en Paster ward en Schinner."
Beim Vergleich der humoristisch gefärbten Sprichwörter und sprich-
wörtlichen Wendungen untereinander und mit den nicht humoristischen
— die natürlich die Mehrzahl des plattdeutschen Gesamtsprichwörterschatzes
ausmachen — ergibt sich für die ersteren ein auffallendes Gattungs-
merkmal. Sie geben größtenteils kein Bild, sondern einen
Vorgang, aus dem das Bild vom Hörer erst herauszu-
schälen ist. Es heißt fast immer „sä de Buer", ^sä de Köster^, usw.,
also, wie bei einer eingekleideten Gleichung dem Schüler die arithmetische
Aufgabe, wird hier der nackte Gedanke dem plattdeutschen Zuhörer gewisser»
maßen erst mundgerecht gemacht. Diese Mitteilungsform erweitert sich
gar nicht selten fast zu einer kleinen Erzählung, so zum Beispiel in folgender
Umschreibung des Sprichworts „Trau, schau, wem?^: „De Sak is nich
to truen, sä de Iung. Vader, leg erst den SLock weg^, oder in der Um«
schreibung des Wortes „Die Nase verschändet das Angesicht^: „Dunner-
wedder, Näs, Näs! Wat maakst du mi för'n Angesicht! sä de Deern,
un da keek se sich in'm Speegel." Besser kann der Grundunterschied des
Plattdeutschen vom tzochdeutschen, der Geist des Plattdeutschen, sein vor-
wiegend epischer Charakter gar nicht erkannt werden als in dieser Art,
sich sprichwörtlich zu geben. tzier tritt der sprichwörtliche Gedanke beinah
schon hinter der Form zurück, und anstatt seiner erhalten wir in dem
Rahmen eines winzigen Genrebildes die erste epische Charakteristik eines
Typs: des Iungen, der Schlimmes getan hat und Strafe erleiden soll,
des über ihre Garstigkeit betrübten jungen MLdchens. Durch diesen
Schlüssel gewinnen wir das Verständnis für die eigentümliche, aus
dem innersten Wesen der Sprache heraus geborene, von der hoch^-
deutschen Prosaepik grundverschiedene ästhetische Wirkung der Crzählungen
Reuters und seiner oben genannten plattdeutschen Nachfolger.
tzierdurch ist auch, das muß endlich einmal nachdrücklich ausgesprochen
werden, in erster Reihe der Maßstab für die ästhetische Bewertung platt-
deutscher Romane und Erzählungen gegeben. Da sie neben den rein
volkstümlichen auch kunstmäßige Elemente enthalten, da ferner Reuter,
ganz abgesehen von dem hohen, auf plattdeutschem Gebiet unerreicht ge-
bliebenen literarischen Wert seiner besten Prosaschöpfungen, als der Be»
gründer einer vollkommen neuer Literaturgattung, der des plattdeutschen
Romans, nach meiner Ansicht sogar zur WelLliteratur zu rechnen ist,
so gelten für sie natürlich auch die allgemeinen ästhetischen Kriterien.
Aber vornehmlich müssen sie, da ste im wesentlichen dasselbe SLoffgebiet
behandeln, niederdeutsche Menschen in niederdeutscher Sprache darstellen,
unter sich verglichen, an einander gemessen werden, um ihre Rang-
stufe erkennen zu lassen. Wilhelm Poeck
_Vom tzeute fürs Morgen
„Freie Bahn für nüe Tüch- frei durchführen. Dann wird unser
tiqen!" Reich festgefügt) weil jeder Stein
^ und jeder Balken mit Lrägt und mit
Mreie Bahn für alle Tüchtigen, stützt, einer gesunden Zukunft ent«
„Odas ist die Losung! Die Regie» gegensehen. Dann werden die Star«-
rung wird diese Losung vorurteils- ken aus allen Ständen gern und
9i
De Kunst ward jümmer minner, ut en Paster ward en Schinner."
Beim Vergleich der humoristisch gefärbten Sprichwörter und sprich-
wörtlichen Wendungen untereinander und mit den nicht humoristischen
— die natürlich die Mehrzahl des plattdeutschen Gesamtsprichwörterschatzes
ausmachen — ergibt sich für die ersteren ein auffallendes Gattungs-
merkmal. Sie geben größtenteils kein Bild, sondern einen
Vorgang, aus dem das Bild vom Hörer erst herauszu-
schälen ist. Es heißt fast immer „sä de Buer", ^sä de Köster^, usw.,
also, wie bei einer eingekleideten Gleichung dem Schüler die arithmetische
Aufgabe, wird hier der nackte Gedanke dem plattdeutschen Zuhörer gewisser»
maßen erst mundgerecht gemacht. Diese Mitteilungsform erweitert sich
gar nicht selten fast zu einer kleinen Erzählung, so zum Beispiel in folgender
Umschreibung des Sprichworts „Trau, schau, wem?^: „De Sak is nich
to truen, sä de Iung. Vader, leg erst den SLock weg^, oder in der Um«
schreibung des Wortes „Die Nase verschändet das Angesicht^: „Dunner-
wedder, Näs, Näs! Wat maakst du mi för'n Angesicht! sä de Deern,
un da keek se sich in'm Speegel." Besser kann der Grundunterschied des
Plattdeutschen vom tzochdeutschen, der Geist des Plattdeutschen, sein vor-
wiegend epischer Charakter gar nicht erkannt werden als in dieser Art,
sich sprichwörtlich zu geben. tzier tritt der sprichwörtliche Gedanke beinah
schon hinter der Form zurück, und anstatt seiner erhalten wir in dem
Rahmen eines winzigen Genrebildes die erste epische Charakteristik eines
Typs: des Iungen, der Schlimmes getan hat und Strafe erleiden soll,
des über ihre Garstigkeit betrübten jungen MLdchens. Durch diesen
Schlüssel gewinnen wir das Verständnis für die eigentümliche, aus
dem innersten Wesen der Sprache heraus geborene, von der hoch^-
deutschen Prosaepik grundverschiedene ästhetische Wirkung der Crzählungen
Reuters und seiner oben genannten plattdeutschen Nachfolger.
tzierdurch ist auch, das muß endlich einmal nachdrücklich ausgesprochen
werden, in erster Reihe der Maßstab für die ästhetische Bewertung platt-
deutscher Romane und Erzählungen gegeben. Da sie neben den rein
volkstümlichen auch kunstmäßige Elemente enthalten, da ferner Reuter,
ganz abgesehen von dem hohen, auf plattdeutschem Gebiet unerreicht ge-
bliebenen literarischen Wert seiner besten Prosaschöpfungen, als der Be»
gründer einer vollkommen neuer Literaturgattung, der des plattdeutschen
Romans, nach meiner Ansicht sogar zur WelLliteratur zu rechnen ist,
so gelten für sie natürlich auch die allgemeinen ästhetischen Kriterien.
Aber vornehmlich müssen sie, da ste im wesentlichen dasselbe SLoffgebiet
behandeln, niederdeutsche Menschen in niederdeutscher Sprache darstellen,
unter sich verglichen, an einander gemessen werden, um ihre Rang-
stufe erkennen zu lassen. Wilhelm Poeck
_Vom tzeute fürs Morgen
„Freie Bahn für nüe Tüch- frei durchführen. Dann wird unser
tiqen!" Reich festgefügt) weil jeder Stein
^ und jeder Balken mit Lrägt und mit
Mreie Bahn für alle Tüchtigen, stützt, einer gesunden Zukunft ent«
„Odas ist die Losung! Die Regie» gegensehen. Dann werden die Star«-
rung wird diese Losung vorurteils- ken aus allen Ständen gern und
9i