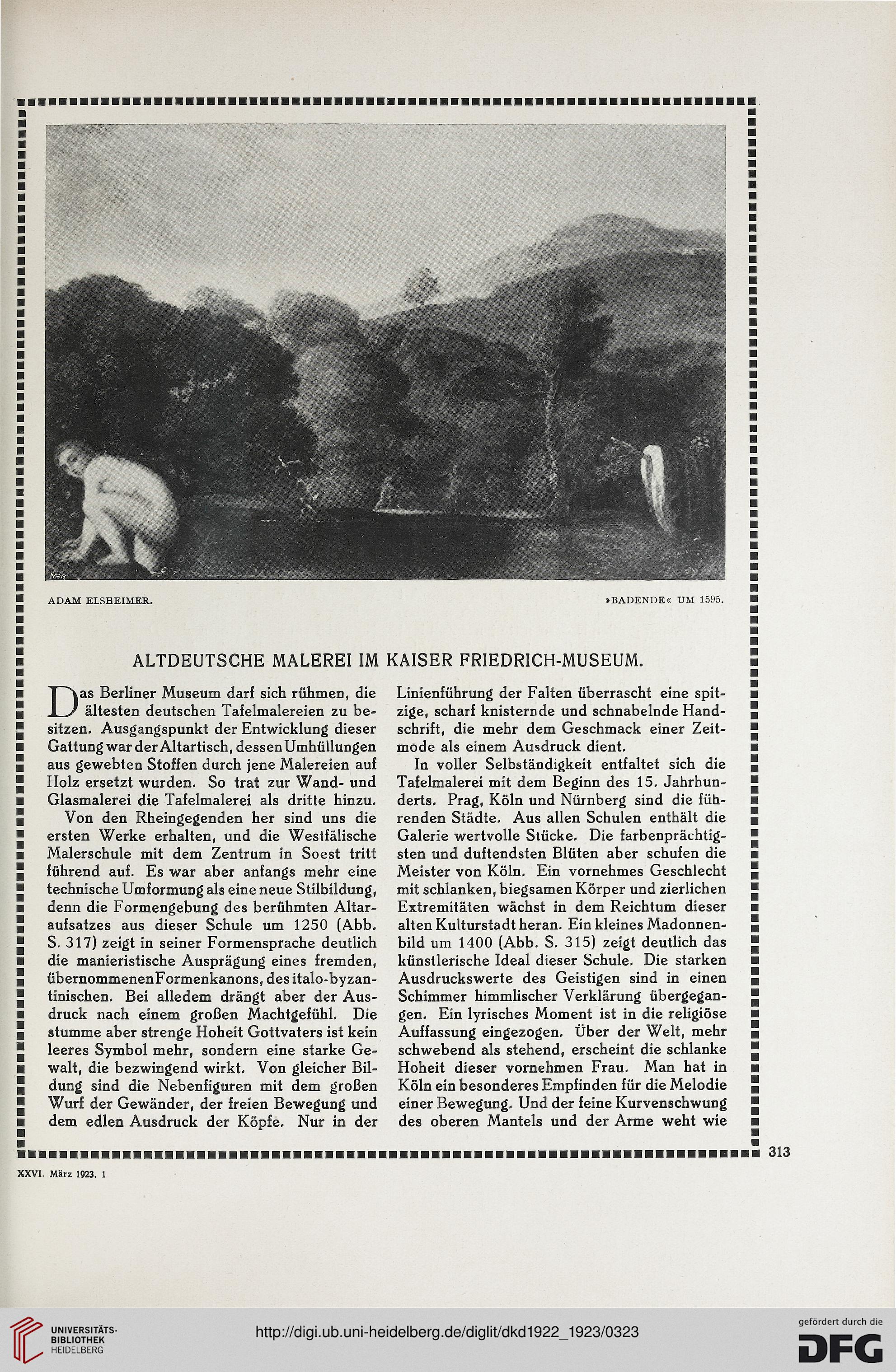ADAM ELSHEIMER. >BADENDE« UM 1595.
ALTDEUTSCHE MALEREI IM KAISER FRIEDRICH-MUSEUM.
Das Berliner Museum darf sich rühmen, die
ältesten deutschen Tafelmalereien zu be-
sitzen. Ausgangspunkt der Entwicklung dieser
Gattung war der Altartisch, dessen Umhüllungen
aus gewebten Stoffen durch jene Malereien auf
Holz ersetzt wurden. So trat zur Wand- und
Glasmalerei die Tafelmalerei als dritte hinzu.
Von den Rheingegenden her sind uns die
ersten Werke erhalten, und die Westfälische
Malerschule mit dem Zentrum in Soest tritt
führend auf. Es war aber anfangs mehr eine
technische Umformung als eine neue Stilbildung,
denn die Formengebung des berühmten Altar-
aufsatzes aus dieser Schule um 1250 (Abb.
S. 317) zeigt in seiner Formensprache deutlich
die manieristische Ausprägung eines fremden,
übernommenenFormenkanons, des italo-byzan-
tinischen. Bei alledem drängt aber der Aus-
druck nach einem großen Machtgefühl. Die
stumme aber strenge Hoheit Gottvaters ist kein
leeres Symbol mehr, sondern eine starke Ge-
walt, die bezwingend wirkt. Von gleicher Bil-
dung sind die Nebenfiguren mit dem großen
Wurf der Gewänder, der freien Bewegung und
dem edlen Ausdruck der Köpfe. Nur in der
Linienführung der Falten überrascht eine spit-
zige, scharf knisternde und schnäbelnde Hand-
schrift, die mehr dem Geschmack einer Zeit-
mode als einem Ausdruck dient.
In voller Selbständigkeit entfaltet sich die
Tafelmalerei mit dem Beginn des 15. Jahrhun-
derts. Prag, Köln und Nürnberg sind die füh-
renden Städte. Aus allen Schulen enthält die
Galerie wertvolle Stücke. Die farbenprächtig-
sten und duftendsten Blüten aber schufen die
Meister von Köln. Ein vornehmes Geschlecht
mit schlanken, biegsamen Körper und zierlichen
Extremitäten wächst in dem Reichtum dieser
alten Kulturstadt heran. Ein kleines Madonnen-
bild um 1400 (Abb. S. 315) zeigt deutlich das
künstlerische Ideal dieser Schule. Die starken
Ausdruckswerte des Geistigen sind in einen
Schimmer himmlischer Verklärung übergegan-
gen. Ein lyrisches Moment ist in die religiöse
Auffassung eingezogen. Über der Welt, mehr
schwebend als stehend, erscheint die schlanke
Hoheit dieser vornehmen Frau. Man hat in
Köln ein besonderes Empfinden für die Melodie
einer Bewegung. Und der feine Kurvenschwung
des oberen Mantels und der Arme weht wie
XXVI. März 1923. 1
ALTDEUTSCHE MALEREI IM KAISER FRIEDRICH-MUSEUM.
Das Berliner Museum darf sich rühmen, die
ältesten deutschen Tafelmalereien zu be-
sitzen. Ausgangspunkt der Entwicklung dieser
Gattung war der Altartisch, dessen Umhüllungen
aus gewebten Stoffen durch jene Malereien auf
Holz ersetzt wurden. So trat zur Wand- und
Glasmalerei die Tafelmalerei als dritte hinzu.
Von den Rheingegenden her sind uns die
ersten Werke erhalten, und die Westfälische
Malerschule mit dem Zentrum in Soest tritt
führend auf. Es war aber anfangs mehr eine
technische Umformung als eine neue Stilbildung,
denn die Formengebung des berühmten Altar-
aufsatzes aus dieser Schule um 1250 (Abb.
S. 317) zeigt in seiner Formensprache deutlich
die manieristische Ausprägung eines fremden,
übernommenenFormenkanons, des italo-byzan-
tinischen. Bei alledem drängt aber der Aus-
druck nach einem großen Machtgefühl. Die
stumme aber strenge Hoheit Gottvaters ist kein
leeres Symbol mehr, sondern eine starke Ge-
walt, die bezwingend wirkt. Von gleicher Bil-
dung sind die Nebenfiguren mit dem großen
Wurf der Gewänder, der freien Bewegung und
dem edlen Ausdruck der Köpfe. Nur in der
Linienführung der Falten überrascht eine spit-
zige, scharf knisternde und schnäbelnde Hand-
schrift, die mehr dem Geschmack einer Zeit-
mode als einem Ausdruck dient.
In voller Selbständigkeit entfaltet sich die
Tafelmalerei mit dem Beginn des 15. Jahrhun-
derts. Prag, Köln und Nürnberg sind die füh-
renden Städte. Aus allen Schulen enthält die
Galerie wertvolle Stücke. Die farbenprächtig-
sten und duftendsten Blüten aber schufen die
Meister von Köln. Ein vornehmes Geschlecht
mit schlanken, biegsamen Körper und zierlichen
Extremitäten wächst in dem Reichtum dieser
alten Kulturstadt heran. Ein kleines Madonnen-
bild um 1400 (Abb. S. 315) zeigt deutlich das
künstlerische Ideal dieser Schule. Die starken
Ausdruckswerte des Geistigen sind in einen
Schimmer himmlischer Verklärung übergegan-
gen. Ein lyrisches Moment ist in die religiöse
Auffassung eingezogen. Über der Welt, mehr
schwebend als stehend, erscheint die schlanke
Hoheit dieser vornehmen Frau. Man hat in
Köln ein besonderes Empfinden für die Melodie
einer Bewegung. Und der feine Kurvenschwung
des oberen Mantels und der Arme weht wie
XXVI. März 1923. 1