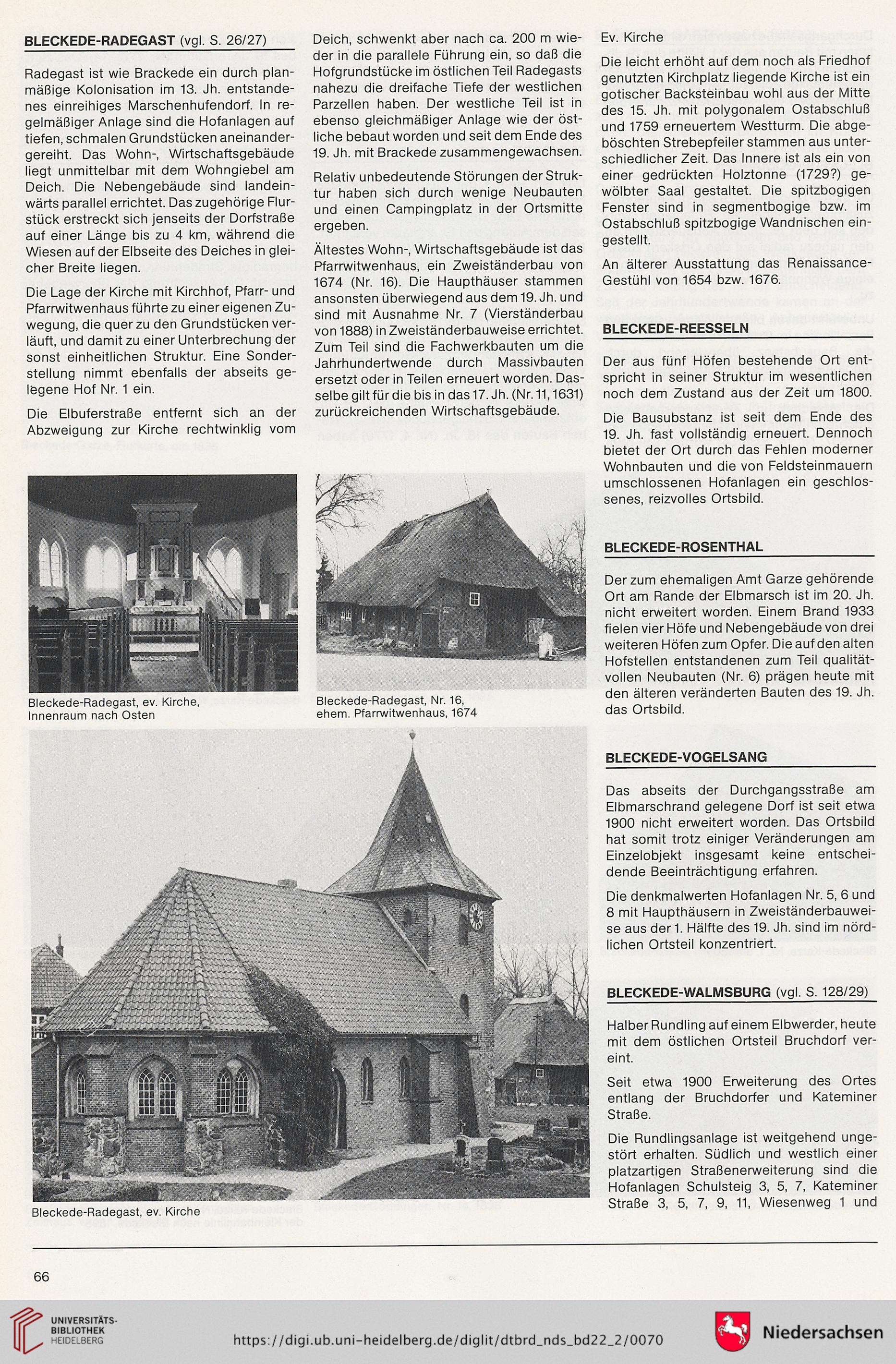BLECKEDE-RADEGAST (vgl. S. 26/27)
Radegast ist wie Brackede ein durch plan-
mäßige Kolonisation im 13. Jh. entstande-
nes einreihiges Marschenhufendorf. In re-
gelmäßiger Anlage sind die Hofanlagen auf
tiefen, schmalen Grundstücken aneinander-
gereiht. Das Wohn-, Wirtschaftsgebäude
liegt unmittelbar mit dem Wohngiebel am
Deich. Die Nebengebäude sind landein-
wärts parallel errichtet. Das zugehörige Flur-
stück erstreckt sich jenseits der Dorfstraße
auf einer Länge bis zu 4 km, während die
Wiesen auf der Elbseite des Deiches in glei-
cher Breite liegen.
Die Lage der Kirche mit Kirchhof, Pfarr- und
Pfarrwitwenhaus führte zu einer eigenen Zu-
wegung, die quer zu den Grundstücken ver-
läuft, und damit zu einer Unterbrechung der
sonst einheitlichen Struktur. Eine Sonder-
stellung nimmt ebenfalls der abseits ge-
legene Hof Nr. 1 ein.
Die Elbuferstraße entfernt sich an der
Abzweigung zur Kirche rechtwinklig vom
Deich, schwenkt aber nach ca. 200 m wie-
der in die parallele Führung ein, so daß die
Hofgrundstücke im östlichen Teil Radegasts
nahezu die dreifache Tiefe der westlichen
Parzellen haben. Der westliche Teil ist in
ebenso gleichmäßiger Anlage wie der öst-
liche bebaut worden und seit dem Ende des
19. Jh. mit Brackede zusammengewachsen.
Relativ unbedeutende Störungen der Struk-
tur haben sich durch wenige Neubauten
und einen Campingplatz in der Ortsmitte
ergeben.
Ältestes Wohn-, Wirtschaftsgebäude ist das
Pfarrwitwenhaus, ein Zweiständerbau von
1674 (Nr. 16). Die Haupthäuser stammen
ansonsten überwiegend aus dem 19. Jh. und
sind mit Ausnahme Nr. 7 (Vierständerbau
von 1888) in Zweiständerbauweise errichtet.
Zum Teil sind die Fachwerkbauten um die
Jahrhundertwende durch Massivbauten
ersetzt oder in Teilen erneuert worden. Das-
selbe gilt für die bis in das 17. Jh. (Nr. 11,1631)
zurückreichenden Wirtschaftsgebäude.
Bleckede-Radegast, ev. Kirche,
Innenraum nach Osten
Bleckede-Radegast, Nr. 16,
ehern. Pfarrwitwenhaus, 1674
Bleckede-Radegast, ev. Kirche
Ev. Kirche
Die leicht erhöht auf dem noch als Friedhof
genutzten Kirchplatz liegende Kirche ist ein
gotischer Backsteinbau wohl aus der Mitte
des 15. Jh. mit polygonalem Ostabschluß
und 1759 erneuertem Westturm. Die abge-
böschten Strebepfeiler stammen aus unter-
schiedlicher Zeit. Das Innere ist als ein von
einer gedrückten Holztonne (1729?) ge-
wölbter Saal gestaltet. Die spitzbogigen
Fenster sind in segmentbogige bzw. im
Ostabschluß spitzbogige Wandnischen ein-
gestellt.
An älterer Ausstattung das Renaissance-
Gestühl von 1654 bzw. 1676.
BLECKEDE-REESSELN
Der aus fünf Höfen bestehende Ort ent-
spricht in seiner Struktur im wesentlichen
noch dem Zustand aus der Zeit um 1800.
Die Bausubstanz ist seit dem Ende des
19. Jh. fast vollständig erneuert. Dennoch
bietet der Ort durch das Fehlen moderner
Wohnbauten und die von Feldsteinmauern
umschlossenen Hofanlagen ein geschlos-
senes, reizvolles Ortsbild.
BLECKEDE-ROSENTHAL
Der zum ehemaligen Amt Garze gehörende
Ort am Rande der Elbmarsch ist im 20. Jh.
nicht erweitert worden. Einem Brand 1933
fielen vier Höfe und Nebengebäude von drei
weiteren Höfen zum Opfer. Die auf den alten
Hofstellen entstandenen zum Teil qualität-
vollen Neubauten (Nr. 6) prägen heute mit
den älteren veränderten Bauten des 19. Jh.
das Ortsbild.
BLECKEDE-VOGELSANG
Das abseits der Durchgangsstraße am
Elbmarschrand gelegene Dorf ist seit etwa
1900 nicht erweitert worden. Das Ortsbild
hat somit trotz einiger Veränderungen am
Einzelobjekt insgesamt keine entschei-
dende Beeinträchtigung erfahren.
Die denkmalwerten Hofanlagen Nr. 5, 6 und
8 mit Haupthäusern in Zweiständerbauwei-
se aus der 1. Hälfte des 19. Jh. sind im nörd-
lichen Ortsteil konzentriert.
BLECKEDE-WALMSBURG (vgl. S. 128/29)
Halber Rundling auf einem Elbwerder, heute
mit dem östlichen Ortsteil Bruchdorf ver-
eint.
Seit etwa 1900 Erweiterung des Ortes
entlang der Bruchdorfer und Kateminer
Straße.
Die Rundlingsanlage ist weitgehend unge-
stört erhalten. Südlich und westlich einer
platzartigen Straßenerweiterung sind die
Hofanlagen Schulsteig 3, 5, 7, Kateminer
Straße 3, 5, 7, 9, 11, Wiesenweg 1 und
66
Radegast ist wie Brackede ein durch plan-
mäßige Kolonisation im 13. Jh. entstande-
nes einreihiges Marschenhufendorf. In re-
gelmäßiger Anlage sind die Hofanlagen auf
tiefen, schmalen Grundstücken aneinander-
gereiht. Das Wohn-, Wirtschaftsgebäude
liegt unmittelbar mit dem Wohngiebel am
Deich. Die Nebengebäude sind landein-
wärts parallel errichtet. Das zugehörige Flur-
stück erstreckt sich jenseits der Dorfstraße
auf einer Länge bis zu 4 km, während die
Wiesen auf der Elbseite des Deiches in glei-
cher Breite liegen.
Die Lage der Kirche mit Kirchhof, Pfarr- und
Pfarrwitwenhaus führte zu einer eigenen Zu-
wegung, die quer zu den Grundstücken ver-
läuft, und damit zu einer Unterbrechung der
sonst einheitlichen Struktur. Eine Sonder-
stellung nimmt ebenfalls der abseits ge-
legene Hof Nr. 1 ein.
Die Elbuferstraße entfernt sich an der
Abzweigung zur Kirche rechtwinklig vom
Deich, schwenkt aber nach ca. 200 m wie-
der in die parallele Führung ein, so daß die
Hofgrundstücke im östlichen Teil Radegasts
nahezu die dreifache Tiefe der westlichen
Parzellen haben. Der westliche Teil ist in
ebenso gleichmäßiger Anlage wie der öst-
liche bebaut worden und seit dem Ende des
19. Jh. mit Brackede zusammengewachsen.
Relativ unbedeutende Störungen der Struk-
tur haben sich durch wenige Neubauten
und einen Campingplatz in der Ortsmitte
ergeben.
Ältestes Wohn-, Wirtschaftsgebäude ist das
Pfarrwitwenhaus, ein Zweiständerbau von
1674 (Nr. 16). Die Haupthäuser stammen
ansonsten überwiegend aus dem 19. Jh. und
sind mit Ausnahme Nr. 7 (Vierständerbau
von 1888) in Zweiständerbauweise errichtet.
Zum Teil sind die Fachwerkbauten um die
Jahrhundertwende durch Massivbauten
ersetzt oder in Teilen erneuert worden. Das-
selbe gilt für die bis in das 17. Jh. (Nr. 11,1631)
zurückreichenden Wirtschaftsgebäude.
Bleckede-Radegast, ev. Kirche,
Innenraum nach Osten
Bleckede-Radegast, Nr. 16,
ehern. Pfarrwitwenhaus, 1674
Bleckede-Radegast, ev. Kirche
Ev. Kirche
Die leicht erhöht auf dem noch als Friedhof
genutzten Kirchplatz liegende Kirche ist ein
gotischer Backsteinbau wohl aus der Mitte
des 15. Jh. mit polygonalem Ostabschluß
und 1759 erneuertem Westturm. Die abge-
böschten Strebepfeiler stammen aus unter-
schiedlicher Zeit. Das Innere ist als ein von
einer gedrückten Holztonne (1729?) ge-
wölbter Saal gestaltet. Die spitzbogigen
Fenster sind in segmentbogige bzw. im
Ostabschluß spitzbogige Wandnischen ein-
gestellt.
An älterer Ausstattung das Renaissance-
Gestühl von 1654 bzw. 1676.
BLECKEDE-REESSELN
Der aus fünf Höfen bestehende Ort ent-
spricht in seiner Struktur im wesentlichen
noch dem Zustand aus der Zeit um 1800.
Die Bausubstanz ist seit dem Ende des
19. Jh. fast vollständig erneuert. Dennoch
bietet der Ort durch das Fehlen moderner
Wohnbauten und die von Feldsteinmauern
umschlossenen Hofanlagen ein geschlos-
senes, reizvolles Ortsbild.
BLECKEDE-ROSENTHAL
Der zum ehemaligen Amt Garze gehörende
Ort am Rande der Elbmarsch ist im 20. Jh.
nicht erweitert worden. Einem Brand 1933
fielen vier Höfe und Nebengebäude von drei
weiteren Höfen zum Opfer. Die auf den alten
Hofstellen entstandenen zum Teil qualität-
vollen Neubauten (Nr. 6) prägen heute mit
den älteren veränderten Bauten des 19. Jh.
das Ortsbild.
BLECKEDE-VOGELSANG
Das abseits der Durchgangsstraße am
Elbmarschrand gelegene Dorf ist seit etwa
1900 nicht erweitert worden. Das Ortsbild
hat somit trotz einiger Veränderungen am
Einzelobjekt insgesamt keine entschei-
dende Beeinträchtigung erfahren.
Die denkmalwerten Hofanlagen Nr. 5, 6 und
8 mit Haupthäusern in Zweiständerbauwei-
se aus der 1. Hälfte des 19. Jh. sind im nörd-
lichen Ortsteil konzentriert.
BLECKEDE-WALMSBURG (vgl. S. 128/29)
Halber Rundling auf einem Elbwerder, heute
mit dem östlichen Ortsteil Bruchdorf ver-
eint.
Seit etwa 1900 Erweiterung des Ortes
entlang der Bruchdorfer und Kateminer
Straße.
Die Rundlingsanlage ist weitgehend unge-
stört erhalten. Südlich und westlich einer
platzartigen Straßenerweiterung sind die
Hofanlagen Schulsteig 3, 5, 7, Kateminer
Straße 3, 5, 7, 9, 11, Wiesenweg 1 und
66