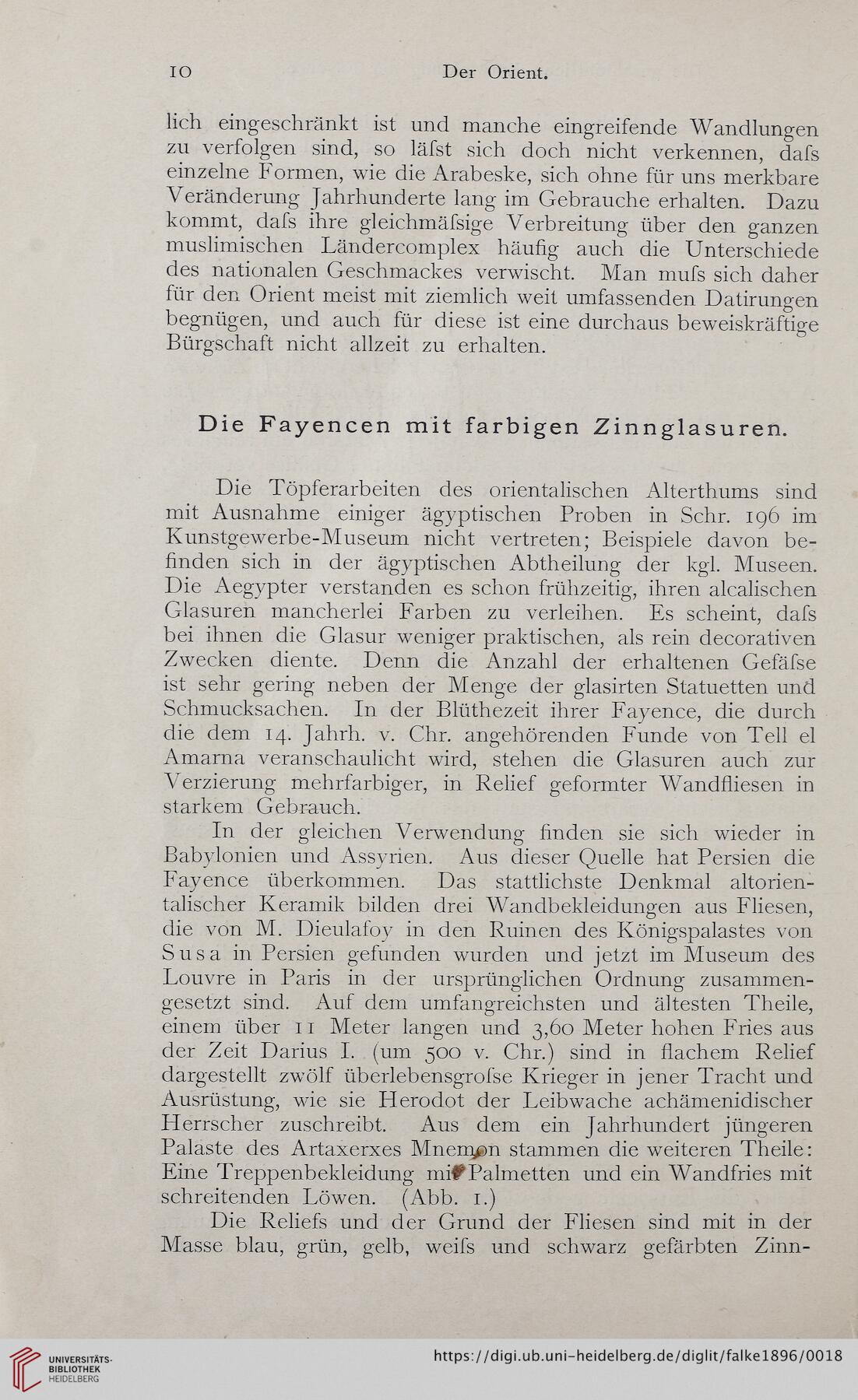IO
Der Orient.
lieh eingeschränkt ist und manche eingreifende Wandlungen
zu verfolgen sind, so läfst sich doch nicht verkennen, dafs
einzelne Formen, wie die Arabeske, sich ohne für uns merkbare
Veränderung Jahrhunderte lang im Gebrauche erhalten. Dazu
kommt, dafs ihre gleichmäfsige Verbreitung über den ganzen
muslimischen Ländercomplex häufig auch die Unterschiede
des nationalen Geschmackes verwischt. Man mufs sich daher
für den Orient meist mit ziemlich weit umfassenden Datirungen
begnügen, und auch für diese ist eine durchaus beweiskräftige
Bürgschaft nicht allzeit zu erhalten.
Die Fayencen mit farbigen Zinnglasuren.
Die Töpferarbeiten des orientalischen Alterthums sind
mit Ausnahme einiger ägyptischen Proben in Sehr. 196 im
Kunstgewerbe-Museum nicht vertreten; Beispiele davon be-
finden sich in der ägyptischen Abtheilung der kgl. Museen.
Die Aegypter verstanden es schon frühzeitig, ihren alcalischen
Glasuren mancherlei Farben zu verleihen. Es scheint, dafs
bei ihnen die Glasur weniger praktischen, als rein decorativen
Zwecken diente. Denn die Anzahl der erhaltenen Gefäfse
ist sehr gering neben der Menge der glasirten Statuetten und
Schmucksachen. In der Blüthezeit ihrer Fayence, die durch
die dem 14. Jahrh. v. Chr. angehörenden Funde von Teil el
Amarna veranschaulicht wird, stehen die Glasuren auch zur
Verzierung mehrfarbiger, in Relief geformter Wandfliesen in
starkem Gebrauch.
In der gleichen Verwendung finden sie sich wieder in
Babylonien und Assyrien. Aus dieser Quelle hat Persien die
Fayence überkommen. Das stattlichste Denkmal altorien-
talischer Keramik bilden drei Wandbekleidungen aus Fliesen,
die von M. Dieulafoy in den Ruinen des Königspalastes von
Susa in Persien gefunden wurden und jetzt im Museum des
Louvre in Paris in der ursprünglichen Ordnung zusammen-
gesetzt sind. Auf dem umfangreichsten und ältesten Theile,
einem über 11 Meter langen und 3,60 Meter hohen Fries aus
der Zeit Darius I. (um 500 v. Chr.) sind in flachem Relief
dargestellt zwölf überlebensgrofse Krieger in jener Tracht und
Ausrüstung, wie sie Herodot der Leibwache achämenidischer
Herrscher zuschreibt. Aus dem ein Jahrhundert jüngeren
Palaste des Artaxerxes Mnenyan stammen die weiteren Theile:
Eine Treppenbekleidung miFPalmetten und ein Wandfries mit
schreitenden Löwen. (Abb. 1.)
Die Reliefs und der Grund der Fliesen sind mit in der
Masse blau, grün, gelb, weifs und schwarz gefärbten Zinn-
Der Orient.
lieh eingeschränkt ist und manche eingreifende Wandlungen
zu verfolgen sind, so läfst sich doch nicht verkennen, dafs
einzelne Formen, wie die Arabeske, sich ohne für uns merkbare
Veränderung Jahrhunderte lang im Gebrauche erhalten. Dazu
kommt, dafs ihre gleichmäfsige Verbreitung über den ganzen
muslimischen Ländercomplex häufig auch die Unterschiede
des nationalen Geschmackes verwischt. Man mufs sich daher
für den Orient meist mit ziemlich weit umfassenden Datirungen
begnügen, und auch für diese ist eine durchaus beweiskräftige
Bürgschaft nicht allzeit zu erhalten.
Die Fayencen mit farbigen Zinnglasuren.
Die Töpferarbeiten des orientalischen Alterthums sind
mit Ausnahme einiger ägyptischen Proben in Sehr. 196 im
Kunstgewerbe-Museum nicht vertreten; Beispiele davon be-
finden sich in der ägyptischen Abtheilung der kgl. Museen.
Die Aegypter verstanden es schon frühzeitig, ihren alcalischen
Glasuren mancherlei Farben zu verleihen. Es scheint, dafs
bei ihnen die Glasur weniger praktischen, als rein decorativen
Zwecken diente. Denn die Anzahl der erhaltenen Gefäfse
ist sehr gering neben der Menge der glasirten Statuetten und
Schmucksachen. In der Blüthezeit ihrer Fayence, die durch
die dem 14. Jahrh. v. Chr. angehörenden Funde von Teil el
Amarna veranschaulicht wird, stehen die Glasuren auch zur
Verzierung mehrfarbiger, in Relief geformter Wandfliesen in
starkem Gebrauch.
In der gleichen Verwendung finden sie sich wieder in
Babylonien und Assyrien. Aus dieser Quelle hat Persien die
Fayence überkommen. Das stattlichste Denkmal altorien-
talischer Keramik bilden drei Wandbekleidungen aus Fliesen,
die von M. Dieulafoy in den Ruinen des Königspalastes von
Susa in Persien gefunden wurden und jetzt im Museum des
Louvre in Paris in der ursprünglichen Ordnung zusammen-
gesetzt sind. Auf dem umfangreichsten und ältesten Theile,
einem über 11 Meter langen und 3,60 Meter hohen Fries aus
der Zeit Darius I. (um 500 v. Chr.) sind in flachem Relief
dargestellt zwölf überlebensgrofse Krieger in jener Tracht und
Ausrüstung, wie sie Herodot der Leibwache achämenidischer
Herrscher zuschreibt. Aus dem ein Jahrhundert jüngeren
Palaste des Artaxerxes Mnenyan stammen die weiteren Theile:
Eine Treppenbekleidung miFPalmetten und ein Wandfries mit
schreitenden Löwen. (Abb. 1.)
Die Reliefs und der Grund der Fliesen sind mit in der
Masse blau, grün, gelb, weifs und schwarz gefärbten Zinn-