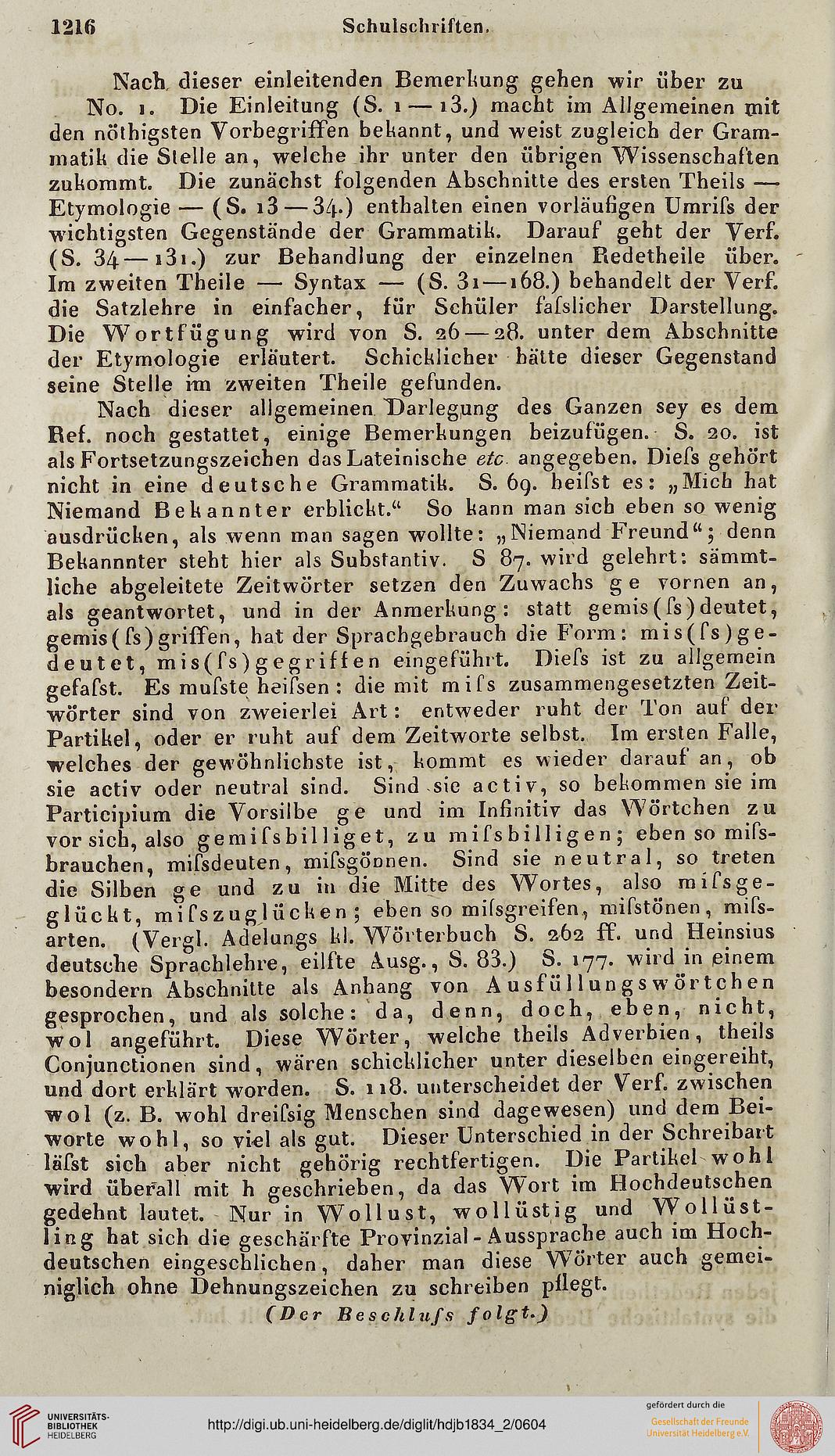1216
Schulsclu iften
Nach dieser einleitenden Bemerkung gehen wir über zu
No. i. Die Einleitung (S. 1 — i3.) macht im Allgemeinen mit
den nöthigsten Vorbegriffen bekannt, und weist zugleich der Gram-
matik die Stelle an, welche ihr unter den übrigen Wissenschaften
zukommt. Die zunächst folgenden Abschnitte des ersten Theils —
Etymologie — (S. i3—34-) enthalten einen vorläufigen Umrifs der
wichtigsten Gegenstände der Grammatik. Darauf geht der Verf.
(S. 34—131.) zur Behandlung der einzelnen Redetheile über.
Im zweiten Theile — Syntax — (S. 3i —168.) behandelt der Verf.
die Satzlehre in einfacher, für Schüler fäfslicher Darstellung.
Die Wortfügung wird von S. 26 — 28. unter dem Abschnitte
der Etymologie erläutert. Schicklicher hätte dieser Gegenstand
seine Stelle im zweiten Theile gefunden.
Nach dieser allgemeinen Darlegung des Ganzen sey es dem
Ref. noch gestattet, einige Bemerkungen beizufügen. S. 20. ist
als Fortsetzungszeichen das Lateinische etc angegeben. Diefs gehört
nicht in eine deutsche Grammatik. S. 69. beifst es: „Mich hat
Niemand Bekannter erblickt.“ So kann man sich eben so wenig
ausdrücken, als wenn man sagen wollte: „Niemand Freund“; denn
Bekannnter steht hier als Substantiv. S 87. wird gelehrt: sämmt-
liche abgeleitete Zeitwörter setzen den Zuwachs ge vornen an,
als geantwortet, und in der Anmerkung: statt gemis (fs) deutet,
gemis ( fs) griffen, hat der Sprachgebrauch die Form : mis(fs)ge-
deutet, m i s ( fs ) g e g r if f e n eingeführt. Diefs ist zu allgemein
gefafst. Es mufste heifsen : die mit mifs zusammengesetzten Zeit-
wörter sind von zweierlei Art: entweder ruht der Ton auf der
Partikel, oder er ruht auf dem Zeitworte selbst. Im ersten Falle,
welches der gewöhnlichste ist, kommt es wieder darauf an, ob
sie activ oder neutral sind. Sind sie activ, so bekommen sie im
Participium die Vorsilbe ge und im Infinitiv das Wörtchen zu
vor sich, also ge m i fs bi 11 ig e t, zu mifsbilligen ; eben so mifs-
brauchen, mifsdeuten, mifsgömien. Sind sie neutral, so treten
die Silben ge und zu in die Mitte des Wortes, also mifs ge-
glückt, mifszuglücken ; eben so mifsgreifen, mifstönen, mifs-
arten. (Vergl. Adelungs kl. Wörterbuch S. 262 ff. und Heinsius
deutsche Sprachlehre, eilfte Ausg., S. 83.) S. 177. wird in einem
besondern Abschnitte als Anhang von Ausfüllungs wörtchen
gesprochen, und als solche: da, denn, doch, eben, nicht,
wol angeführt. Diese Wörter, welche theils Adverbien, theils
Conjunctionen sind, wären schicklicher unter dieselben eingereiht,
und dort erklärt worden. S. 118. unterscheidet der Verf. zwischen
wol (z. B. wohl dreifsig Menschen sind dagewesen) und dem Bei-
worte wohl, so viel als gut. Dieser Unterschied in der Schreibart
läfst sich aber nicht gehörig rechtfertigen. Die Partikel wohl
wird überall mit h geschrieben, da das Wort im Hochdeutschen
gedehnt lautet. Nur in Wollust, wollüstig und Wollüst-
ling hat sich die geschärfte Provinzial - Aussprache auch im Hoch-
deutschen eingeschlichen, daher man diese Wörter auch gemei-
niglich ohne Dehnungszeichen zu schreiben pflegt.
(Der Beschlufs folgt.)
Schulsclu iften
Nach dieser einleitenden Bemerkung gehen wir über zu
No. i. Die Einleitung (S. 1 — i3.) macht im Allgemeinen mit
den nöthigsten Vorbegriffen bekannt, und weist zugleich der Gram-
matik die Stelle an, welche ihr unter den übrigen Wissenschaften
zukommt. Die zunächst folgenden Abschnitte des ersten Theils —
Etymologie — (S. i3—34-) enthalten einen vorläufigen Umrifs der
wichtigsten Gegenstände der Grammatik. Darauf geht der Verf.
(S. 34—131.) zur Behandlung der einzelnen Redetheile über.
Im zweiten Theile — Syntax — (S. 3i —168.) behandelt der Verf.
die Satzlehre in einfacher, für Schüler fäfslicher Darstellung.
Die Wortfügung wird von S. 26 — 28. unter dem Abschnitte
der Etymologie erläutert. Schicklicher hätte dieser Gegenstand
seine Stelle im zweiten Theile gefunden.
Nach dieser allgemeinen Darlegung des Ganzen sey es dem
Ref. noch gestattet, einige Bemerkungen beizufügen. S. 20. ist
als Fortsetzungszeichen das Lateinische etc angegeben. Diefs gehört
nicht in eine deutsche Grammatik. S. 69. beifst es: „Mich hat
Niemand Bekannter erblickt.“ So kann man sich eben so wenig
ausdrücken, als wenn man sagen wollte: „Niemand Freund“; denn
Bekannnter steht hier als Substantiv. S 87. wird gelehrt: sämmt-
liche abgeleitete Zeitwörter setzen den Zuwachs ge vornen an,
als geantwortet, und in der Anmerkung: statt gemis (fs) deutet,
gemis ( fs) griffen, hat der Sprachgebrauch die Form : mis(fs)ge-
deutet, m i s ( fs ) g e g r if f e n eingeführt. Diefs ist zu allgemein
gefafst. Es mufste heifsen : die mit mifs zusammengesetzten Zeit-
wörter sind von zweierlei Art: entweder ruht der Ton auf der
Partikel, oder er ruht auf dem Zeitworte selbst. Im ersten Falle,
welches der gewöhnlichste ist, kommt es wieder darauf an, ob
sie activ oder neutral sind. Sind sie activ, so bekommen sie im
Participium die Vorsilbe ge und im Infinitiv das Wörtchen zu
vor sich, also ge m i fs bi 11 ig e t, zu mifsbilligen ; eben so mifs-
brauchen, mifsdeuten, mifsgömien. Sind sie neutral, so treten
die Silben ge und zu in die Mitte des Wortes, also mifs ge-
glückt, mifszuglücken ; eben so mifsgreifen, mifstönen, mifs-
arten. (Vergl. Adelungs kl. Wörterbuch S. 262 ff. und Heinsius
deutsche Sprachlehre, eilfte Ausg., S. 83.) S. 177. wird in einem
besondern Abschnitte als Anhang von Ausfüllungs wörtchen
gesprochen, und als solche: da, denn, doch, eben, nicht,
wol angeführt. Diese Wörter, welche theils Adverbien, theils
Conjunctionen sind, wären schicklicher unter dieselben eingereiht,
und dort erklärt worden. S. 118. unterscheidet der Verf. zwischen
wol (z. B. wohl dreifsig Menschen sind dagewesen) und dem Bei-
worte wohl, so viel als gut. Dieser Unterschied in der Schreibart
läfst sich aber nicht gehörig rechtfertigen. Die Partikel wohl
wird überall mit h geschrieben, da das Wort im Hochdeutschen
gedehnt lautet. Nur in Wollust, wollüstig und Wollüst-
ling hat sich die geschärfte Provinzial - Aussprache auch im Hoch-
deutschen eingeschlichen, daher man diese Wörter auch gemei-
niglich ohne Dehnungszeichen zu schreiben pflegt.
(Der Beschlufs folgt.)