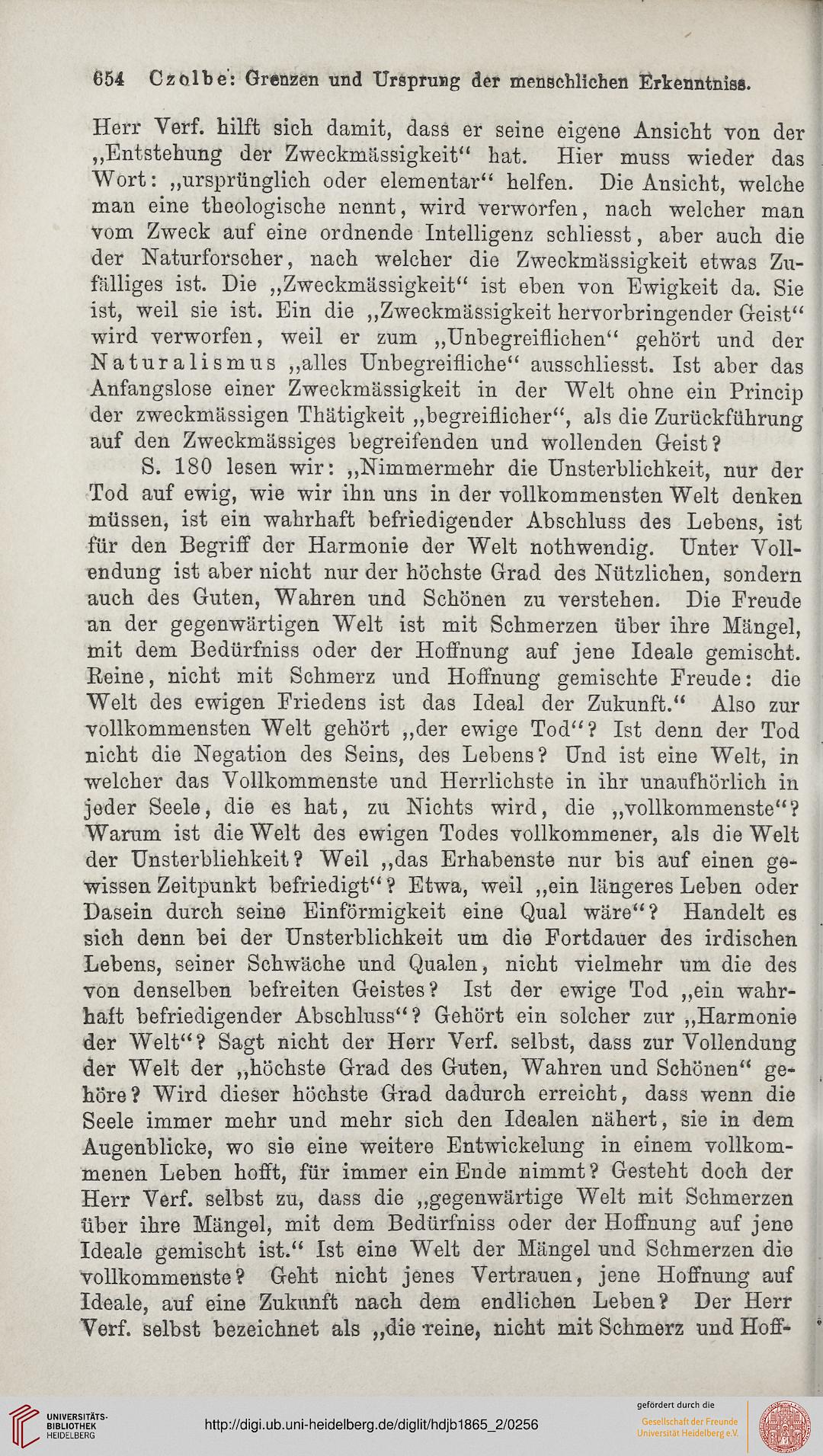654 Czolbe: Grenzen und Ursprung der menschlichen Erkenntniss.
Herr Verf. hilft sich damit, dass er seine eigene Ansicht von der
„Entstehung der Zweckmässigkeit“ hat. Hier muss wieder das
Wort: „ursprünglich oder elementar“ helfen. Die Ansicht, welche
man eine theologische nennt, wird verworfen, nach welcher man
Vom Zweck auf eine ordnende Intelligenz schliesst, aber auch die
der Naturforscher, nach welcher die Zweckmässigkeit etwas Zu-
fälliges ist. Die „Zweckmässigkeit“ ist eben von Ewigkeit da. Sie
ist, weil sie ist. Ein die „Zweckmässigkeit hervorbringender Geist“
wird verworfen, weil er zum „Unbegreiflichen“ gehört und der
Naturalismus „alles Unbegreifliche“ ausschliesst. Ist aber das
Anfangslose einer Zweckmässigkeit in der Welt ohne ein Princip
der zweckmässigen Thätigkeit „begreiflicher“, als die Zurückführung
auf den Zweckmässiges begreifenden und wollenden Geist?
S. 180 lesen wir: „Nimmermehr die Unsterblichkeit, nur der
Tod auf ewig, wie wir ihn uns in der vollkommensten Welt denken
müssen, ist ein wahrhaft befriedigender Abschluss des Lebens, ist
für den Begriff der Harmonie der Welt nothwendig. Unter Voll-
endung ist aber nicht nur der höchste Grad des Nützlichen, sondern
auch des Guten, Wahren und Schönen zu verstehen. Die Freude
an der gegenwärtigen Welt ist mit Schmerzen über ihre Mängel,
mit dem Bedürfniss oder der Hoffnung auf jene Ideale gemischt.
Reine, nicht mit Schmerz und Hoffnung gemischte Freude: die
Welt des ewigen Friedens ist das Ideal der Zukunft.“ Also zur
vollkommensten Welt gehört „der ewige Tod“? Ist denn der Tod
nicht die Negation des Seins, des Lebens? Und ist eine Welt, in
welcher das Vollkommenste und Herrlichste in ihr unaufhörlich in
jeder Seele, die es hat, zu Nichts wird, die „vollkommenste“?
Warum ist die Welt des ewigen Todes vollkommener, als die Welt
der Unsterblichkeit ? Weil „das Erhabenste nur bis auf einen ge-
wissen Zeitpunkt befriedigt“ ? Etwa, weil „ein längeres Leben oder
Dasein durch seine Einförmigkeit eine Qual wäre“? Handelt es
sich denn bei der Unsterblichkeit um die Fortdauer des irdischen
Lebens, seiner Schwäche und Qualen, nicht vielmehr um die des
von denselben befreiten Geistes? Ist der ewige Tod „ein wahr-
haft befriedigender Abschluss“? Gehört ein solcher zur „Harmonie
der Welt“? Sagt nicht der Herr Verf. selbst, dass zur Vollendung
der Welt der „höchste Grad des Guten, Wahren und Schönen“ ge-
höre? Wird dieser höchste Grad dadurch erreicht, dass wenn die
Seele immer mehr und mehr sich den Idealen nähert, sie in dem
Augenblicke, wo sie eine weitere Entwickelung in einem vollkom-
menen Leben hofft, für immer ein Ende nimmt ? Gesteht doch der
Herr Verf. selbst zu, dass die „gegenwärtige Welt mit Schmerzen
über ihre Mängel, mit dem Bedürfniss oder der Hoffnung auf jene
Ideale gemischt ist.“ Ist eine Welt der Mängel und Schmerzen die
vollkommenste? Geht nicht jenes Vertrauen, jene Hoffnung auf
Ideale, auf eine Zukunft nach dem endlichen Leben? Der Herr
Verf. selbst bezeichnet als „die reine, nicht mit Schmerz und Hoff-
Herr Verf. hilft sich damit, dass er seine eigene Ansicht von der
„Entstehung der Zweckmässigkeit“ hat. Hier muss wieder das
Wort: „ursprünglich oder elementar“ helfen. Die Ansicht, welche
man eine theologische nennt, wird verworfen, nach welcher man
Vom Zweck auf eine ordnende Intelligenz schliesst, aber auch die
der Naturforscher, nach welcher die Zweckmässigkeit etwas Zu-
fälliges ist. Die „Zweckmässigkeit“ ist eben von Ewigkeit da. Sie
ist, weil sie ist. Ein die „Zweckmässigkeit hervorbringender Geist“
wird verworfen, weil er zum „Unbegreiflichen“ gehört und der
Naturalismus „alles Unbegreifliche“ ausschliesst. Ist aber das
Anfangslose einer Zweckmässigkeit in der Welt ohne ein Princip
der zweckmässigen Thätigkeit „begreiflicher“, als die Zurückführung
auf den Zweckmässiges begreifenden und wollenden Geist?
S. 180 lesen wir: „Nimmermehr die Unsterblichkeit, nur der
Tod auf ewig, wie wir ihn uns in der vollkommensten Welt denken
müssen, ist ein wahrhaft befriedigender Abschluss des Lebens, ist
für den Begriff der Harmonie der Welt nothwendig. Unter Voll-
endung ist aber nicht nur der höchste Grad des Nützlichen, sondern
auch des Guten, Wahren und Schönen zu verstehen. Die Freude
an der gegenwärtigen Welt ist mit Schmerzen über ihre Mängel,
mit dem Bedürfniss oder der Hoffnung auf jene Ideale gemischt.
Reine, nicht mit Schmerz und Hoffnung gemischte Freude: die
Welt des ewigen Friedens ist das Ideal der Zukunft.“ Also zur
vollkommensten Welt gehört „der ewige Tod“? Ist denn der Tod
nicht die Negation des Seins, des Lebens? Und ist eine Welt, in
welcher das Vollkommenste und Herrlichste in ihr unaufhörlich in
jeder Seele, die es hat, zu Nichts wird, die „vollkommenste“?
Warum ist die Welt des ewigen Todes vollkommener, als die Welt
der Unsterblichkeit ? Weil „das Erhabenste nur bis auf einen ge-
wissen Zeitpunkt befriedigt“ ? Etwa, weil „ein längeres Leben oder
Dasein durch seine Einförmigkeit eine Qual wäre“? Handelt es
sich denn bei der Unsterblichkeit um die Fortdauer des irdischen
Lebens, seiner Schwäche und Qualen, nicht vielmehr um die des
von denselben befreiten Geistes? Ist der ewige Tod „ein wahr-
haft befriedigender Abschluss“? Gehört ein solcher zur „Harmonie
der Welt“? Sagt nicht der Herr Verf. selbst, dass zur Vollendung
der Welt der „höchste Grad des Guten, Wahren und Schönen“ ge-
höre? Wird dieser höchste Grad dadurch erreicht, dass wenn die
Seele immer mehr und mehr sich den Idealen nähert, sie in dem
Augenblicke, wo sie eine weitere Entwickelung in einem vollkom-
menen Leben hofft, für immer ein Ende nimmt ? Gesteht doch der
Herr Verf. selbst zu, dass die „gegenwärtige Welt mit Schmerzen
über ihre Mängel, mit dem Bedürfniss oder der Hoffnung auf jene
Ideale gemischt ist.“ Ist eine Welt der Mängel und Schmerzen die
vollkommenste? Geht nicht jenes Vertrauen, jene Hoffnung auf
Ideale, auf eine Zukunft nach dem endlichen Leben? Der Herr
Verf. selbst bezeichnet als „die reine, nicht mit Schmerz und Hoff-