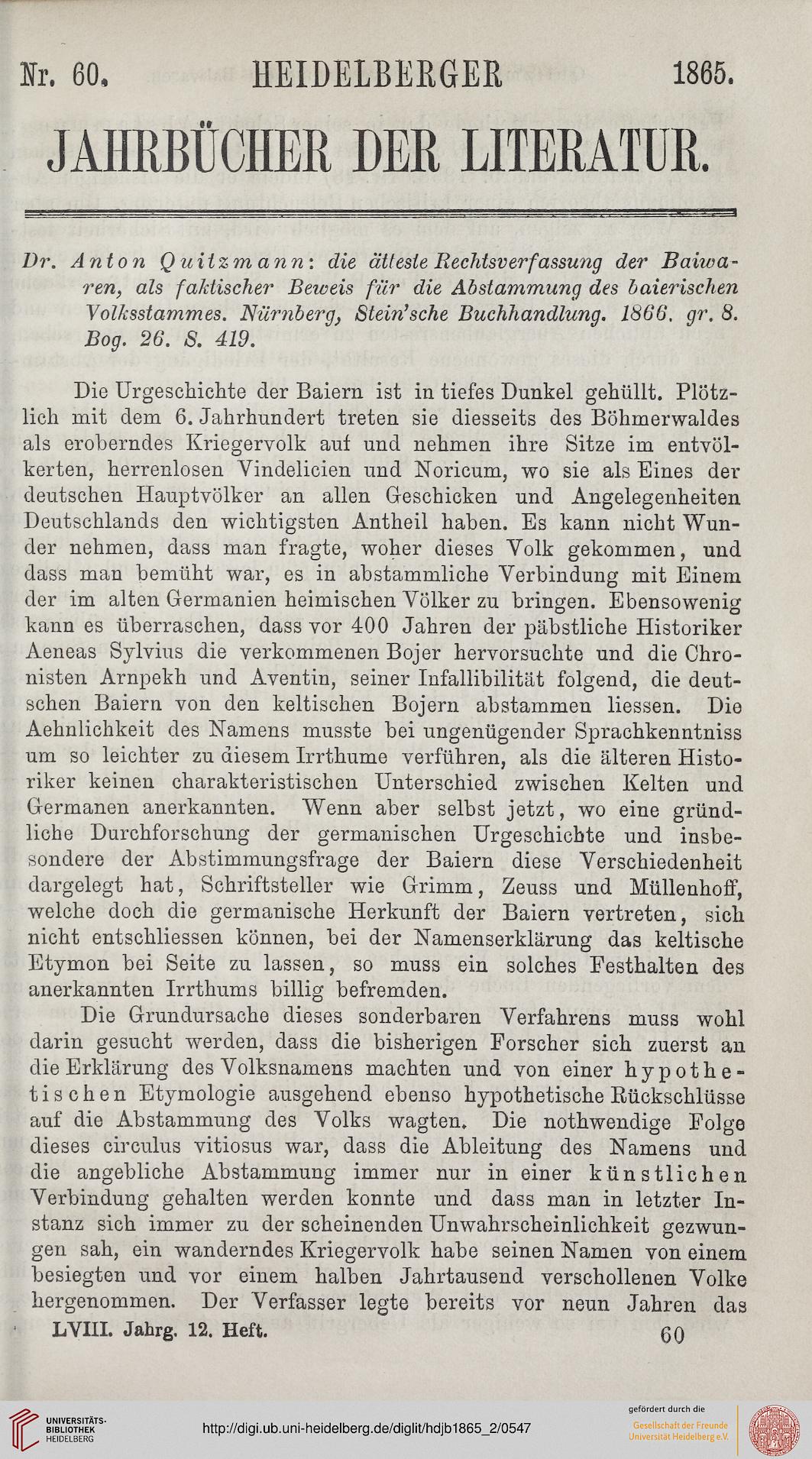Nr. SO. HEIDEIBERGEB 1SS6.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Dr. Anton Q uitzm ann: die ätteste Rechtsverfassung der Baiwa-
ren, als faktischer Beweis für die Abstammung des baierischen
Volksstammes. Nürnberq. Stein’sche Buchhandlunq. 1866. qr. 8.
Bog. 26. 8. 419.
Die Urgeschichte der Baiern ist in tiefes Dunkel gehüllt. Plötz-
lich mit dem 6. Jahrhundert treten sie diesseits des Böhmerwaldes
als eroberndes Kriegervolk auf und nehmen ihre Sitze im entvöl-
kerten, herrenlosen Vindelicien und Noricum, wo sie als Eines der
deutschen Hauptvölker an allen Geschicken und Angelegenheiten
Deutschlands den wichtigsten Antheil haben. Es kann nicht Wun-
der nehmen, dass man fragte, woher dieses Volk gekommen, und
dass man bemüht war, es in abstammliche Verbindung mit Einem
der im alten Germanien heimischen Völker zu bringen. Ebensowenig
kann es überraschen, dass vor 400 Jahren der päbstliche Historiker
Aeneas Sylvius die verkommenen Bojer hervorsuchte und die Chro-
nisten Arnpekh und Aventin, seiner Infallibilität folgend, die deut-
schen Baiern von den keltischen Bojern abstammen liessen. Die
Aehnlichkeit des Namens musste bei ungenügender Sprachkenntniss
um so leichter zu diesem Irrthume verführen, als die älteren Histo-
riker keinen charakteristischen Unterschied zwischen Kelten und
Germanen anerkannten. Wenn aber selbst jetzt, wo eine gründ-
liche Durchforschung der germanischen Urgeschichte und insbe-
sondere der Abstimmungsfrage der Baiern diese Verschiedenheit
dargelegt hat, Schriftsteller wie Grimm, Zeuss und Müllenhoff,
welche doch die germanische Herkunft der Baiern vertreten, sich
nicht entschliessen können, bei der Namenserklärung das keltische
Etymon bei Seite zu lassen, so muss ein solches Festhalten des
anerkannten Irrthums billig befremden.
Die Grundursache dieses sonderbaren Verfahrens muss wohl
darin gesucht werden, dass die bisherigen Forscher sich zuerst an
die Erklärung des Volksnamens machten und von einer hypothe-
tischen Etymologie ausgehend ebenso hypothetische Rückschlüsse
auf die Abstammung des Volks wagten. Die nothwendige Folge
dieses circulus vitiosus war, dass die Ableitung des Namens und
die angebliche Abstammung immer nur in einer künstlichen
Verbindung gehalten werden konnte und dass man in letzter In-
stanz sich immer zu der scheinenden Unwahrscheinlichkeit gezwun-
gen sah, ein wanderndes Kriegervolk habe seinen Namen von einem
besiegten und vor einem halben Jahrtausend verschollenen Volke
hergenommen. Der Verfasser legte bereits vor neun Jahren das
LVIII. Jahrg. 12. Heft. 60
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Dr. Anton Q uitzm ann: die ätteste Rechtsverfassung der Baiwa-
ren, als faktischer Beweis für die Abstammung des baierischen
Volksstammes. Nürnberq. Stein’sche Buchhandlunq. 1866. qr. 8.
Bog. 26. 8. 419.
Die Urgeschichte der Baiern ist in tiefes Dunkel gehüllt. Plötz-
lich mit dem 6. Jahrhundert treten sie diesseits des Böhmerwaldes
als eroberndes Kriegervolk auf und nehmen ihre Sitze im entvöl-
kerten, herrenlosen Vindelicien und Noricum, wo sie als Eines der
deutschen Hauptvölker an allen Geschicken und Angelegenheiten
Deutschlands den wichtigsten Antheil haben. Es kann nicht Wun-
der nehmen, dass man fragte, woher dieses Volk gekommen, und
dass man bemüht war, es in abstammliche Verbindung mit Einem
der im alten Germanien heimischen Völker zu bringen. Ebensowenig
kann es überraschen, dass vor 400 Jahren der päbstliche Historiker
Aeneas Sylvius die verkommenen Bojer hervorsuchte und die Chro-
nisten Arnpekh und Aventin, seiner Infallibilität folgend, die deut-
schen Baiern von den keltischen Bojern abstammen liessen. Die
Aehnlichkeit des Namens musste bei ungenügender Sprachkenntniss
um so leichter zu diesem Irrthume verführen, als die älteren Histo-
riker keinen charakteristischen Unterschied zwischen Kelten und
Germanen anerkannten. Wenn aber selbst jetzt, wo eine gründ-
liche Durchforschung der germanischen Urgeschichte und insbe-
sondere der Abstimmungsfrage der Baiern diese Verschiedenheit
dargelegt hat, Schriftsteller wie Grimm, Zeuss und Müllenhoff,
welche doch die germanische Herkunft der Baiern vertreten, sich
nicht entschliessen können, bei der Namenserklärung das keltische
Etymon bei Seite zu lassen, so muss ein solches Festhalten des
anerkannten Irrthums billig befremden.
Die Grundursache dieses sonderbaren Verfahrens muss wohl
darin gesucht werden, dass die bisherigen Forscher sich zuerst an
die Erklärung des Volksnamens machten und von einer hypothe-
tischen Etymologie ausgehend ebenso hypothetische Rückschlüsse
auf die Abstammung des Volks wagten. Die nothwendige Folge
dieses circulus vitiosus war, dass die Ableitung des Namens und
die angebliche Abstammung immer nur in einer künstlichen
Verbindung gehalten werden konnte und dass man in letzter In-
stanz sich immer zu der scheinenden Unwahrscheinlichkeit gezwun-
gen sah, ein wanderndes Kriegervolk habe seinen Namen von einem
besiegten und vor einem halben Jahrtausend verschollenen Volke
hergenommen. Der Verfasser legte bereits vor neun Jahren das
LVIII. Jahrg. 12. Heft. 60