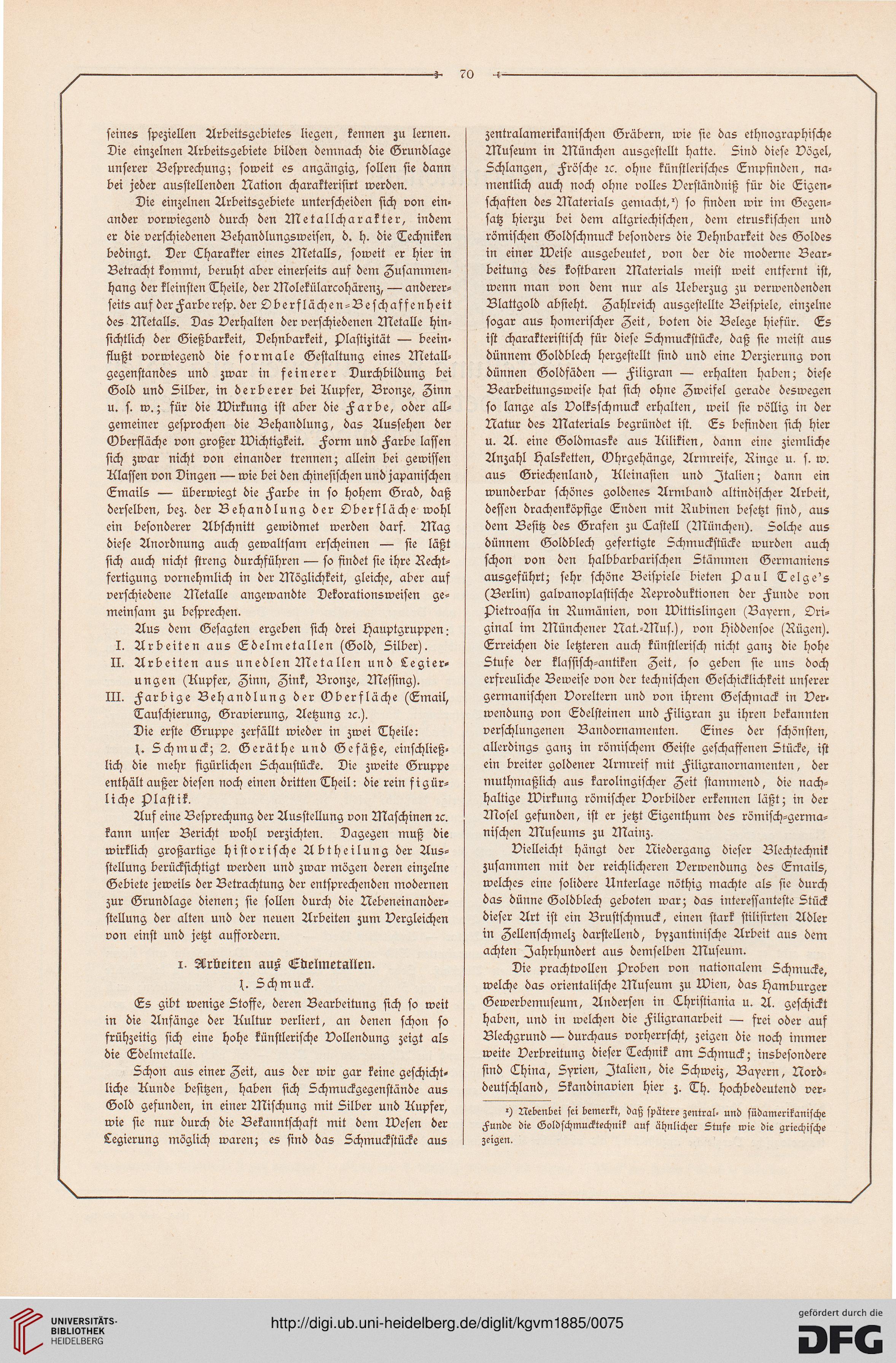4- 70 -4
/
\
seines speziellen Arbeitsgebietes liegen, kennen zu lernen.
Die einzelnen Arbeitsgebiete bilden demnach die Grundlage
unserer Besprechung; soweit es angängig, sollen sie dann
bei jeder ausstellenden Nation charakterisirt werden.
Die einzelnen Arbeitsgebiete unterscheiden sich von ein-
ander vorwiegend durch den Metallcharakter, indem
er die verschiedenen Behandlungsweisen, d. h. die Techniken
bedingt. Der Charakter eines Metalls, soweit er hier in
Betracht kommt, beruht aber einerseits auf dem Zusammen-
hang der kleinsten Theile, der Molekülarcohärenz, — anderer-
seits aus der Farbe resp. der Oberflächen-Beschaffenheit
des Metalls. Das Verhalten der verschiedenen Metalle hin-
sichtlich der Gießbarkeit, Dehnbarkeit, Plastizität — beein-
flußt vorwiegend die formale Gestaltung eines Metall-
gegenstandes und zwar in feinerer Durchbildung bei
Gold und Silber, in derberer bei Aupfer, Bronze, Zinn
u. f. w.; für die Wirkung ist aber die Farbe, oder all-
gemeiner gesprochen die Behandlung, das Aussehen der
Gberfläche von großer Wichtigkeit. Form und Farbe lassen
sich zwar nicht von einander trennen; allein bei gewissen
Alassen von Dingen — wie bei den chinesischen und japanischen
Emails — überwiegt die Farbe in so hohem Grad, daß
derselben, bez. der Behandlung der Oberfläche wohl
ein besonderer Abschnitt gewidmet werden darf. Mag
diese Anordnung auch gewaltsam erscheinen — sie läßt
sich auch nicht streng durchführen — so findet sie ihre Recht-
fertigung vornehmlich in der Möglichkeit, gleiche, aber auf
verschiedene Metalle angewandte Dekorationsweisen ge-
meinsam zu besprechen.
Aus dem Gesagten ergeben sich drei Hauptgruppen:
I. Arbeiten aus Edelmetallen (Gold, Silber).
II. Arbeiten aus unedlen Metallen und Legier-
ungen (Aupfer, Zinn, Zink, Bronze, Messing).
III. Farbige Behandlung der Gberfläche (Email,
Tauschierung, Gravierung, Aetzung rc.).
Die erste Gruppe zerfällt wieder in zwei Theile:
I. Schmuck; 2. Geräthe und Gefäße, einschließ-
lich die mehr figürlichen Schaustücke. Die zweite Gruppe
enthält außer diesen noch einen dritten Theil: die rein figür-
liche Plastik.
Auf eine Besprechung der Ausstellung von Maschinen ro.
kann unser Bericht wohl verzichten. Dagegen muß die
wirklich großartige historische Abtheilung der Aus-
stellung berücksichtigt werden und zwar mögen deren einzelne
Gebiete jeweils der Betrachtung der entsprechenden modernen
zur Grundlage dienen; sie sollen durch die Nebeneinander-
stellung der alten und der neuen Arbeiten zum Vergleichen
von einst und jetzt auffordern.
i. Arbeiten rmß Ldclmetsllen.
Schmuck.
Es gibt wenige Stoffe, deren Bearbeitung sich so weit
in die Anfänge der Aultur verliert, an denen schon so
frühzeitig sich eine hohe künstlerische Vollendung zeigt als
die Edelmetalle.
Schon aus einer Zeit, aus der wir gar keine geschicht-
liche Runde besitzen, haben sich Schmuckgegenstände aus
Gold gefunden, in einer Mischung mit Silber und Aupfer,
wie sie nur durch die Bekanntschaft mit dem Wesen der
Legierung möglich waren; es sind das Schmuckstücke aus
zentralamerikanischen Gräbern, wie sie das ethnographische
Museum in München ausgestellt hatte. Sind diese Vögel,
Schlangen, Frösche rc. ohne künstlerisches Empfinden, na-
mentlich auch noch ohne volles Verständniß für die Eigen-
schaften des Materials gemacht,') so finden wir im Gegen-
satz hierzu bei dem altgriechischen, dem etruskischen und
römischen Goldschmuck besonders die Dehnbarkeit des Goldes
in einer Weise ausgebeutet, von der die moderne Bear-
beitung des kostbaren Materials meist weit entfernt ist,
wenn man von dem nur als Ueberzug zu verwendenden
Blattgold absieht. Zahlreich ausgestellte Beispiele, einzelne
sogar aus homerischer Zeit, boten die Belege hiefür. Es
ist charakteristisch für diese Schmuckstücke, daß sie meist aus
dünnem Goldblech hergestellt sind und eine Verzierung von
dünnen Goldfäden — Filigran — erhalten haben; diese
Bearbeitungsweise hat sich ohne Zweifel gerade deswegen
so lange als Volksschmuck erhalten, weil sie völlig in der
Natur des Materials begründet ist. Es befinden sich hier
u. A. eine Goldmaske aus Ailikien, dann eine ziemliche
Anzahl Halsketten, Ohrgehänge, Armreife, Ringe u. f. w.
aus Griechenland, Aleinasien und Italien; dann ein
wunderbar schönes goldenes Armband altindischer Arbeit,
dessen drachenköpfige Enden mit Rubinen besetzt sind, aus
dem Besitz des Grafen zu Lastell (München). Solche aus
dünnem Goldblech gefertigte Schmuckstücke wurden auch
schon von den halbbarbarischen Stämmen Germaniens
ausgeführt; sehr schöne Beispiele bieten Paul Telge's
(Berlin) galvanoplastische Reproduktionen der Funde von
pietroassa in Rumänien, von Wittislingen (Bayern, Ori-
ginal im Münchener Nat.-Muf.), von Isiddensoe (Rügen).
Erreichen die letzteren auch künstlerisch nicht ganz die hohe
Stufe der klassisch-antiken Zeit, so geben sie uns doch
erfreuliche Beweise von der technischen Geschicklichkeit unserer
germanischen Voreltern und von ihrem Geschmack in Ver-
wendung von Edelsteinen und Filigran zu ihren bekannten
verschlungenen Bandornamenten. Eines der schönsten,
allerdings ganz in römischem Geiste geschaffenen Stücke, ist
ein breiter goldener Armreif mit Filigranornamenten, der
muthmaßlich aus karolingischer Zeit stammend, die nach-
haltige Wirkung römischer Vorbilder erkennen läßt; in der
Mosel gefunden, ist er jetzt Eigenthum des römisch-germa-
nischen Museums zu Mainz.
Vielleicht hängt der Niedergang dieser Blechtechnik
zusammen mit der reichlicheren Verwendung des Emails,
welches eine solidere Unterlage nöthig machte als sie durch
das dünne Goldblech geboten war; das interessanteste Stück
dieser Art ist ein Brustschmuck, einen stark stilisirten Adler
in Zellenschmelz darstellend, byzantinische Arbeit aus dem
achten Jahrhundert aus demselben Museum.
Die prachtvollen Proben von nationalem Schmucke,
welche das orientalische Museum zu Wien, das Hamburger
Gewerbemuseum, Andersen in Lhristiania u. A. geschickt
haben, und in welchen die Filigranarbeit — frei oder auf
Blechgrund — durchaus vorherrscht, zeigen die noch immer
weite Verbreitung dieser Technik am Schmuck; insbesondere
sind Lhina, Syrien, Italien, die Schweiz, Bayern, Nord-
deutschland, Skandinavien hier z. Th. hochbedeutend ver-
-) Nebenbei sei bemerkt, daß spätere zentral- und südamerikanische
Funde die Goldschmucktechnik auf ähnlicher Stufe wie die griechische
zeigen.
X
/
\
seines speziellen Arbeitsgebietes liegen, kennen zu lernen.
Die einzelnen Arbeitsgebiete bilden demnach die Grundlage
unserer Besprechung; soweit es angängig, sollen sie dann
bei jeder ausstellenden Nation charakterisirt werden.
Die einzelnen Arbeitsgebiete unterscheiden sich von ein-
ander vorwiegend durch den Metallcharakter, indem
er die verschiedenen Behandlungsweisen, d. h. die Techniken
bedingt. Der Charakter eines Metalls, soweit er hier in
Betracht kommt, beruht aber einerseits auf dem Zusammen-
hang der kleinsten Theile, der Molekülarcohärenz, — anderer-
seits aus der Farbe resp. der Oberflächen-Beschaffenheit
des Metalls. Das Verhalten der verschiedenen Metalle hin-
sichtlich der Gießbarkeit, Dehnbarkeit, Plastizität — beein-
flußt vorwiegend die formale Gestaltung eines Metall-
gegenstandes und zwar in feinerer Durchbildung bei
Gold und Silber, in derberer bei Aupfer, Bronze, Zinn
u. f. w.; für die Wirkung ist aber die Farbe, oder all-
gemeiner gesprochen die Behandlung, das Aussehen der
Gberfläche von großer Wichtigkeit. Form und Farbe lassen
sich zwar nicht von einander trennen; allein bei gewissen
Alassen von Dingen — wie bei den chinesischen und japanischen
Emails — überwiegt die Farbe in so hohem Grad, daß
derselben, bez. der Behandlung der Oberfläche wohl
ein besonderer Abschnitt gewidmet werden darf. Mag
diese Anordnung auch gewaltsam erscheinen — sie läßt
sich auch nicht streng durchführen — so findet sie ihre Recht-
fertigung vornehmlich in der Möglichkeit, gleiche, aber auf
verschiedene Metalle angewandte Dekorationsweisen ge-
meinsam zu besprechen.
Aus dem Gesagten ergeben sich drei Hauptgruppen:
I. Arbeiten aus Edelmetallen (Gold, Silber).
II. Arbeiten aus unedlen Metallen und Legier-
ungen (Aupfer, Zinn, Zink, Bronze, Messing).
III. Farbige Behandlung der Gberfläche (Email,
Tauschierung, Gravierung, Aetzung rc.).
Die erste Gruppe zerfällt wieder in zwei Theile:
I. Schmuck; 2. Geräthe und Gefäße, einschließ-
lich die mehr figürlichen Schaustücke. Die zweite Gruppe
enthält außer diesen noch einen dritten Theil: die rein figür-
liche Plastik.
Auf eine Besprechung der Ausstellung von Maschinen ro.
kann unser Bericht wohl verzichten. Dagegen muß die
wirklich großartige historische Abtheilung der Aus-
stellung berücksichtigt werden und zwar mögen deren einzelne
Gebiete jeweils der Betrachtung der entsprechenden modernen
zur Grundlage dienen; sie sollen durch die Nebeneinander-
stellung der alten und der neuen Arbeiten zum Vergleichen
von einst und jetzt auffordern.
i. Arbeiten rmß Ldclmetsllen.
Schmuck.
Es gibt wenige Stoffe, deren Bearbeitung sich so weit
in die Anfänge der Aultur verliert, an denen schon so
frühzeitig sich eine hohe künstlerische Vollendung zeigt als
die Edelmetalle.
Schon aus einer Zeit, aus der wir gar keine geschicht-
liche Runde besitzen, haben sich Schmuckgegenstände aus
Gold gefunden, in einer Mischung mit Silber und Aupfer,
wie sie nur durch die Bekanntschaft mit dem Wesen der
Legierung möglich waren; es sind das Schmuckstücke aus
zentralamerikanischen Gräbern, wie sie das ethnographische
Museum in München ausgestellt hatte. Sind diese Vögel,
Schlangen, Frösche rc. ohne künstlerisches Empfinden, na-
mentlich auch noch ohne volles Verständniß für die Eigen-
schaften des Materials gemacht,') so finden wir im Gegen-
satz hierzu bei dem altgriechischen, dem etruskischen und
römischen Goldschmuck besonders die Dehnbarkeit des Goldes
in einer Weise ausgebeutet, von der die moderne Bear-
beitung des kostbaren Materials meist weit entfernt ist,
wenn man von dem nur als Ueberzug zu verwendenden
Blattgold absieht. Zahlreich ausgestellte Beispiele, einzelne
sogar aus homerischer Zeit, boten die Belege hiefür. Es
ist charakteristisch für diese Schmuckstücke, daß sie meist aus
dünnem Goldblech hergestellt sind und eine Verzierung von
dünnen Goldfäden — Filigran — erhalten haben; diese
Bearbeitungsweise hat sich ohne Zweifel gerade deswegen
so lange als Volksschmuck erhalten, weil sie völlig in der
Natur des Materials begründet ist. Es befinden sich hier
u. A. eine Goldmaske aus Ailikien, dann eine ziemliche
Anzahl Halsketten, Ohrgehänge, Armreife, Ringe u. f. w.
aus Griechenland, Aleinasien und Italien; dann ein
wunderbar schönes goldenes Armband altindischer Arbeit,
dessen drachenköpfige Enden mit Rubinen besetzt sind, aus
dem Besitz des Grafen zu Lastell (München). Solche aus
dünnem Goldblech gefertigte Schmuckstücke wurden auch
schon von den halbbarbarischen Stämmen Germaniens
ausgeführt; sehr schöne Beispiele bieten Paul Telge's
(Berlin) galvanoplastische Reproduktionen der Funde von
pietroassa in Rumänien, von Wittislingen (Bayern, Ori-
ginal im Münchener Nat.-Muf.), von Isiddensoe (Rügen).
Erreichen die letzteren auch künstlerisch nicht ganz die hohe
Stufe der klassisch-antiken Zeit, so geben sie uns doch
erfreuliche Beweise von der technischen Geschicklichkeit unserer
germanischen Voreltern und von ihrem Geschmack in Ver-
wendung von Edelsteinen und Filigran zu ihren bekannten
verschlungenen Bandornamenten. Eines der schönsten,
allerdings ganz in römischem Geiste geschaffenen Stücke, ist
ein breiter goldener Armreif mit Filigranornamenten, der
muthmaßlich aus karolingischer Zeit stammend, die nach-
haltige Wirkung römischer Vorbilder erkennen läßt; in der
Mosel gefunden, ist er jetzt Eigenthum des römisch-germa-
nischen Museums zu Mainz.
Vielleicht hängt der Niedergang dieser Blechtechnik
zusammen mit der reichlicheren Verwendung des Emails,
welches eine solidere Unterlage nöthig machte als sie durch
das dünne Goldblech geboten war; das interessanteste Stück
dieser Art ist ein Brustschmuck, einen stark stilisirten Adler
in Zellenschmelz darstellend, byzantinische Arbeit aus dem
achten Jahrhundert aus demselben Museum.
Die prachtvollen Proben von nationalem Schmucke,
welche das orientalische Museum zu Wien, das Hamburger
Gewerbemuseum, Andersen in Lhristiania u. A. geschickt
haben, und in welchen die Filigranarbeit — frei oder auf
Blechgrund — durchaus vorherrscht, zeigen die noch immer
weite Verbreitung dieser Technik am Schmuck; insbesondere
sind Lhina, Syrien, Italien, die Schweiz, Bayern, Nord-
deutschland, Skandinavien hier z. Th. hochbedeutend ver-
-) Nebenbei sei bemerkt, daß spätere zentral- und südamerikanische
Funde die Goldschmucktechnik auf ähnlicher Stufe wie die griechische
zeigen.
X