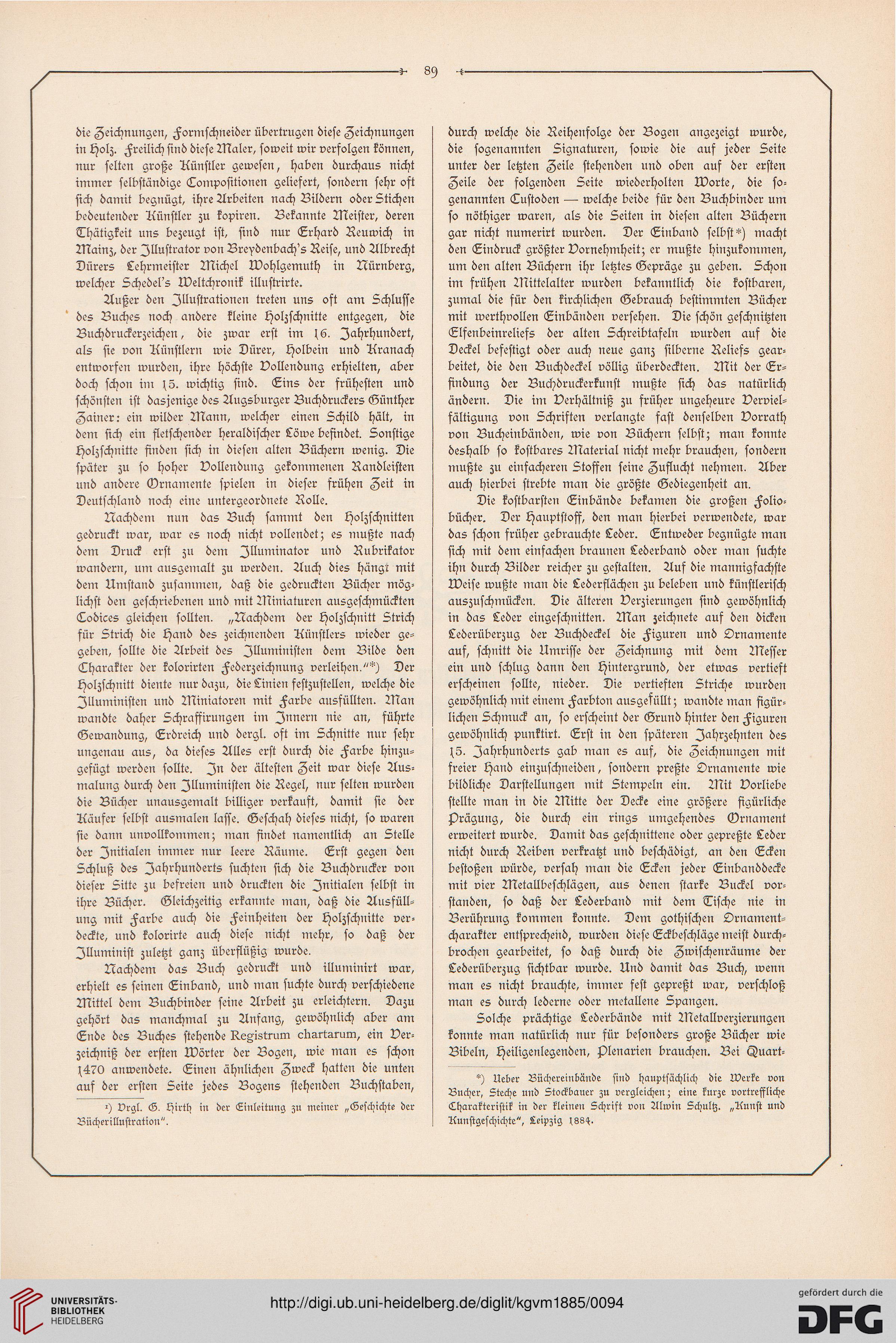die Zeichnungen, Formschneider übertrugen diese Zeichnungen
in Holz. Freilich sind diese Maler, soweit wir verfolgen können,
nur selten große Künstler gewesen, haben durchaus nicht
immer selbständige Tompositionen geliefert, sondern sehr oft
sich damit begnügt, ihre Arbeiten nach Bildern oder Stichen
bedeutender Künstler zu kopiren. Bekannte Meister, deren
Thätigkeit uns bezeugt ist, sind nur Erhard Reuwich in
Mainz, der Illustrator von Breydenbach's Reise, und Albrecht
Dürers Lehrmeister Michel Wohlgemutst in Nürnberg,
welcher Schedel's Weltchronik illustrirte.
Außer den Illustrationen treten uns oft an: Schluffe
des Buches noch andere kleine Holzschnitte entgegen, die
Buchdruckerzeichen, die zwar erst im \6. Jahrhundert,
als sie von Künstlern wie Dürer, Holbein und Kranach
entworfen wurden, ihre höchste Vollendung erhielten, aber
doch schon im \5. wichtig sind. Eins der frühesten und
schönsten ist dasjenige des Augsburger Buchdruckers Günther
Zainer: ein wilder Mann, welcher einen Schild hält, in
dem sich ein fletschender heraldischer Löwe befindet. Sonstige
Holzschnitte finden sich in diesen alten Büchern wenig. Die
später zu so hoher Vollendung gekommenen Randleisten
und andere Ornamente spielen in dieser frühen Zeit in
Deutschland noch eine untergeordnete Rolle.
Nachdem nun das Buch sammt den Holzschnitten
gedruckt war, war es noch nicht vollendet; es mußte nach
dem Druck erst zu dem Illuminator und Rubrikator
wandern, um ausgemalt zu werden. Auch dies hängt mit
dem Umstand zusammen, daß die gedruckten Bücher mög-
lichst den geschriebenen und mit Miniaturen ausgeschmückten
Eodices gleichen sollten. „Nachdem der Holzschnitt Strich
für Strich die Hand des zeichnenden Künstlers wieder ge-
geben, sollte die Arbeit des Illuministen dem Bilde den
Charakter der kolorirten Federzeichnung verleihen."*) Der
Holzschnitt diente nur dazu, die Linien festzustellen, welche die
Illuministen und Miniatoren mit Farbe ausfüllten. Man
wandte daher Schraffirungen im Innern nie an, führte
Gewandung, Erdreich und dergl. oft im Schnitte nur sehr
ungenau aus, da dieses Alles erst durch die Farbe hinzu-
gefügt werden sollte. In der ältesten Zeit war diese Aus-
malung durch den Illuministen die Regel, nur selten wurden
die Bücher unausgemalt billiger verkauft, dainit sie der
Käufer selbst ausmalen laste. Geschah dieses nicht, so waren
sie dann unvollkommen; man findet namentlich an Stelle
der Initialen immer nur leere Räume. Erst gegen den
Schluß des Jahrhunderts suchten sich die Buchdrucker von
dieser Sitte zu befreien und druckten die Initialen selbst in
ihre Bücher. Gleichzeitig erkannte man, daß die Ausfüll-
ung mit Farbe auch die Feinheiten der Holzschnitte ver-
deckte, und kolorirte auch diese nicht mehr, so daß der
Illuminist zuletzt ganz überflüßig wurde.
Nachdem das Buch gedruckt und illuminirt war,
erhielt es seinen Einband, und man suchte durch verschiedene
Mittel dem Buchbinder seine Arbeit zu erleichtern. Dazu
gehört das manchmal zu Anfang, gewöhnlich aber am
Ende des Buches stehende Re§istrum cburtarum, ein Ver-
zeichniß der ersten Wörter der Bogen, wie inan es schon
s470 anwendete. Einen ähnlichen Zweck hatten die unten
auf der ersten Seite jedes Bogens stehenden Buchstaben,
») vrgl. G. tflrth in der Einleitung zu meiner „Geschichte der
Bücherillustration".
durch welche die Reihenfolge der Bogen angezeigt wurde,
die sogenannten Signaturen, sowie die auf jeder Seite
unter der letzten Zeile stehenden und oben auf der ersten
Zeile der folgenden Seite wiederholten Worte, die so-
genannten Eustoden — welche beide für den Buchbinder um
so näthiger waren, als die Seiten in diesen alten Büchern
gar nicht numerirt wurden. Der Einband selbst *) macht
den Eindruck größter Vornehmheit; er mußte hinzukommen,
um den alten Büchern ihr letztes Gepräge zu geben. Schon
im frühen Mittelalter wurden bekanntlich die kostbaren,
zumal die für den kirchlichen Gebrauch bestimmten Bücher
mit werthvollen Einbänden versehen. Die schön geschnitzten
Elfenbeinreliefs der alten Schreibtafeln wurden auf die
Deckel befestigt oder auch neue ganz silberne Reliefs gear-
beitet, die den Buchdeckel völlig überdeckten. Mit der Er-
findung der Buchdruckerkunst mußte sich das natürlich
ändern. Die im Verhältniß zu früher ungeheure Verviel-
fältigung von Schriften verlangte fast denselben Vorrath
von Bucheinbänden, wie von Büchern selbst; man konnte
deshalb so kostbares Material nicht mehr brauchen, sondern
mußte zu einfacheren Stoffen seine Zuflucht nehmen. Aber
auch hierbei strebte man die größte Gediegenheit an.
Die kostbarsten Einbände bekamen die großen Folio-
bücher. Der Hauptstoff, den man hierbei verwendete, war
das schon früher gebrauchte Leder. Entweder begnügte man
sich mit dem einfachen braunen Lederband oder man suchte
ihn durch Bilder reicher zu gestalten. Auf die mannigfachste
Weise wußte man die Lederflächen zu beleben und künstlerisch
auszuschmücken. Die älteren Verzierungen fiitö gewöhnlich
in das Leder eingeschnitten. Man zeichnete auf den dicken
Lederüberzug der Buchdeckel die Figuren und Ornamente
auf, schnitt die Umrisse der Zeichnung mit dem Messer
ein und schlug dann den Hintergrund, der etwas vertieft
erscheinen sollte, nieder. Die vertieften Striche wurden
gewöhnlich mit einem Farbton ausgesüllt; wandte man figür-
lichen Schmuck an, so erscheint der Grund hinter den Figuren
gewöhnlich punktirt. Erst in den späteren Jahrzehnten des
Jahrhunderts gab man es auf, die Zeichnungen mit
freier Hand einzuschneiden, sondern preßte Ornamente wie
bildliche Darstellungen mit Stempeln ein. Mit Vorliebe
stellte man in die Mitte der Decke eine größere figürliche
Prägung, die durch ein rings umgehendes Ornament
erweitert wurde. Damit das geschnittene oder gepreßte Leder
nicht durch Reiben verkratzt und beschädigt, an den Ecken
bestoßen würde, versah man die Ecken jeder Einbanddecke
mit vier Metallbeschlägen, aus denen starke Buckel vor-
standen, so daß der Lederband mit dem Tische nie in
Berührung kommen konnte. Dem gothischen Ornament-
charakter entsprechend, wurden diese Eckbeschläge meist durch-
brochen gearbeitet, so daß durch die Zwischenräume der
Lederüberzug sichtbar wurde. And damit das Buch, wenn
man es nicht brauchte, immer fest gepreßt war, verschloß
man es durch lederne oder metallene Spangen.
Solche prächtige Lederbände mit Metallverzierungen
konnte man natürlich nur für besonders große Bücher wie
Bibeln, Heiligenlegenden, Plenarien brauchen. Bei Auart-
*) lieber Büchereinbände sind hauptsächlich die Werke von
Bücher, Steche und Stockbauer zu vergleichen; eine kurze vortreffliche
Lharakteristik in der kleinen Schrift von Alwin Schultz. „Kunst und
Kunstgeschichte", Leipzig 188^.
in Holz. Freilich sind diese Maler, soweit wir verfolgen können,
nur selten große Künstler gewesen, haben durchaus nicht
immer selbständige Tompositionen geliefert, sondern sehr oft
sich damit begnügt, ihre Arbeiten nach Bildern oder Stichen
bedeutender Künstler zu kopiren. Bekannte Meister, deren
Thätigkeit uns bezeugt ist, sind nur Erhard Reuwich in
Mainz, der Illustrator von Breydenbach's Reise, und Albrecht
Dürers Lehrmeister Michel Wohlgemutst in Nürnberg,
welcher Schedel's Weltchronik illustrirte.
Außer den Illustrationen treten uns oft an: Schluffe
des Buches noch andere kleine Holzschnitte entgegen, die
Buchdruckerzeichen, die zwar erst im \6. Jahrhundert,
als sie von Künstlern wie Dürer, Holbein und Kranach
entworfen wurden, ihre höchste Vollendung erhielten, aber
doch schon im \5. wichtig sind. Eins der frühesten und
schönsten ist dasjenige des Augsburger Buchdruckers Günther
Zainer: ein wilder Mann, welcher einen Schild hält, in
dem sich ein fletschender heraldischer Löwe befindet. Sonstige
Holzschnitte finden sich in diesen alten Büchern wenig. Die
später zu so hoher Vollendung gekommenen Randleisten
und andere Ornamente spielen in dieser frühen Zeit in
Deutschland noch eine untergeordnete Rolle.
Nachdem nun das Buch sammt den Holzschnitten
gedruckt war, war es noch nicht vollendet; es mußte nach
dem Druck erst zu dem Illuminator und Rubrikator
wandern, um ausgemalt zu werden. Auch dies hängt mit
dem Umstand zusammen, daß die gedruckten Bücher mög-
lichst den geschriebenen und mit Miniaturen ausgeschmückten
Eodices gleichen sollten. „Nachdem der Holzschnitt Strich
für Strich die Hand des zeichnenden Künstlers wieder ge-
geben, sollte die Arbeit des Illuministen dem Bilde den
Charakter der kolorirten Federzeichnung verleihen."*) Der
Holzschnitt diente nur dazu, die Linien festzustellen, welche die
Illuministen und Miniatoren mit Farbe ausfüllten. Man
wandte daher Schraffirungen im Innern nie an, führte
Gewandung, Erdreich und dergl. oft im Schnitte nur sehr
ungenau aus, da dieses Alles erst durch die Farbe hinzu-
gefügt werden sollte. In der ältesten Zeit war diese Aus-
malung durch den Illuministen die Regel, nur selten wurden
die Bücher unausgemalt billiger verkauft, dainit sie der
Käufer selbst ausmalen laste. Geschah dieses nicht, so waren
sie dann unvollkommen; man findet namentlich an Stelle
der Initialen immer nur leere Räume. Erst gegen den
Schluß des Jahrhunderts suchten sich die Buchdrucker von
dieser Sitte zu befreien und druckten die Initialen selbst in
ihre Bücher. Gleichzeitig erkannte man, daß die Ausfüll-
ung mit Farbe auch die Feinheiten der Holzschnitte ver-
deckte, und kolorirte auch diese nicht mehr, so daß der
Illuminist zuletzt ganz überflüßig wurde.
Nachdem das Buch gedruckt und illuminirt war,
erhielt es seinen Einband, und man suchte durch verschiedene
Mittel dem Buchbinder seine Arbeit zu erleichtern. Dazu
gehört das manchmal zu Anfang, gewöhnlich aber am
Ende des Buches stehende Re§istrum cburtarum, ein Ver-
zeichniß der ersten Wörter der Bogen, wie inan es schon
s470 anwendete. Einen ähnlichen Zweck hatten die unten
auf der ersten Seite jedes Bogens stehenden Buchstaben,
») vrgl. G. tflrth in der Einleitung zu meiner „Geschichte der
Bücherillustration".
durch welche die Reihenfolge der Bogen angezeigt wurde,
die sogenannten Signaturen, sowie die auf jeder Seite
unter der letzten Zeile stehenden und oben auf der ersten
Zeile der folgenden Seite wiederholten Worte, die so-
genannten Eustoden — welche beide für den Buchbinder um
so näthiger waren, als die Seiten in diesen alten Büchern
gar nicht numerirt wurden. Der Einband selbst *) macht
den Eindruck größter Vornehmheit; er mußte hinzukommen,
um den alten Büchern ihr letztes Gepräge zu geben. Schon
im frühen Mittelalter wurden bekanntlich die kostbaren,
zumal die für den kirchlichen Gebrauch bestimmten Bücher
mit werthvollen Einbänden versehen. Die schön geschnitzten
Elfenbeinreliefs der alten Schreibtafeln wurden auf die
Deckel befestigt oder auch neue ganz silberne Reliefs gear-
beitet, die den Buchdeckel völlig überdeckten. Mit der Er-
findung der Buchdruckerkunst mußte sich das natürlich
ändern. Die im Verhältniß zu früher ungeheure Verviel-
fältigung von Schriften verlangte fast denselben Vorrath
von Bucheinbänden, wie von Büchern selbst; man konnte
deshalb so kostbares Material nicht mehr brauchen, sondern
mußte zu einfacheren Stoffen seine Zuflucht nehmen. Aber
auch hierbei strebte man die größte Gediegenheit an.
Die kostbarsten Einbände bekamen die großen Folio-
bücher. Der Hauptstoff, den man hierbei verwendete, war
das schon früher gebrauchte Leder. Entweder begnügte man
sich mit dem einfachen braunen Lederband oder man suchte
ihn durch Bilder reicher zu gestalten. Auf die mannigfachste
Weise wußte man die Lederflächen zu beleben und künstlerisch
auszuschmücken. Die älteren Verzierungen fiitö gewöhnlich
in das Leder eingeschnitten. Man zeichnete auf den dicken
Lederüberzug der Buchdeckel die Figuren und Ornamente
auf, schnitt die Umrisse der Zeichnung mit dem Messer
ein und schlug dann den Hintergrund, der etwas vertieft
erscheinen sollte, nieder. Die vertieften Striche wurden
gewöhnlich mit einem Farbton ausgesüllt; wandte man figür-
lichen Schmuck an, so erscheint der Grund hinter den Figuren
gewöhnlich punktirt. Erst in den späteren Jahrzehnten des
Jahrhunderts gab man es auf, die Zeichnungen mit
freier Hand einzuschneiden, sondern preßte Ornamente wie
bildliche Darstellungen mit Stempeln ein. Mit Vorliebe
stellte man in die Mitte der Decke eine größere figürliche
Prägung, die durch ein rings umgehendes Ornament
erweitert wurde. Damit das geschnittene oder gepreßte Leder
nicht durch Reiben verkratzt und beschädigt, an den Ecken
bestoßen würde, versah man die Ecken jeder Einbanddecke
mit vier Metallbeschlägen, aus denen starke Buckel vor-
standen, so daß der Lederband mit dem Tische nie in
Berührung kommen konnte. Dem gothischen Ornament-
charakter entsprechend, wurden diese Eckbeschläge meist durch-
brochen gearbeitet, so daß durch die Zwischenräume der
Lederüberzug sichtbar wurde. And damit das Buch, wenn
man es nicht brauchte, immer fest gepreßt war, verschloß
man es durch lederne oder metallene Spangen.
Solche prächtige Lederbände mit Metallverzierungen
konnte man natürlich nur für besonders große Bücher wie
Bibeln, Heiligenlegenden, Plenarien brauchen. Bei Auart-
*) lieber Büchereinbände sind hauptsächlich die Werke von
Bücher, Steche und Stockbauer zu vergleichen; eine kurze vortreffliche
Lharakteristik in der kleinen Schrift von Alwin Schultz. „Kunst und
Kunstgeschichte", Leipzig 188^.