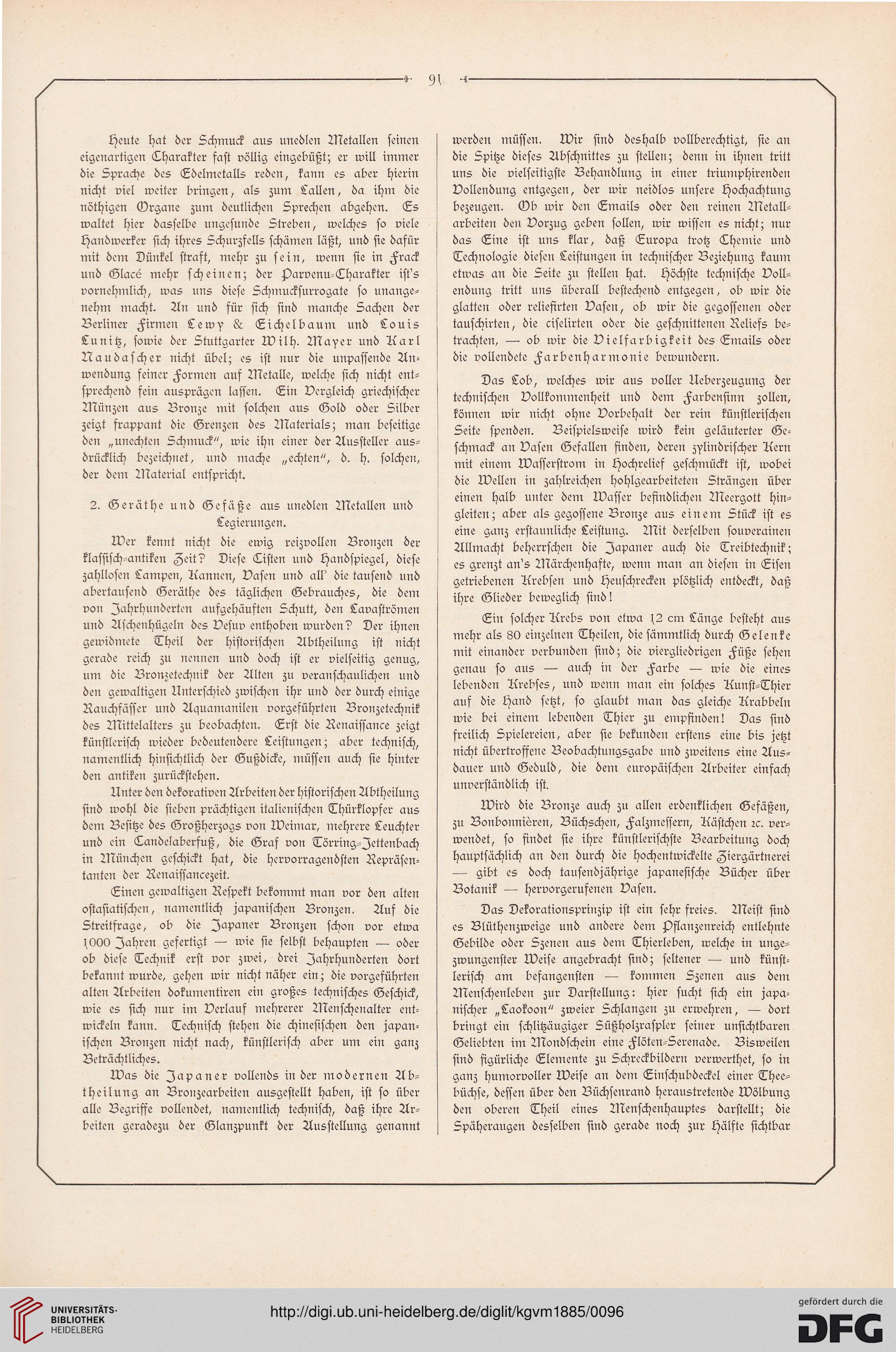Heute hat der Schmuck aus unedlen Metallen seinen
eigenartigen Charakter fast völlig eingebüßt; er will immer
die Sprache des Edelmetalls reden, kann es aber hierin
nicht viel weiter bringen, als zum Lallen, da ihm die
nöthigen Grgane zum deutlichen Sprechen abgehen. Es
waltet hier dasselbe ungesunde Streben, welches so viele
Handwerker sich ihres Schurzfells schämen läßt, und sie dafür
mit dem Dünkel straft, mehr zu sein, wenn sie in Frack
und Glace mehr scheinen; der jDarvenu-Charakter ist's
vornehmlich, was uns diese Schmucksurrogate so unange-
nehm nmcht. An und für sich sind manche Sachen der
Berliner Firmen Lewy & Eichelbaum und Louis
Lunitz, sowie der Stuttgarter Wilh. Mayer und Karl
Naudascher nicht übel; es ist nur die unpassende An-
wendung feiner Formen auf Metalle, welche sich nicht ent-
sprechend fein ausprägen lasten. Ein Vergleich griechischer
Münzen aus Bronze mit solchen aus Gold oder Silber
zeigt frappant die Grenzen des Materials; man beseitige
den „unechten Schmuck", wie ihn einer der Aussteller aus-
drücklich bezeichnet, und mache „echten", d. h. solchen,
der dem Material entspricht.
2. Geräthe und Gefäße aus unedlen Metallen und
Legierungen.
Mer kennt nicht die ewig reizvollen Bronzen der
klastisch-antiken Zeit? Diese Eisten und Handspiegel, diese
zahllosen Lampen, Kannen, Vasen und all' die tausend und
abertausend Geräthe des täglichen Gebrauches, die dem
von Jahrhunderten aufgehäuften Schutt, den Lavaströmen
und Aschenhügeln des Vesuv enthoben wurden? Der ihnen
gewidmete Theil der historischen Abtheilung ist nicht
gerade reich zu nennen und doch ist er vielseitig genug,
um die Bronzetechnik der Alten zu veranschaulichen und
den gewaltigen Unterschied zwischen ihr und der durch einige
Rauchfässer und Aquamanilen vorgeführten Bronzetechnik
des Mittelalters zu beobachten. Erst die Renaissance zeigt
künstlerisch wieder bedeutendere Leistungen; aber technisch,
namentlich hinsichtlich der Gußdicke, müssen auch sie hinter
den antiken zurückstehen.
Unter den dekorativen Arbeiten der historischen Abtheilung
sind wohl die sieben prächtigen italienischen Thürklopfer aus
dem Besitze des Großherzogs von Meimar, mehrere Leuchter
und ein Eandelaberfuß, die Graf von Törring-Zettenbach
in München geschickt hat, die hervorragendsten Repräsen-
tanten der Renaissancezeit.
Einen gewaltigen Respekt bekommt man vor den alten
ostasiatischen, namentlich japanischen Bronzen. Auf die
Streitfrage, ob die Japaner Bronzen schon vor etwa
sOOO Jahren gefertigt — wie sie selbst behaupten — oder
ob diese Technik erst vor zwei, drei Jahrhunderten dort
bekannt wurde, gehen wir nicht näher ein; die vorgesührten
alten Arbeiten dokumentiren ein großes technisches Geschick,
wie es sich nur iin Verlauf mehrerer Menschenalter ent-
wickeln kann. Technisch stehen die chinesischen den japan-
ischen Bronzen nicht nach, künstlerisch aber um ein ganz
Beträchtliches.
Mas die Zapaner vollends in der modernen Ab-
theilung an Bronzearbeiten ausgestellt haben, ist so über
alle Begriffe vollendet, namentlich technisch, daß ihre Ar-
beiten geradezu der Glanzpunkt der Ausstellung genannt
werden müssen. Mir sind deshalb vollberechtigt, sie an
die Spitze dieses Abschnittes zu stellen; denn in ihnen tritt
uns die vielseitigste Behandlung in einer triumphirenden
Vollendung entgegen, der wir neidlos unsere Hochachtung
bezeugen. Vb wir den Emails oder den reinen Metall-
arbeiten den Vorzug geben sollen, wir wissen es nicht; nur
das Eine ist uns klar, daß Europa trotz Ehemie und
Technologie diesen Leistungen in technischer Beziehung kaum
etwas an die Seite zu stellen hat. Höchste technische Voll-
endung tritt uns überall bestechend entgegen, ob wir die
glatten oder reliefirten Vasen, ob wir die gegossenen oder
tauschirten, die ciselirten oder die geschnittenen Reliefs be-
trachten, — ob wir die Vielfarbigkeit des Emails oder
die vollendete Farbenharmonie bewundern.
Das Lob, welches wir aus voller Reberzeugung der
technischen Vollkommenheit und dem Farbensinn zollen,
können wir nicht ohne Vorbehalt der rein künstlerischen
Seite spenden. Beispielsweise wird kein geläuterter Ge-
schmack an Vasen Gefallen finden, deren zylindrischer Kern
mit einem Masserstrom in Hochrelief geschmückt ist, wobei
die Wellen in zahlreichen hohlgearbeiteten Strängen über
einen halb unter dem Master befindlichen Meergott hin-
gleiten; aber als gegossene Bronze aus einem Stück ist es
eine ganz erstaunliche Leistung. Mit derselben souverainen
Allmacht beherrschen die Japaner auch die Treibtechnik;
es grenzt an's Märchenhafte, wenn man an diesen in Eisen
getriebenen Krebsen und Heuschrecken plötzlich entdeckt, daß
ihre Glieder beweglich sind!
Ein solcher Krebs von etwa \2 cm Länge besteht aus
mehr als 80 einzelnen Theilen, dis fämmtlich durch Gelenke
mit einander verbunden sind; die viergliedrigen Füße sehen
genau so aus — auch in der Farbe — wie die eines
lebenden Krebses, und wenn man ein solches Kunst-Thier
auf die Hand setzt, so glaubt man das gleiche Krabbeln
wie bei einem lebenden Thier zu empfinden! Das find
freilich Spielereien, aber sie bekunden erstens eine bis jetzt
nicht übertroffene Beobachtungsgabe und zweitens eine Aus-
dauer und Geduld, die dem europäischen Arbeiter einfach
unverständlich ist.
Wird die Bronze auch zu allen erdenklichen Gefäßen,
zu Bonbonnieren, Büchschen, Falzmeffern, Kästchen rc. ver-
wendet, so findet sie ihre künstlerischste Bearbeitung doch
hauptsächlich an den durch die hochentwickelte Ziergärtnerei
— gibt es doch tausendjährige japanesische Bücher über
Botanik — hervorgerufenen Vasen.
Das Dekorationsprinzip ist ein sehr freies. Meist sind
es Blüthenzweige und andere dem Pflanzenreich entlehnte
Gebilde oder Szenen aus dem Thierleben, welche in unge-
zwungenster Meise angebracht sind; seltener — und künst-
lerisch am befangensten — kommen Szenen aus dem
Menschenleben zur Darstellung: hier sucht sich ein japa-
nischer „Laokoon" zweier Schlangen zu erwehren, —• dort
bringt ein schlitzäugiger Süßholzraspler seiner unsichtbaren
Geliebten im Mondschein eine Flöten-Serenade. Bisweilen
find figürliche Elemente zu Schreckbildern verwerthet, so in
ganz humorvoller Meise an dem Einschubdeckel einer Thee-
büchse, dessen über den Büchsenrand heraustretende Wölbung
den oberen Theil eines Menschenhauptes darstellt; die
Späheraugen desselben sind gerade noch zur Hälfte sichtbar
eigenartigen Charakter fast völlig eingebüßt; er will immer
die Sprache des Edelmetalls reden, kann es aber hierin
nicht viel weiter bringen, als zum Lallen, da ihm die
nöthigen Grgane zum deutlichen Sprechen abgehen. Es
waltet hier dasselbe ungesunde Streben, welches so viele
Handwerker sich ihres Schurzfells schämen läßt, und sie dafür
mit dem Dünkel straft, mehr zu sein, wenn sie in Frack
und Glace mehr scheinen; der jDarvenu-Charakter ist's
vornehmlich, was uns diese Schmucksurrogate so unange-
nehm nmcht. An und für sich sind manche Sachen der
Berliner Firmen Lewy & Eichelbaum und Louis
Lunitz, sowie der Stuttgarter Wilh. Mayer und Karl
Naudascher nicht übel; es ist nur die unpassende An-
wendung feiner Formen auf Metalle, welche sich nicht ent-
sprechend fein ausprägen lasten. Ein Vergleich griechischer
Münzen aus Bronze mit solchen aus Gold oder Silber
zeigt frappant die Grenzen des Materials; man beseitige
den „unechten Schmuck", wie ihn einer der Aussteller aus-
drücklich bezeichnet, und mache „echten", d. h. solchen,
der dem Material entspricht.
2. Geräthe und Gefäße aus unedlen Metallen und
Legierungen.
Mer kennt nicht die ewig reizvollen Bronzen der
klastisch-antiken Zeit? Diese Eisten und Handspiegel, diese
zahllosen Lampen, Kannen, Vasen und all' die tausend und
abertausend Geräthe des täglichen Gebrauches, die dem
von Jahrhunderten aufgehäuften Schutt, den Lavaströmen
und Aschenhügeln des Vesuv enthoben wurden? Der ihnen
gewidmete Theil der historischen Abtheilung ist nicht
gerade reich zu nennen und doch ist er vielseitig genug,
um die Bronzetechnik der Alten zu veranschaulichen und
den gewaltigen Unterschied zwischen ihr und der durch einige
Rauchfässer und Aquamanilen vorgeführten Bronzetechnik
des Mittelalters zu beobachten. Erst die Renaissance zeigt
künstlerisch wieder bedeutendere Leistungen; aber technisch,
namentlich hinsichtlich der Gußdicke, müssen auch sie hinter
den antiken zurückstehen.
Unter den dekorativen Arbeiten der historischen Abtheilung
sind wohl die sieben prächtigen italienischen Thürklopfer aus
dem Besitze des Großherzogs von Meimar, mehrere Leuchter
und ein Eandelaberfuß, die Graf von Törring-Zettenbach
in München geschickt hat, die hervorragendsten Repräsen-
tanten der Renaissancezeit.
Einen gewaltigen Respekt bekommt man vor den alten
ostasiatischen, namentlich japanischen Bronzen. Auf die
Streitfrage, ob die Japaner Bronzen schon vor etwa
sOOO Jahren gefertigt — wie sie selbst behaupten — oder
ob diese Technik erst vor zwei, drei Jahrhunderten dort
bekannt wurde, gehen wir nicht näher ein; die vorgesührten
alten Arbeiten dokumentiren ein großes technisches Geschick,
wie es sich nur iin Verlauf mehrerer Menschenalter ent-
wickeln kann. Technisch stehen die chinesischen den japan-
ischen Bronzen nicht nach, künstlerisch aber um ein ganz
Beträchtliches.
Mas die Zapaner vollends in der modernen Ab-
theilung an Bronzearbeiten ausgestellt haben, ist so über
alle Begriffe vollendet, namentlich technisch, daß ihre Ar-
beiten geradezu der Glanzpunkt der Ausstellung genannt
werden müssen. Mir sind deshalb vollberechtigt, sie an
die Spitze dieses Abschnittes zu stellen; denn in ihnen tritt
uns die vielseitigste Behandlung in einer triumphirenden
Vollendung entgegen, der wir neidlos unsere Hochachtung
bezeugen. Vb wir den Emails oder den reinen Metall-
arbeiten den Vorzug geben sollen, wir wissen es nicht; nur
das Eine ist uns klar, daß Europa trotz Ehemie und
Technologie diesen Leistungen in technischer Beziehung kaum
etwas an die Seite zu stellen hat. Höchste technische Voll-
endung tritt uns überall bestechend entgegen, ob wir die
glatten oder reliefirten Vasen, ob wir die gegossenen oder
tauschirten, die ciselirten oder die geschnittenen Reliefs be-
trachten, — ob wir die Vielfarbigkeit des Emails oder
die vollendete Farbenharmonie bewundern.
Das Lob, welches wir aus voller Reberzeugung der
technischen Vollkommenheit und dem Farbensinn zollen,
können wir nicht ohne Vorbehalt der rein künstlerischen
Seite spenden. Beispielsweise wird kein geläuterter Ge-
schmack an Vasen Gefallen finden, deren zylindrischer Kern
mit einem Masserstrom in Hochrelief geschmückt ist, wobei
die Wellen in zahlreichen hohlgearbeiteten Strängen über
einen halb unter dem Master befindlichen Meergott hin-
gleiten; aber als gegossene Bronze aus einem Stück ist es
eine ganz erstaunliche Leistung. Mit derselben souverainen
Allmacht beherrschen die Japaner auch die Treibtechnik;
es grenzt an's Märchenhafte, wenn man an diesen in Eisen
getriebenen Krebsen und Heuschrecken plötzlich entdeckt, daß
ihre Glieder beweglich sind!
Ein solcher Krebs von etwa \2 cm Länge besteht aus
mehr als 80 einzelnen Theilen, dis fämmtlich durch Gelenke
mit einander verbunden sind; die viergliedrigen Füße sehen
genau so aus — auch in der Farbe — wie die eines
lebenden Krebses, und wenn man ein solches Kunst-Thier
auf die Hand setzt, so glaubt man das gleiche Krabbeln
wie bei einem lebenden Thier zu empfinden! Das find
freilich Spielereien, aber sie bekunden erstens eine bis jetzt
nicht übertroffene Beobachtungsgabe und zweitens eine Aus-
dauer und Geduld, die dem europäischen Arbeiter einfach
unverständlich ist.
Wird die Bronze auch zu allen erdenklichen Gefäßen,
zu Bonbonnieren, Büchschen, Falzmeffern, Kästchen rc. ver-
wendet, so findet sie ihre künstlerischste Bearbeitung doch
hauptsächlich an den durch die hochentwickelte Ziergärtnerei
— gibt es doch tausendjährige japanesische Bücher über
Botanik — hervorgerufenen Vasen.
Das Dekorationsprinzip ist ein sehr freies. Meist sind
es Blüthenzweige und andere dem Pflanzenreich entlehnte
Gebilde oder Szenen aus dem Thierleben, welche in unge-
zwungenster Meise angebracht sind; seltener — und künst-
lerisch am befangensten — kommen Szenen aus dem
Menschenleben zur Darstellung: hier sucht sich ein japa-
nischer „Laokoon" zweier Schlangen zu erwehren, —• dort
bringt ein schlitzäugiger Süßholzraspler seiner unsichtbaren
Geliebten im Mondschein eine Flöten-Serenade. Bisweilen
find figürliche Elemente zu Schreckbildern verwerthet, so in
ganz humorvoller Meise an dem Einschubdeckel einer Thee-
büchse, dessen über den Büchsenrand heraustretende Wölbung
den oberen Theil eines Menschenhauptes darstellt; die
Späheraugen desselben sind gerade noch zur Hälfte sichtbar