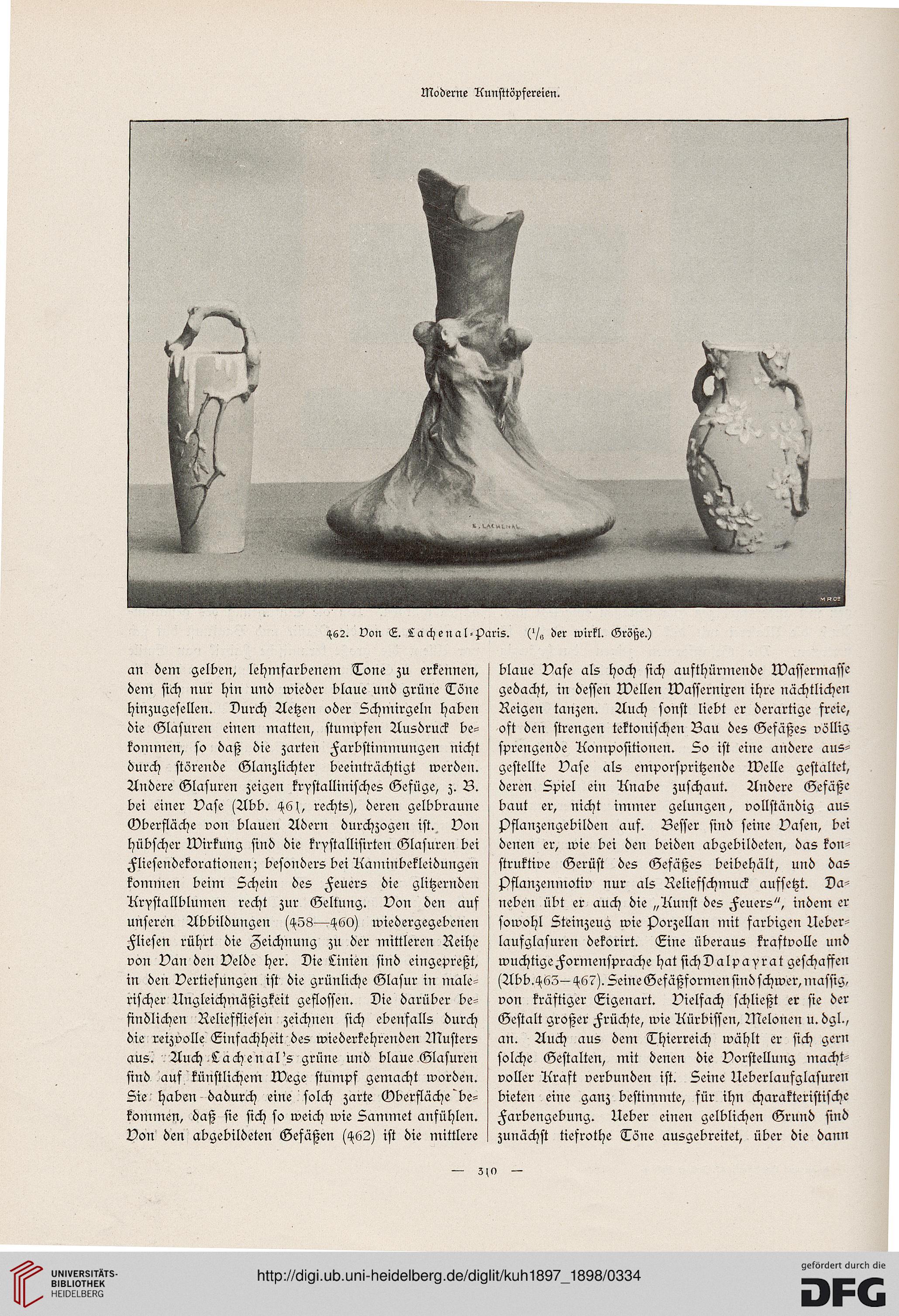Moderne Kunsttöpfereien.
HS2. Oon L. La chenal-Paris. (hg der wirkl. Größe.)
an dein gelben, lehnrfarbenein Tone zu erkennen,
dein sich nur hin und wieder blaue und grüiie Töne
hinzugesellen. Durch Aetzen oder Schmirgeln haben
die Glasuren einen matten, stumpfen Ausdruck be-
kommen, so daß die zarten Farbstimmungen nicht
durch störende Glanzlichter beeinträchtigt werdeii.
Andere Glasuren zeigen kristallinisches Gefüge, z. B.
bei eiuet* Vase (Abb. 46(, rechts), deren gelbbraune
Oberfläche voii blauen Adern durchzogen ist. Von
hübscher Wirkung sind die krpstallisirten Glasuren bei
Fliesendekorationen; besonders bei Aaininbekleidungen
kommen beim Schein des Feuers die glitzernden
Arystallblumen recht zur Geltung. Von den auf
unseren Abbildungen sq.58—-4.6O) wiedergegebenen
Fliesen rührt die Zeichnung zu der mittleren Reihe
von Van den Velde her. Die Linien sind eingepreßt,
in det> Vertiefungen ist die grünliche Glasur in male-
rischer Angleichmäßigkeit geflossen. Die darüber be-
findlichen Reliesflicseit zeichnen sich ebenfalls durch
die reizvolle Einfachheit des wiederkehrenden Musters
ausi Auch Lachenal's grüne und blaue Glasuren
sind auf künstlichem Wege stumpf gemacht worden.
Sie haben dadurch eine solch zarte Oberfläche'be-
kommen, daß sie sich so weich wie Sammet anfühlen.
Von den abgebildeten Gefäßen (4.62) ist die mittlere
blaue Vase als hoch sich aufthürmende Wasfermaffe
gedacht, in dessen Wellen Wassernixen ihre nächtlichen
Reigen tanzen. Auch sonst liebt er derartige freie,
oft den strengen tektonischen Bau des Gefäßes völlig
sprengende Kompositionen. So ist eine andere aus-
gestellte Vase als emporspritzende Welle gestaltet,
deren Spiel ein Anabe zuschaut. Andere Gefäße
baut er, nicht immer gelungen, vollständig aus
pflanzengebilüen auf. Besser sind seine Vasen, bei
denen er, wie bei den beiden abgebildeten, das kon-
struktive Gerüst des Gefäßes beibehält, und das
Pflanzenmotiv nur als Reliefschmuck aufsetzt. Da-
neben übt er auch die „Runst des Feuers", indem er
sowohl Steinzeug wie Porzellan mit farbigen Aeber-
laufglasuren dekorirt. Eine überaus kraftvolle und
wuchtige Formensprache hat sichD alpayrat geschaffen
(Abb.4.63—467). Seine Gefäßformen sind schwer, massig,
von kräftiger Eigenart. Vielfach schließt er sie der
Gestalt großer Früchte, wie Aürbissen, Melonen u. dgl.,
an. Auch aus den: Thierreich wählt er sich gern
solche Gestalten, mit denen die Vorstellung macht-
voller Ara ft verbunden ist. Seine Ueberlaufglasuren
bieten eine ganz bestimmte, für ihn charakteristische
Farbengebung. Aeber einen gelblichen Grund sind
zunächst tiefrothe Töne ausgebreitet, über die dann
5\0
HS2. Oon L. La chenal-Paris. (hg der wirkl. Größe.)
an dein gelben, lehnrfarbenein Tone zu erkennen,
dein sich nur hin und wieder blaue und grüiie Töne
hinzugesellen. Durch Aetzen oder Schmirgeln haben
die Glasuren einen matten, stumpfen Ausdruck be-
kommen, so daß die zarten Farbstimmungen nicht
durch störende Glanzlichter beeinträchtigt werdeii.
Andere Glasuren zeigen kristallinisches Gefüge, z. B.
bei eiuet* Vase (Abb. 46(, rechts), deren gelbbraune
Oberfläche voii blauen Adern durchzogen ist. Von
hübscher Wirkung sind die krpstallisirten Glasuren bei
Fliesendekorationen; besonders bei Aaininbekleidungen
kommen beim Schein des Feuers die glitzernden
Arystallblumen recht zur Geltung. Von den auf
unseren Abbildungen sq.58—-4.6O) wiedergegebenen
Fliesen rührt die Zeichnung zu der mittleren Reihe
von Van den Velde her. Die Linien sind eingepreßt,
in det> Vertiefungen ist die grünliche Glasur in male-
rischer Angleichmäßigkeit geflossen. Die darüber be-
findlichen Reliesflicseit zeichnen sich ebenfalls durch
die reizvolle Einfachheit des wiederkehrenden Musters
ausi Auch Lachenal's grüne und blaue Glasuren
sind auf künstlichem Wege stumpf gemacht worden.
Sie haben dadurch eine solch zarte Oberfläche'be-
kommen, daß sie sich so weich wie Sammet anfühlen.
Von den abgebildeten Gefäßen (4.62) ist die mittlere
blaue Vase als hoch sich aufthürmende Wasfermaffe
gedacht, in dessen Wellen Wassernixen ihre nächtlichen
Reigen tanzen. Auch sonst liebt er derartige freie,
oft den strengen tektonischen Bau des Gefäßes völlig
sprengende Kompositionen. So ist eine andere aus-
gestellte Vase als emporspritzende Welle gestaltet,
deren Spiel ein Anabe zuschaut. Andere Gefäße
baut er, nicht immer gelungen, vollständig aus
pflanzengebilüen auf. Besser sind seine Vasen, bei
denen er, wie bei den beiden abgebildeten, das kon-
struktive Gerüst des Gefäßes beibehält, und das
Pflanzenmotiv nur als Reliefschmuck aufsetzt. Da-
neben übt er auch die „Runst des Feuers", indem er
sowohl Steinzeug wie Porzellan mit farbigen Aeber-
laufglasuren dekorirt. Eine überaus kraftvolle und
wuchtige Formensprache hat sichD alpayrat geschaffen
(Abb.4.63—467). Seine Gefäßformen sind schwer, massig,
von kräftiger Eigenart. Vielfach schließt er sie der
Gestalt großer Früchte, wie Aürbissen, Melonen u. dgl.,
an. Auch aus den: Thierreich wählt er sich gern
solche Gestalten, mit denen die Vorstellung macht-
voller Ara ft verbunden ist. Seine Ueberlaufglasuren
bieten eine ganz bestimmte, für ihn charakteristische
Farbengebung. Aeber einen gelblichen Grund sind
zunächst tiefrothe Töne ausgebreitet, über die dann
5\0