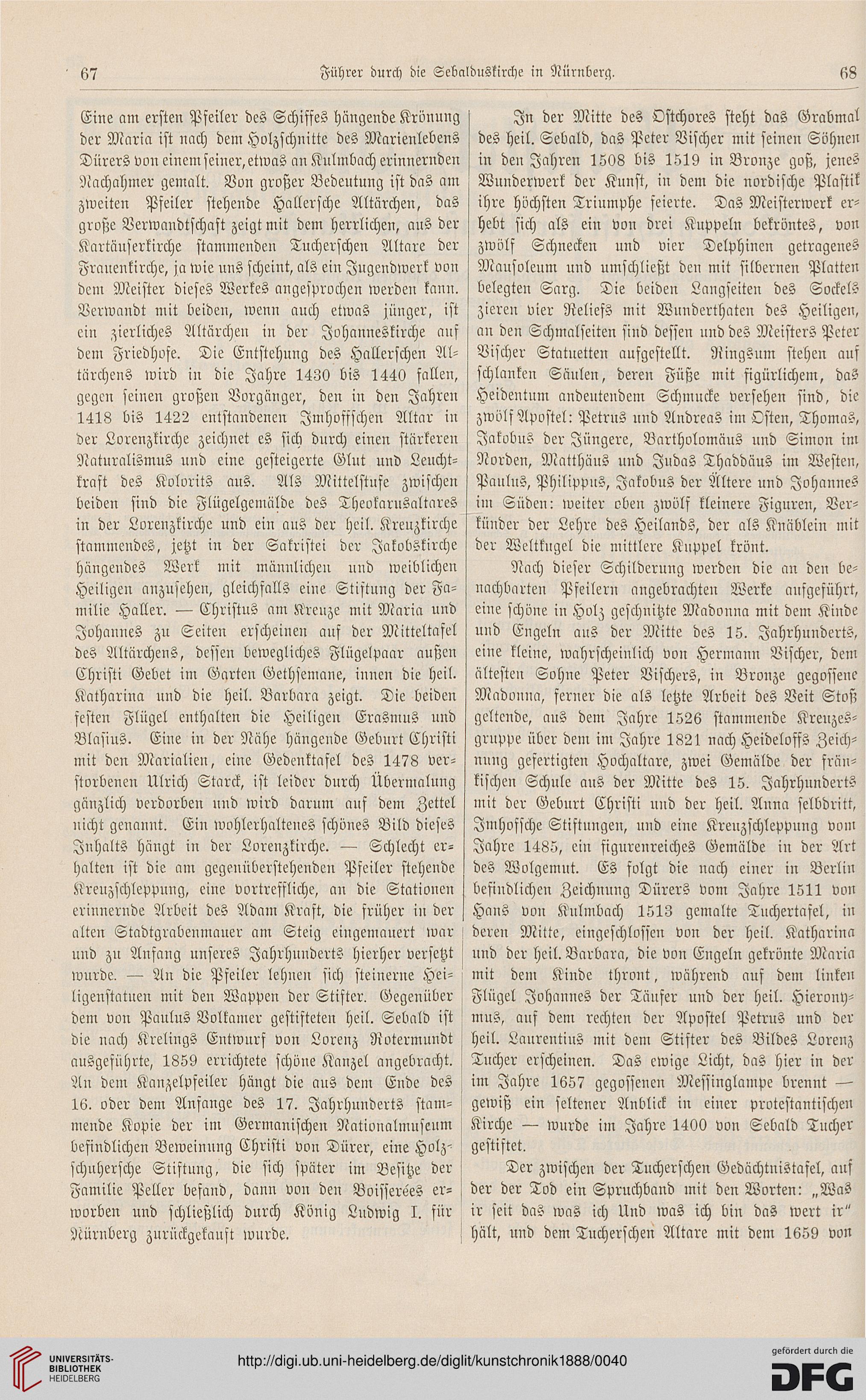67
Führer durch die Sebalduskirche in Nürnberg.
68
Eine am ersten Pfeiler des Schiffes hängende Krönnng
der Maria ist nach dem Holzschnitte des Marienlebens
Dürers von einemseiner,etwas an Kulmbach erinnernden
Nachahmer gemalü Von großer Bedeutung ist das am
zweiten Pfeiler stehende Hallersche Altärchen, das
große Verwandtschaft zeigt mit dem herrlichen, aus der
Kartäuserkirche stannnenden Tucherschen Altare der
Franenkirche, ja wie uns scheint, als ein Jugendwerk von
dem Meister dieses Werkes angesprochen werden kamn
Verwandt mit beiden, wenn auch etwas jünger, ist
ein zierliches Altärchen in der Johanneskirche anf
dem Friedhofe. Die Entstehung des Hnllerschen Al-
türchens wird in die Jahre 1430 bis 1440 fallen,
gegen seinen großen Vorgänger, den in den Jahren
1418 bis 1422 entstandenen Jmhoffschen Altar in
Ler Lorenzkirche zeichnet es sich durch einen stürkeren
Naturalismus nnd eine gesteigerte Glnt und Lencht-
kraft des Kolorits aus. Als Mittelstufe zwischen
beiden sind die Flügelgemälde des Theokarusaltares
in der Lorenzkirche und ein aus der hcil. Ldreuzkirche
stammendes, jetzt in der Sakristei der Jakobskirche
hängendes Werk mit männlichen und weiblichen
Heiligen anzusehen, gleichfalls eine Stistung der Fa-
milie Haller. — Christus am Krenze mit Mnria nnd
Johaunes zu Seiten erscheinen auf der Mitteltafel
des Altärchens, dessen bewegliches Flügelpaar außcn
Christi Gebet im Garten Gethsemane, innen die heil.
Katharina nnd die heil. Barbara zeigt. Die beiden
festen Flügel enthalten die Heiligen Erasmus und
Blasius. Eine in der Nähe hängende Gebnrt Christi
mit den Marialien, eine Gedenktafel des 1478 ver-
storbenen Ulrich Starck, ist leidcr dnrch Übermalung
gänzlich verdorben nnd wird darum anf dem Zettel
nicht genannt. Ein wohlerhaltenes schönes Bild dieses
Jnhalts hängt in der Lorenzkirche. — Schlecht er-
halten ist die am gegenüberstehenden Pfeiler stehende
Kreuzschleppung, eine vortreffliche, an die Stationen
erinnernde Arbeit des Adam Kraft, die früher in der
alten Stadtgrabenmauer am Steig eingemanert war j
und zn Anfang unseres Jahrhunderts hierher versetzt
wurde. — An die Pfeiler lehnen sich steinerne Hei-
ligenstatnen mit den Wappen der Stifter. Gegenüber
dem von Paulus Volkamer gestifteten heil. Sebald ist
die nach Krelings Entwurf von Lorenz Rotermundt
ausgeführte, 1859 errichtete schöne Kanzel angebracht.
An dem Kanzelpfeiler hängt die aus dem Ende des
16. oder dem Anfange des 17. Jahrhunderts stam-
mende Kopie der im Germanischen Nationalmuscnm
befindlichen Beweinung Christi von Dürer, eine Holz-
schuhersche Stiftung, die sich später im Besitze der
Familie Peller befand, dann von den Boisserees er-
worben und schließlich durch König Ludwig I. für
Nürnberg zurückgekauft wnrde.
Jn der Mitte des Ostchores steht das Grabmal
des heil. Sebald, das Peter Vischer mit seinen Söhnen
in deu Jahren 1508 bis 1519 in Bronze goß, jenes
Wunderwerk der Kunst, in dem die nordische Plastik
ihre höchsten Triumphe feierte. Das Meisterwerk er-
hebt sich als ein von drei Kuppeln bekröntes, von
zwölf Schnecken und vier Delphinen getragenes
Mausoleum und umschließt den mit silbernen Platten
belegten Sarg. Die beiden Langseiten des Sockels
zieren vier Reliefs mit Wunderthaten des Heiligen,
an den Schmalseiten sind dessen und des Meisters Peter
Vischer Statuetten aufgestellt. Ringsnm stehen auf
schlanken Säulen, deren Füße mit figürlichem, das
Heidentnm andentendem Schmncke versehen sind, die
zwölf Apostel: Petrns und Andreas im Osten, Thomas,
Jakobus der Jüngere, Bartholomäus und Simon ini
Norden, Matthäus und Judas Thaddäus im Westen,
Panlns, Philippus, Jakobus der Ältere und Johannes
im Süden: weiter oben zwölf kleinere Figuren, Ver-
künder der Lehre des Heilands, der als Knäblein mit
der Weltkngel die mittlere Knppel krönt.
Nach dieser Schilderung werden die an den be-
nachbarten Pfeilern angebrachten Werke ansgeführt,
eine schöne in Holz geschnitzte Madonna mit dem Kinde
und Engeln aus der Mitte des 15. Jahrhnnderts,
eine kleine, wahrscheinlich von Hermann Vischer, dem
ältesten Sohne Peter Vischers, in Bronze gegossene
Madonna, ferner die als lctzte Arbeit des Veit Stoß
geltcnde, aus dem Jahre 1526 stammende Kreuzes-
grnppe über dem im Jahre 1821 nach Heideloffs Zeich-
nung gefertigten Hochaltare, zwei Gemälde der frän-
kischen Schnle aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
mit der Gebnrt Christi nnd der heil. Anna selbdritt,
Jmhofsche Stiftnngen, nnd eine Krenzschleppnng Vvm
Jahre 1485, ein fignrenreiches Gemälde in der Art
des Wolgemnt. Es folgt die nach einer in Berlin
befindlichen Zeichnung Dürers voni Jahre 1511 von
Hans vvn Knlmbach 1513 gemalte Tnchertafel, in
deren Mitte, eingeschlossen von der heil. Katharina
und der heil. Barbara, die von Engeln gekrönte Maria
mit dem Kinde thront, während auf dem linken
Flügel Johannes der Tänfer und der heil. Hierony-
mus, anf dem rechten der Apostel Petrus und der
heil. Laurentins mit dem Stifter des Bildes Lorenz
Tncher erscheinen. Das ewige Licht, das hier in der
im Jahre 1657 gegossenen Messinglampe brennt —
gewiß ein seltener Anblick in einer protestantischen
Kirche — wurde im Jahre 1400 von Sebald Tucher
gestiftet.
Der zwischen der Tucherschen Gedächtnistafel, auf
der der Tod ein Spruchband mit den Worten: „Was
ir seit das was ich llnd was ich bin das wert ir"
hält, und dem Tucherschen Altare mit dem 1659 von
Führer durch die Sebalduskirche in Nürnberg.
68
Eine am ersten Pfeiler des Schiffes hängende Krönnng
der Maria ist nach dem Holzschnitte des Marienlebens
Dürers von einemseiner,etwas an Kulmbach erinnernden
Nachahmer gemalü Von großer Bedeutung ist das am
zweiten Pfeiler stehende Hallersche Altärchen, das
große Verwandtschaft zeigt mit dem herrlichen, aus der
Kartäuserkirche stannnenden Tucherschen Altare der
Franenkirche, ja wie uns scheint, als ein Jugendwerk von
dem Meister dieses Werkes angesprochen werden kamn
Verwandt mit beiden, wenn auch etwas jünger, ist
ein zierliches Altärchen in der Johanneskirche anf
dem Friedhofe. Die Entstehung des Hnllerschen Al-
türchens wird in die Jahre 1430 bis 1440 fallen,
gegen seinen großen Vorgänger, den in den Jahren
1418 bis 1422 entstandenen Jmhoffschen Altar in
Ler Lorenzkirche zeichnet es sich durch einen stürkeren
Naturalismus nnd eine gesteigerte Glnt und Lencht-
kraft des Kolorits aus. Als Mittelstufe zwischen
beiden sind die Flügelgemälde des Theokarusaltares
in der Lorenzkirche und ein aus der hcil. Ldreuzkirche
stammendes, jetzt in der Sakristei der Jakobskirche
hängendes Werk mit männlichen und weiblichen
Heiligen anzusehen, gleichfalls eine Stistung der Fa-
milie Haller. — Christus am Krenze mit Mnria nnd
Johaunes zu Seiten erscheinen auf der Mitteltafel
des Altärchens, dessen bewegliches Flügelpaar außcn
Christi Gebet im Garten Gethsemane, innen die heil.
Katharina nnd die heil. Barbara zeigt. Die beiden
festen Flügel enthalten die Heiligen Erasmus und
Blasius. Eine in der Nähe hängende Gebnrt Christi
mit den Marialien, eine Gedenktafel des 1478 ver-
storbenen Ulrich Starck, ist leidcr dnrch Übermalung
gänzlich verdorben nnd wird darum anf dem Zettel
nicht genannt. Ein wohlerhaltenes schönes Bild dieses
Jnhalts hängt in der Lorenzkirche. — Schlecht er-
halten ist die am gegenüberstehenden Pfeiler stehende
Kreuzschleppung, eine vortreffliche, an die Stationen
erinnernde Arbeit des Adam Kraft, die früher in der
alten Stadtgrabenmauer am Steig eingemanert war j
und zn Anfang unseres Jahrhunderts hierher versetzt
wurde. — An die Pfeiler lehnen sich steinerne Hei-
ligenstatnen mit den Wappen der Stifter. Gegenüber
dem von Paulus Volkamer gestifteten heil. Sebald ist
die nach Krelings Entwurf von Lorenz Rotermundt
ausgeführte, 1859 errichtete schöne Kanzel angebracht.
An dem Kanzelpfeiler hängt die aus dem Ende des
16. oder dem Anfange des 17. Jahrhunderts stam-
mende Kopie der im Germanischen Nationalmuscnm
befindlichen Beweinung Christi von Dürer, eine Holz-
schuhersche Stiftung, die sich später im Besitze der
Familie Peller befand, dann von den Boisserees er-
worben und schließlich durch König Ludwig I. für
Nürnberg zurückgekauft wnrde.
Jn der Mitte des Ostchores steht das Grabmal
des heil. Sebald, das Peter Vischer mit seinen Söhnen
in deu Jahren 1508 bis 1519 in Bronze goß, jenes
Wunderwerk der Kunst, in dem die nordische Plastik
ihre höchsten Triumphe feierte. Das Meisterwerk er-
hebt sich als ein von drei Kuppeln bekröntes, von
zwölf Schnecken und vier Delphinen getragenes
Mausoleum und umschließt den mit silbernen Platten
belegten Sarg. Die beiden Langseiten des Sockels
zieren vier Reliefs mit Wunderthaten des Heiligen,
an den Schmalseiten sind dessen und des Meisters Peter
Vischer Statuetten aufgestellt. Ringsnm stehen auf
schlanken Säulen, deren Füße mit figürlichem, das
Heidentnm andentendem Schmncke versehen sind, die
zwölf Apostel: Petrns und Andreas im Osten, Thomas,
Jakobus der Jüngere, Bartholomäus und Simon ini
Norden, Matthäus und Judas Thaddäus im Westen,
Panlns, Philippus, Jakobus der Ältere und Johannes
im Süden: weiter oben zwölf kleinere Figuren, Ver-
künder der Lehre des Heilands, der als Knäblein mit
der Weltkngel die mittlere Knppel krönt.
Nach dieser Schilderung werden die an den be-
nachbarten Pfeilern angebrachten Werke ansgeführt,
eine schöne in Holz geschnitzte Madonna mit dem Kinde
und Engeln aus der Mitte des 15. Jahrhnnderts,
eine kleine, wahrscheinlich von Hermann Vischer, dem
ältesten Sohne Peter Vischers, in Bronze gegossene
Madonna, ferner die als lctzte Arbeit des Veit Stoß
geltcnde, aus dem Jahre 1526 stammende Kreuzes-
grnppe über dem im Jahre 1821 nach Heideloffs Zeich-
nung gefertigten Hochaltare, zwei Gemälde der frän-
kischen Schnle aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
mit der Gebnrt Christi nnd der heil. Anna selbdritt,
Jmhofsche Stiftnngen, nnd eine Krenzschleppnng Vvm
Jahre 1485, ein fignrenreiches Gemälde in der Art
des Wolgemnt. Es folgt die nach einer in Berlin
befindlichen Zeichnung Dürers voni Jahre 1511 von
Hans vvn Knlmbach 1513 gemalte Tnchertafel, in
deren Mitte, eingeschlossen von der heil. Katharina
und der heil. Barbara, die von Engeln gekrönte Maria
mit dem Kinde thront, während auf dem linken
Flügel Johannes der Tänfer und der heil. Hierony-
mus, anf dem rechten der Apostel Petrus und der
heil. Laurentins mit dem Stifter des Bildes Lorenz
Tncher erscheinen. Das ewige Licht, das hier in der
im Jahre 1657 gegossenen Messinglampe brennt —
gewiß ein seltener Anblick in einer protestantischen
Kirche — wurde im Jahre 1400 von Sebald Tucher
gestiftet.
Der zwischen der Tucherschen Gedächtnistafel, auf
der der Tod ein Spruchband mit den Worten: „Was
ir seit das was ich llnd was ich bin das wert ir"
hält, und dem Tucherschen Altare mit dem 1659 von