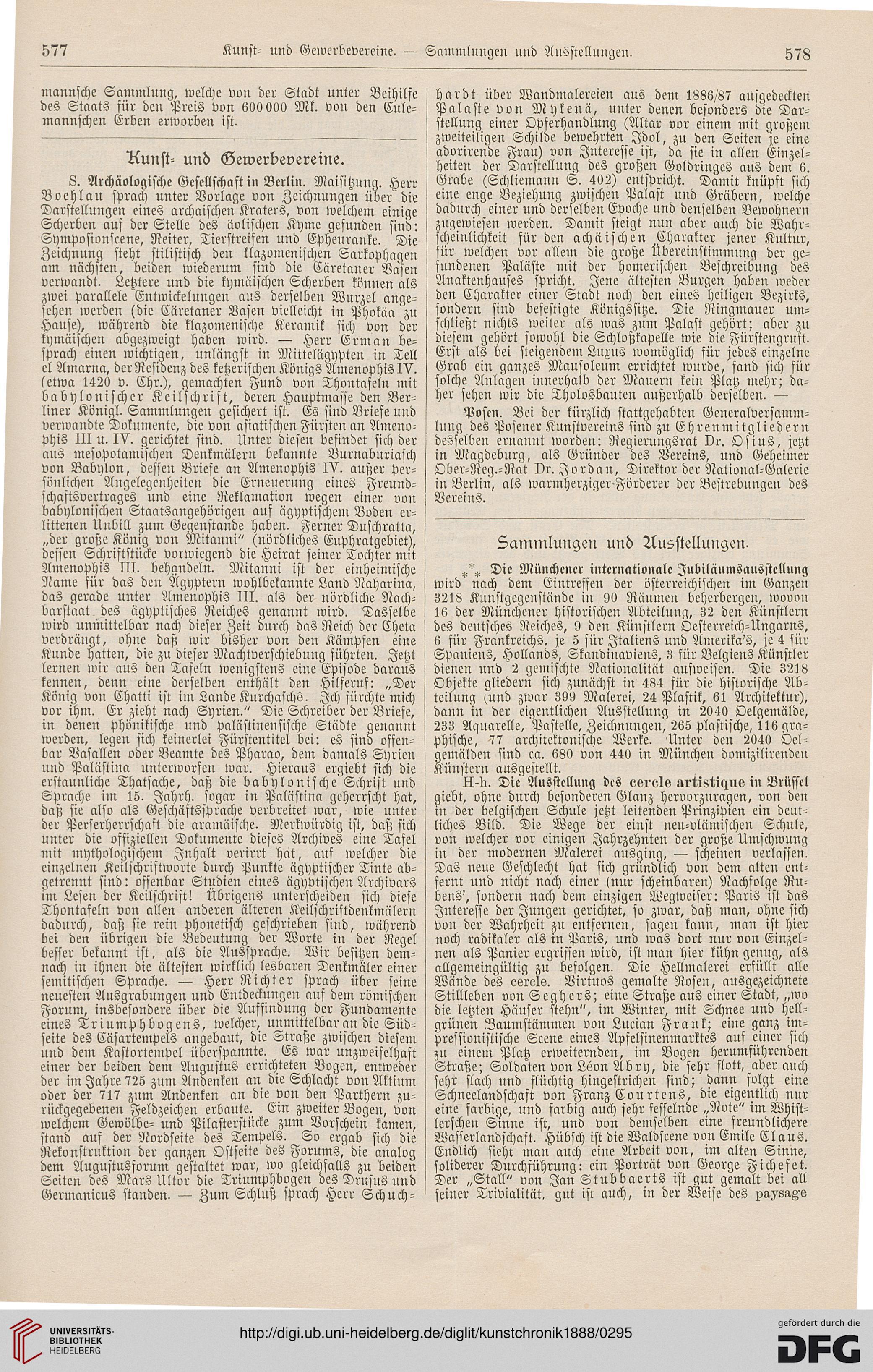577
Kuiist- und Gcwcrbevercine. — Sannulungeu uud AuSstelluugen.
578
maunsche Sciuiinlung, wclche vou der Stadt unter Beihilfe
des Staats für den Preis von 8ÜVVV0 Mk. von den Cule-
manuschen Erben erworben ist.
Aunst- und Gewerbevereine.
8. Archäologischc Gescllschast in Berlin. Maisitzung. Herr
Boehlau sprach uuter Vorlage von Zeichnungen über° die
Darstellungen eines archaischen Kraters, von welchcm einige
Scherben auf der Stelle des äolischen Kynie gefunden sind:
Symposionscene, Reiter, Tierstreifen und Epheuranke. Die
Zeichnnng steht stilistisch den klazomenischen Sarkophagen
nm nächsten, beidcn wiederum sind die Cäretaner Vasen
verwandt. Letztere und dis kymäischen Scherben kvnnen als
zwei parallele Entwickelungen aus derselben Wurzel ange-
sehen werden (die Cäretaner Vasen vielleicht in Phokaa zu
Hause), während die klazomenische Keramik sich von der
kymäischen abgezweigt haben wird. — Herr Erman be-
sprach einen wichtigen, unlängst in Mittelägypten in Tell
el Amarna, derResidenz des kctzerischen KönigsÄmenophislV.
letwa 1420 v. Chr.), gemachten Fund von Thontafeln uüt
babylonischer Keilschrist, deren Hauptmasse den Ber-
liner Königl. Sammlungen gesichert ist. Es sind Briefe und
verwandte Dvkumente, die von asiatischen Fürsten an Ameno-
phis III u. IV. gerichtet sind. Unter diesen befindet sich der
aus mcsopotamischen Denkmälsrn bekanute Burnaburiasch
Vvn Babylon, dcssen Briese an Amenophis IV. außer pcr-
sönlichen Angelegenheiten die Erneuerung eines F-reund-
schaftsvertrages und eine Reklamation wegen ciner oon
babylonischen Staatsangehörigen auf ägyptischem Boden er-
littenen Unbill zum Gegeiistande haben. Ferner Duschratta,
„der große König von Mitanni" (nördliches Euphratgebiet),
dessen Schriftstücke vorwiegend die Heirat seiner Tochter mit
Amenophis III. behandeln. Mitanni ist der einheimische
Name für das den Agypteru wohlbekannte Land Jlaharina,
das gcrade unter Amenophis III. als der nördliche Nach-
barstaat des ägyptisches Reiches genannt wird. Dasselbe
wird umiiittelbar nach dieser Zeit durch das Reich der Cheta
verdräugt, ohne daß wir bisher von den Kämpfen eine
Knnde hatten, die zu dieser Machtverschiebung führten. Jetzt
lernen wir aus den Tafeln wenigstens eine Episode daraüs
kennen, denn eiue derselben enthält den Hilferuf: „Der
König von Chatti ist im Lande KurchaschS. Jch sürchte mich
vor ihm. Er zieht nach Syrien." Die Schreiber der Briefe,
in denen phönikische und palästineusische Städte genannt
werden, legen sich keinerlei Fürstentitel bei: es sind offen-
bar Vasallen oder Beamte des Pharao, dem damals Syrien
und Palästina unterworfen war. Hieraus ergiebt sich die
erstaunliche Thatsache, das; die babylvnische'Schrift und
Sprache im 15. Jahrh. sogar iu Palästiua geherrscht hat,
daß sie also als Geschästssprache verbreitet war, wie unter
der Perserherrschast die aramüische. Merkwürdig ist, daß sich
uuter die offiziellen Dokumente dieses Archives eine Tasel
mit mythologischcm Jnhalt verirrt hat, auf welcher die
einzelneu Keilschriftworte durch Punkte ägyptischer Tiuts ab-
getrennt sind: offenbar Studien eines ägyptischen Archivars
im Lesen der Keilschrift! Übrigens unterscheiden sich diese
Thontafeln von allen anderen älteren Keilschriftdenkmälern
dadurch, daß sie rein phonetisch geschrieben siud, währcnd
bei den übrigen die Bedeutung der Worte in der Regel
besser bekannt ist, als die Aussprache. Wir besitzen dem-
nach in ihnen die ältesten wirklich lesbaren Denkmäler einer
semitischen Sprache. — Herr Richter sprach über seine
neuesten Ausgrabungen und Entdeckungen auf dem römischen
Forum, insbesondere über die Auffiiidung der Fundamente
eines Triumphbogens, wslchcr, uumittelbaran die Süd-
seite des Cäsartempels angebaut, die Straße zwischen dlesem
und dem Kastortempel überspannte. Es war unzweifelhaft
einer der beiden dem Augustus errichteten Bogen, entweder
der im Jahre 725 zum An'denken an die Schlacht von Aktium
oder der 717 zum Andenken an die von den Parthern zu-
rückgegebenen Feldzeichen erbaute. Ein zweiter Bogen, von
welchem Gewölbe- und Pilasterstücke zum Vorscheiu kamen,
stand auf der Nordseite des Tempels. So ergab sich die
Rekonstruktion der ganzen Ostseite des Forums, dis analog
dem Augustusforum gestaltet war, wo gleichfalls zu beiden
Seitcn des Mars Ultor die Triumphbogen des Drusus und
Germanicus standen. — Zum Schluß sprach Herr Schuch-
hardt über Wandmalereien aus dein 1886/87 aufgcdeckten
Palaste von Mykenä, unter denen besvnders die Dar-
stellung einer Opferhandlung (Altar vor einem mit großem
zweiteiligen Schilde bewehrten Jdol, zu den Seiten ;e eine
adorirende Frau) von Jnteresse ist, da sie in allen Einzsl-
heiten der Darstellung des großen Gvldringes aus dem 6.
Grabe (Schliemann S. 402) entspricht. Damit knüpft sich
eiue enge Beziehung zwischsn Palast nnd Grttbern, ivelche
dadurch einer und derselben Epoche und denselben Beivohnern
zugewiesen werden. Damit steigt nuu aber auch die Wahr-
scheinlichkeit fllr den achäijchen Chnrakter jener Kultur,
jür welchen vor allem die große Übereinstimmung der ge-
suudenen Paläste mit der homerischen Beschreibung des
Anaktenhauses spricht. Jene ältesten Burgen haben'weder
den Charakter ciner Stadt noch den eines heiligen Bezirks,
sondern sind befestigte Königssitze. Die Ningmauer nm-
schließt nichts weiter als was zum Palast gehört; aber zu
diesem gehört sowohl die Schloßkapelle wie die Fürstengrust.
Erst als bei steigendem Luxus womöglich sür jedes einzelne
Grab ein ganzes Mausoleum errichtet wnrde, faud sich für
solche Aulagen inuerhalb der Mauern kein Platz mehr; da-
her sehen wir die Tholosbnuten außerhalb derselben. —
Posen. Bei dcr kürzlich stattgehabtcn Generalversamm-
lung des Posener Kunstvereins sind zu Ehrenmitgliedern
desselben crnannt wordeu: Regierungsrat Or. Os'ius, jetzt
in Magdeburg, alS Gründer 'des Bereins, und Geheimer
Ober-Reg.-Rat vr. Jordau, Direktvr der Natioual-Galerie
in Berliii, als warmherziger-Fördercr der Bestrebuugcn des
Vereins.
Sammlungen und Ausstellungeu.
,.//., Dic Miinchcncr intcrnationale Jubiläninsausstettung
wird'nach dem Eintrefsen der österreichischen ini Ganzen
3218 Kunstgegenstände in 90 Räuiueii beherbergen, wovvn
16 der Münchcuer historischen Abteilung, 32 dcn Künstlern
des deutsches Reiches, 9 den Küustlsrn Oesterreich-Ungarns,
6 für Frankreichs. je 5 sür Jtaliens uud Amerika's, je 4 für
Spcinicns, Hollands, Skandinaviens, 3 für Belgiens Künstler
dienen und 2 gemischte Natioualität ausweisen. Die 3218
Objekte gliedern sich zunüchst in 484 für die historische Ab-
teilung ;und zwar 399 Malerei, 24 Plastik, 61 Architektur),
daun in der eigentlichen Ausstellung in 204g Oelgemälde,
233 Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, 265 plastische, 116 gra-
phische, 77 architektonische Werke. ilnter dcn 2040 Oel-
gemälden sind ca. 680 von 440 in München domizilircnden
Künstern ausgestellt.
11-ii. Dic Ausstellung dcs cwi-c-.Ia iil-liicligue in Biüssel
giebt, ohne durch besondcren Glauz hervorzuragen, von dcn
'in der belgischen Schule jctzt leitenden Prinzipien ein dcut-
liches Bild. Die Wege der einst neu-vlämischen Schule,
von welcher vvr einigen Jahrzehnten der große Umschwmig
in der moderiieu Malerei ausging, — scheinen verlassen.
Das neue Geschlecht hat sich gründ'lich von dcm alten ent-
fernt und nicht nach einer <nur scheinbaren) Nachsolge Ru-
bens', sondern nach dem einzigen Wegweiser: Paris 'ist das
Jnteresse der Jungen gerichtet, so zwär, daß man, ohne sich
von der Wahrheit'zu entfernen, sagen kann, man ist hier
noch radikaler als in Paris, und was dort nur von Einzel-
nen als Panier ergriffen wird, ist man hier kühn genug, als
allgemeingültig zu befolgen. Die Hellmalerei erfüllt allc
Wände des osrols. Virtuos gemalte Rosen, ausgezeichnete
Stillleben von Segh crs; eine Straße ans einer Stadt, „wo
die letztsn Häuser stehn", im Winter, mit Schnee und hell-
grüneü Baumstäminen von Lucian Frank; eine ganz im-
pressionistische Scene eines Apselsineiimarktcs auf einer sich
zu einem Platz erweiternden, im Bogen herumführcnden
Straße; Soldaten von Lson Abry, die sehr flott, aber auch
sehr flach und flüchtig hingestrichen sind; dann fvlgt eine
Schneclandschaft von'Franz Courtens, die eigentlich nur
eine sarbige, und farbig auch sehr fesselnde „Note" im Whist-
lerschen Sinne ist, und von demsclben eine freundlichers
Wasssrlandschaft. Hübsch ist die Waldscene von Emile Claus.
Eiidlich sieht man auch eiue Arbcit von, im alten Sinne,
soliderer Durchführung: ein Porträt von George Fichefet.
Der „Stall" von Jan Stubbaerts ist gut gemalt bei all
seiner Trivialität, gut ist auch, in der Weise des xaz-saAS
Kuiist- und Gcwcrbevercine. — Sannulungeu uud AuSstelluugen.
578
maunsche Sciuiinlung, wclche vou der Stadt unter Beihilfe
des Staats für den Preis von 8ÜVVV0 Mk. von den Cule-
manuschen Erben erworben ist.
Aunst- und Gewerbevereine.
8. Archäologischc Gescllschast in Berlin. Maisitzung. Herr
Boehlau sprach uuter Vorlage von Zeichnungen über° die
Darstellungen eines archaischen Kraters, von welchcm einige
Scherben auf der Stelle des äolischen Kynie gefunden sind:
Symposionscene, Reiter, Tierstreifen und Epheuranke. Die
Zeichnnng steht stilistisch den klazomenischen Sarkophagen
nm nächsten, beidcn wiederum sind die Cäretaner Vasen
verwandt. Letztere und dis kymäischen Scherben kvnnen als
zwei parallele Entwickelungen aus derselben Wurzel ange-
sehen werden (die Cäretaner Vasen vielleicht in Phokaa zu
Hause), während die klazomenische Keramik sich von der
kymäischen abgezweigt haben wird. — Herr Erman be-
sprach einen wichtigen, unlängst in Mittelägypten in Tell
el Amarna, derResidenz des kctzerischen KönigsÄmenophislV.
letwa 1420 v. Chr.), gemachten Fund von Thontafeln uüt
babylonischer Keilschrist, deren Hauptmasse den Ber-
liner Königl. Sammlungen gesichert ist. Es sind Briefe und
verwandte Dvkumente, die von asiatischen Fürsten an Ameno-
phis III u. IV. gerichtet sind. Unter diesen befindet sich der
aus mcsopotamischen Denkmälsrn bekanute Burnaburiasch
Vvn Babylon, dcssen Briese an Amenophis IV. außer pcr-
sönlichen Angelegenheiten die Erneuerung eines F-reund-
schaftsvertrages und eine Reklamation wegen ciner oon
babylonischen Staatsangehörigen auf ägyptischem Boden er-
littenen Unbill zum Gegeiistande haben. Ferner Duschratta,
„der große König von Mitanni" (nördliches Euphratgebiet),
dessen Schriftstücke vorwiegend die Heirat seiner Tochter mit
Amenophis III. behandeln. Mitanni ist der einheimische
Name für das den Agypteru wohlbekannte Land Jlaharina,
das gcrade unter Amenophis III. als der nördliche Nach-
barstaat des ägyptisches Reiches genannt wird. Dasselbe
wird umiiittelbar nach dieser Zeit durch das Reich der Cheta
verdräugt, ohne daß wir bisher von den Kämpfen eine
Knnde hatten, die zu dieser Machtverschiebung führten. Jetzt
lernen wir aus den Tafeln wenigstens eine Episode daraüs
kennen, denn eiue derselben enthält den Hilferuf: „Der
König von Chatti ist im Lande KurchaschS. Jch sürchte mich
vor ihm. Er zieht nach Syrien." Die Schreiber der Briefe,
in denen phönikische und palästineusische Städte genannt
werden, legen sich keinerlei Fürstentitel bei: es sind offen-
bar Vasallen oder Beamte des Pharao, dem damals Syrien
und Palästina unterworfen war. Hieraus ergiebt sich die
erstaunliche Thatsache, das; die babylvnische'Schrift und
Sprache im 15. Jahrh. sogar iu Palästiua geherrscht hat,
daß sie also als Geschästssprache verbreitet war, wie unter
der Perserherrschast die aramüische. Merkwürdig ist, daß sich
uuter die offiziellen Dokumente dieses Archives eine Tasel
mit mythologischcm Jnhalt verirrt hat, auf welcher die
einzelneu Keilschriftworte durch Punkte ägyptischer Tiuts ab-
getrennt sind: offenbar Studien eines ägyptischen Archivars
im Lesen der Keilschrift! Übrigens unterscheiden sich diese
Thontafeln von allen anderen älteren Keilschriftdenkmälern
dadurch, daß sie rein phonetisch geschrieben siud, währcnd
bei den übrigen die Bedeutung der Worte in der Regel
besser bekannt ist, als die Aussprache. Wir besitzen dem-
nach in ihnen die ältesten wirklich lesbaren Denkmäler einer
semitischen Sprache. — Herr Richter sprach über seine
neuesten Ausgrabungen und Entdeckungen auf dem römischen
Forum, insbesondere über die Auffiiidung der Fundamente
eines Triumphbogens, wslchcr, uumittelbaran die Süd-
seite des Cäsartempels angebaut, die Straße zwischen dlesem
und dem Kastortempel überspannte. Es war unzweifelhaft
einer der beiden dem Augustus errichteten Bogen, entweder
der im Jahre 725 zum An'denken an die Schlacht von Aktium
oder der 717 zum Andenken an die von den Parthern zu-
rückgegebenen Feldzeichen erbaute. Ein zweiter Bogen, von
welchem Gewölbe- und Pilasterstücke zum Vorscheiu kamen,
stand auf der Nordseite des Tempels. So ergab sich die
Rekonstruktion der ganzen Ostseite des Forums, dis analog
dem Augustusforum gestaltet war, wo gleichfalls zu beiden
Seitcn des Mars Ultor die Triumphbogen des Drusus und
Germanicus standen. — Zum Schluß sprach Herr Schuch-
hardt über Wandmalereien aus dein 1886/87 aufgcdeckten
Palaste von Mykenä, unter denen besvnders die Dar-
stellung einer Opferhandlung (Altar vor einem mit großem
zweiteiligen Schilde bewehrten Jdol, zu den Seiten ;e eine
adorirende Frau) von Jnteresse ist, da sie in allen Einzsl-
heiten der Darstellung des großen Gvldringes aus dem 6.
Grabe (Schliemann S. 402) entspricht. Damit knüpft sich
eiue enge Beziehung zwischsn Palast nnd Grttbern, ivelche
dadurch einer und derselben Epoche und denselben Beivohnern
zugewiesen werden. Damit steigt nuu aber auch die Wahr-
scheinlichkeit fllr den achäijchen Chnrakter jener Kultur,
jür welchen vor allem die große Übereinstimmung der ge-
suudenen Paläste mit der homerischen Beschreibung des
Anaktenhauses spricht. Jene ältesten Burgen haben'weder
den Charakter ciner Stadt noch den eines heiligen Bezirks,
sondern sind befestigte Königssitze. Die Ningmauer nm-
schließt nichts weiter als was zum Palast gehört; aber zu
diesem gehört sowohl die Schloßkapelle wie die Fürstengrust.
Erst als bei steigendem Luxus womöglich sür jedes einzelne
Grab ein ganzes Mausoleum errichtet wnrde, faud sich für
solche Aulagen inuerhalb der Mauern kein Platz mehr; da-
her sehen wir die Tholosbnuten außerhalb derselben. —
Posen. Bei dcr kürzlich stattgehabtcn Generalversamm-
lung des Posener Kunstvereins sind zu Ehrenmitgliedern
desselben crnannt wordeu: Regierungsrat Or. Os'ius, jetzt
in Magdeburg, alS Gründer 'des Bereins, und Geheimer
Ober-Reg.-Rat vr. Jordau, Direktvr der Natioual-Galerie
in Berliii, als warmherziger-Fördercr der Bestrebuugcn des
Vereins.
Sammlungen und Ausstellungeu.
,.//., Dic Miinchcncr intcrnationale Jubiläninsausstettung
wird'nach dem Eintrefsen der österreichischen ini Ganzen
3218 Kunstgegenstände in 90 Räuiueii beherbergen, wovvn
16 der Münchcuer historischen Abteilung, 32 dcn Künstlern
des deutsches Reiches, 9 den Küustlsrn Oesterreich-Ungarns,
6 für Frankreichs. je 5 sür Jtaliens uud Amerika's, je 4 für
Spcinicns, Hollands, Skandinaviens, 3 für Belgiens Künstler
dienen und 2 gemischte Natioualität ausweisen. Die 3218
Objekte gliedern sich zunüchst in 484 für die historische Ab-
teilung ;und zwar 399 Malerei, 24 Plastik, 61 Architektur),
daun in der eigentlichen Ausstellung in 204g Oelgemälde,
233 Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, 265 plastische, 116 gra-
phische, 77 architektonische Werke. ilnter dcn 2040 Oel-
gemälden sind ca. 680 von 440 in München domizilircnden
Künstern ausgestellt.
11-ii. Dic Ausstellung dcs cwi-c-.Ia iil-liicligue in Biüssel
giebt, ohne durch besondcren Glauz hervorzuragen, von dcn
'in der belgischen Schule jctzt leitenden Prinzipien ein dcut-
liches Bild. Die Wege der einst neu-vlämischen Schule,
von welcher vvr einigen Jahrzehnten der große Umschwmig
in der moderiieu Malerei ausging, — scheinen verlassen.
Das neue Geschlecht hat sich gründ'lich von dcm alten ent-
fernt und nicht nach einer <nur scheinbaren) Nachsolge Ru-
bens', sondern nach dem einzigen Wegweiser: Paris 'ist das
Jnteresse der Jungen gerichtet, so zwär, daß man, ohne sich
von der Wahrheit'zu entfernen, sagen kann, man ist hier
noch radikaler als in Paris, und was dort nur von Einzel-
nen als Panier ergriffen wird, ist man hier kühn genug, als
allgemeingültig zu befolgen. Die Hellmalerei erfüllt allc
Wände des osrols. Virtuos gemalte Rosen, ausgezeichnete
Stillleben von Segh crs; eine Straße ans einer Stadt, „wo
die letztsn Häuser stehn", im Winter, mit Schnee und hell-
grüneü Baumstäminen von Lucian Frank; eine ganz im-
pressionistische Scene eines Apselsineiimarktcs auf einer sich
zu einem Platz erweiternden, im Bogen herumführcnden
Straße; Soldaten von Lson Abry, die sehr flott, aber auch
sehr flach und flüchtig hingestrichen sind; dann fvlgt eine
Schneclandschaft von'Franz Courtens, die eigentlich nur
eine sarbige, und farbig auch sehr fesselnde „Note" im Whist-
lerschen Sinne ist, und von demsclben eine freundlichers
Wasssrlandschaft. Hübsch ist die Waldscene von Emile Claus.
Eiidlich sieht man auch eiue Arbcit von, im alten Sinne,
soliderer Durchführung: ein Porträt von George Fichefet.
Der „Stall" von Jan Stubbaerts ist gut gemalt bei all
seiner Trivialität, gut ist auch, in der Weise des xaz-saAS