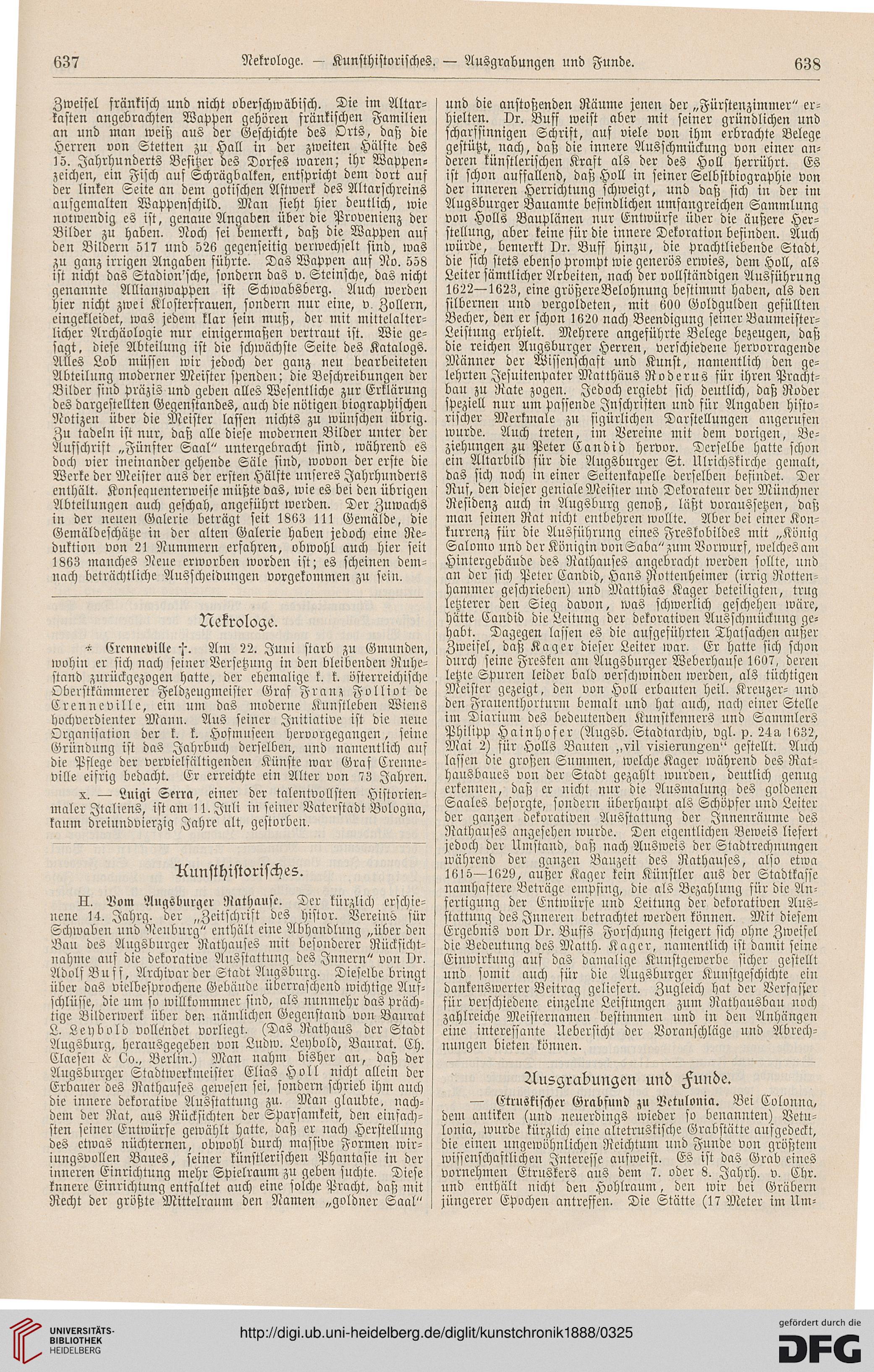637
Nekrologe. - Kunsthistorisches. — Ausgrabungen und Funde.
638
Zweifel sränkisch und nicht oberschwäbisch. Die im Altar-
kasten angebrachten Wappen gehören fränkischen Familien
an und man weiß aus der Geschichte des Orts, daß die
Herren von Stetten zu Hall in der zweiten Hälfte des
lö. Jahrhunderts Besiker des Dorfes waren; ihr Wappen-
zeichen, ein Fisch auf Schrägbalken, entspricht dem dort auf
der linken Seite an dem gotischen Astwerk des Altarschreins
aufgemalten Wappenschild. Man sieht hier deutlich, wie
nolwendig es ist, genaue Angaben über die Provenienz der
Bilder zu haben. Noch sei bemerkt, daß die Wappen auf
den Biloern 517 und 526 gegenseitig verwechselt sind, was
zu ganz irrigen Angaben führte. Das Wappen auf No. 558
ist nicht das Stadion'sche, sondern das v. Stcinsche, das nicht
genannte Allianzwappen ist Schwabsberg. Auch werden
hier nicht zwei Klosterfrauen, sondern nur eine, v. Zollern,
eingekleidet, was jedem klar sein muß, der mit mittelalter-
licher Archäologie nur einigermaßen vertraut ist. Wie ge-
sagt. diese Abteilung ist dw schwächste Seite des Katalogs.
Alles Lob müssen wir jedoch der ganz neu bearbeiteten
Abteilung moderner Meister spenden; die Beschreibungen der
Bilder sind präzis und geben alles Wesentliche zur Erklärung
des dargestellten Gegenstandes, auch die nötigen biographijchen
Notizen über die Meister lassen nichts zu wünschen übrig.
Zu tadeln ist nur, daß alle diese modernen Bilder unter der
illufschrift „Fünster Saal" untergebracht sind, während es
doch vier ineinander gehende Säle sind, wovon der erste die
Werke der Meister aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderls
enthält. Konsequenterweise müßte das, wie es bei den übrigen
Abteilungen auch geschah, angeführt werden. Der Zuwachs
in der neuen Galerie beträgt seit 1863 11l Gemälde, die
Gemäldeschätze in der alten Galerie haben jedoch eine Re-
duktion von 2l Nummern erfahren, obwohl auch hier seit
l863 manches Neue erworben worden ist; es scheinen dem-
nach beträchtliche Ausscheidungen Vorgekvmmen zu sein.
Nekrologe.
« Crcnncville -h. Am 22. Juni starb zu Gmunden,
wohin er sich nach seiner Versetzung in den bleibenden Ruhe-
stand zuriickgezogen hatte, der ehemalige k. k. österreichische
Oberstkämmerer Feldzeugmeister Graf Franz Fvlliot de
Crenneville, ein um das moderne Kunstleben Wiens
hochverdienter Manu. Aus seincr Jnitiative ist die neue
Organisation der k. k. Hofmuseen hervorgegangen, seine
Gründung ist das Jahrbuch derselbeu, und namentlich auf
die Pflege der vervielfnltigenden Künste war Graf Crenne-
ville eifrig bedacht. Er erreichte ein Alter von 73 Jahren.
x. — Luigi Scrra, einer der talentvollsten Historien-
maler Jtaliens, ist am l 1. Juli in seiner Vaterstadt Bologna,
kaum dreiundvierzig Jahre alt, gestorben.
Aunsthistorisches.
H. Vom Augsburgcr Nathausc. Der kürzlich erschie-
nene l4. Jahrg. der „Zeitschrist des histor. Vereins sür
Schwaben und ilienburg" enthält eine Nbhandlung „über den
Bau des Augsburger Rathauses mit besonderer Rücksicht-
nahme auf die dekorative Ausstattung des Jnnern" von Or.
Adols Bu f f, Archivar der Stadt Augsburg. Dieselbe bringt
über das vielbesprochene Gebäuds überraschend wichtige Auf-
schlüsse, die um so willkvmmner sind, als nunmehr das präch-
tige Bilderwerk über den nämlichcn Gegenstand von Banrat
L. Lehbold volleüdet vorliegt. (Das Rathaus der Stadt
Llugsburg, hcrausgsgeben von Ludw. Leybold, Baurat. Ch.
Claesen L 6o., Bsrlm.) Man nahm bisher an, daß der
Augsburger Stadtwerkmeister Elias Holl nicht allein dcr
Erbauer des Rathauses gewesen sei, sondern schrieb ihm auch
die innere dekorative Ausstattung zu. Man glaubte, nach-
denr der Nat, aus Rücksichten der Sparsamkeit, den einfach-
sten seiner Entwürfe gewählt hatte, daß er nach Herstellung
des etwas nüchternen, obwohl durch massive Formen wir-
iungsvollen Baues, seiner künstlerischsn Phantasie in der
inneren Einrichtung mehr Spielraum zu geben suchte. Diese
knnere Einrichtung entfaltet auch eine solche Pracht, daß mit
Recht der größte Mittelraum den Namen „goldner Saal"
und die anstoßsnden Räums jenen der „Fürstenzimmer" er-
hielten. vr. Bufs weist aber mit seiner gründlichen und
scharssinnigen Schrift, auf viele von ihm erbrachte Belege
gestützt, nach, daß die innere Ausschmückung von einer an-
deren künstlerischen Kraft als der des Holl herrührt. Es
ist schon auffallend, daß Holl in seiner Selbstbiographie von
der inneren Herrichtung schweigt, und daß sich in der im
Augsburger Bauamte befindlichsn umfangreichen Sammlung
von Holls Bauplänen nur Entwürfe über die äußere Her-
stellung, aber keine für die innere Dekoration befinden. Auch
würde, benierkt vr. Buff hinzu, die prachtliebende Stadt,
die sich stets ebenso prompt wis generös erwies, dem Holl, als
Leiter sämtlicher Arbeiten, nach oer vollständigen Aussührung
1622—1623, eine größereBelohnung bestimmt haben, als den
silbernen und vergoldeten, mit 668 Goldgulden gefüllten
Becher, den er schon 1620 nach Beendigung semer Baumeister-
Leistung erhislt. Mehrere angeführte Belege bezeugen, daß
die reichen Augsburger Herren, verschiedene hervorragende
Männer der Wissenschast und Kunst, namentlich den ge-
lehrten Jesuitenpater Matthäus Roderus für ihren Pracht-
bau zu Rate zogen. Jcdoch ergiebt sich deutlich, daß Roder
speziell nur um passcnde Jnschriften und für Angaben histo-
rischer Merkmale zu sigürlichen Darstellungen angerufen
wurde. Auch treten, iin Vereine mit dem vorigen, Be-
ziehungen zu Peter Candid hervor. Derselbe hatte schon
ein Altarbild sür die Augsburger St. Ulrichskirche gcmalt,
das sich noch in eincr Seitenkapelle derselben befindet. Der
Ruf, den dieser genialeMeister und Dekorateur der Münchner
Residenz anch in Augsburg genoß, läßt voraussstzcn, daß
man seinen Rat nicht entbehren wvllte. Aber bei einer Kon-
kurrcnz für die Aussührung eines Freskobildes mit „König
Salomo und der Königin vonSaba"zum Vorwurf, welches aiii
Hintergebäude des R'athauses angcbracht werden solltc, und
an der sich Peter Candid, Hans Pottenheimer (irrig Rotten-
hammer geschrieben) und Mntthias Kager beteiligten, trug
letzterer den Sieg davon, was schwerlich geschehen wäre,
hätte Candid die'Leitung der dekorativen Ausschmückung ge-
habt. Dazegen lassen es die aufgeführten Thatsachen außer
Zweifel, daß Kaqer dieser Leiter ivar. Er hatte sich schon
durch seine Fresken am Augsburger Weberhause 1607, deren
letzte Spuren leider bald verschwindcn werden, als tüchtigen
Meister gezeigt, den von Holl erbauten heil. Kreuzer- und
den Frauenthorturm bemalt und hat nnch, nach einer Stelle
im Diarium des bedeutenden Kunstkenners und Sammlcrs
Philipp Hainhoser (Augsb. Stadtarchiv, vgl. p. 24a 1632,
Mai 2) für Holls Bauten ,,vil visisrnnASw' gestellt. Nuch
lassen die großen Summen, welche Kager während des Rat-
hausbaues von der Stadt gezahlt wurden, deutlich genug
erkennen, dah er nicht nur die Ausmalung des goldeneir
Saales besorgte, sondern überhaupt als Schöpfer und Leiter
der ganzen dekorativen Ausstattung der Jnnenräume des
Rathauses angesehen wurde. Den eigentlichen Beweis liefert
jedoch der llmstand, daß nach Ausweis der Stadtrechnungen
während der ganzen Bauzeit des Rathauses, also etwa
1615—1629, außer Kager kein Künstler aus der Stadtkasse
namhaftere Beträge einpfing, die als Bezahlung für die An-
fertigung der Entwürfe und Leitnng der dckorativen Aus-
stattung des Jnneren bctrachtet werden können. Mit diesem
Ergebnis von Or. Buffs Forschung steigert sich ohne Zweifel
die Bedcutung des Matth. Kagcr, namentlich ist damit seine
Einwirkung auf das damalige Kunstgcwerbe sicher gestellt
und svmit auch für die Äugsburger Kunstgeschichte ein
dankenswertcr Beitrag geliefert. Zugleich hat dcr Verfasser
für verschiedene einzelrtze Leistungen zum Nathausbau noch
zahlreiche Mcisternamen bestimmen und in deu Anhängen
eine interessante Uebersicht der Voranschläge und Abrech-
nungcn bieten können.
Ausgrabungcn und Funde.
— Ctruskischer Grabfund zu Vetulonia. Bei Colonna,
dem antiken (und neuerdings wieder so benannteli) Betu-
lonia, wurde kürziich eine altetruskische Grabstätte aufgedeckt,
die einen nngewvhnlichen Reichtum und Funde von größtem
wissenschaftlichen Jnteresse aufweist. Es ist das Grab cines
vornehmen Etruskers aus dem 7. oder 8. Jahrh. v. Chr.
nnd enthält nicht den Hohlraum, den wir bei Gräbern
jüngerer Epochen antreffen. Die Stätte (17 Meter im Um-
Nekrologe. - Kunsthistorisches. — Ausgrabungen und Funde.
638
Zweifel sränkisch und nicht oberschwäbisch. Die im Altar-
kasten angebrachten Wappen gehören fränkischen Familien
an und man weiß aus der Geschichte des Orts, daß die
Herren von Stetten zu Hall in der zweiten Hälfte des
lö. Jahrhunderts Besiker des Dorfes waren; ihr Wappen-
zeichen, ein Fisch auf Schrägbalken, entspricht dem dort auf
der linken Seite an dem gotischen Astwerk des Altarschreins
aufgemalten Wappenschild. Man sieht hier deutlich, wie
nolwendig es ist, genaue Angaben über die Provenienz der
Bilder zu haben. Noch sei bemerkt, daß die Wappen auf
den Biloern 517 und 526 gegenseitig verwechselt sind, was
zu ganz irrigen Angaben führte. Das Wappen auf No. 558
ist nicht das Stadion'sche, sondern das v. Stcinsche, das nicht
genannte Allianzwappen ist Schwabsberg. Auch werden
hier nicht zwei Klosterfrauen, sondern nur eine, v. Zollern,
eingekleidet, was jedem klar sein muß, der mit mittelalter-
licher Archäologie nur einigermaßen vertraut ist. Wie ge-
sagt. diese Abteilung ist dw schwächste Seite des Katalogs.
Alles Lob müssen wir jedoch der ganz neu bearbeiteten
Abteilung moderner Meister spenden; die Beschreibungen der
Bilder sind präzis und geben alles Wesentliche zur Erklärung
des dargestellten Gegenstandes, auch die nötigen biographijchen
Notizen über die Meister lassen nichts zu wünschen übrig.
Zu tadeln ist nur, daß alle diese modernen Bilder unter der
illufschrift „Fünster Saal" untergebracht sind, während es
doch vier ineinander gehende Säle sind, wovon der erste die
Werke der Meister aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderls
enthält. Konsequenterweise müßte das, wie es bei den übrigen
Abteilungen auch geschah, angeführt werden. Der Zuwachs
in der neuen Galerie beträgt seit 1863 11l Gemälde, die
Gemäldeschätze in der alten Galerie haben jedoch eine Re-
duktion von 2l Nummern erfahren, obwohl auch hier seit
l863 manches Neue erworben worden ist; es scheinen dem-
nach beträchtliche Ausscheidungen Vorgekvmmen zu sein.
Nekrologe.
« Crcnncville -h. Am 22. Juni starb zu Gmunden,
wohin er sich nach seiner Versetzung in den bleibenden Ruhe-
stand zuriickgezogen hatte, der ehemalige k. k. österreichische
Oberstkämmerer Feldzeugmeister Graf Franz Fvlliot de
Crenneville, ein um das moderne Kunstleben Wiens
hochverdienter Manu. Aus seincr Jnitiative ist die neue
Organisation der k. k. Hofmuseen hervorgegangen, seine
Gründung ist das Jahrbuch derselbeu, und namentlich auf
die Pflege der vervielfnltigenden Künste war Graf Crenne-
ville eifrig bedacht. Er erreichte ein Alter von 73 Jahren.
x. — Luigi Scrra, einer der talentvollsten Historien-
maler Jtaliens, ist am l 1. Juli in seiner Vaterstadt Bologna,
kaum dreiundvierzig Jahre alt, gestorben.
Aunsthistorisches.
H. Vom Augsburgcr Nathausc. Der kürzlich erschie-
nene l4. Jahrg. der „Zeitschrist des histor. Vereins sür
Schwaben und ilienburg" enthält eine Nbhandlung „über den
Bau des Augsburger Rathauses mit besonderer Rücksicht-
nahme auf die dekorative Ausstattung des Jnnern" von Or.
Adols Bu f f, Archivar der Stadt Augsburg. Dieselbe bringt
über das vielbesprochene Gebäuds überraschend wichtige Auf-
schlüsse, die um so willkvmmner sind, als nunmehr das präch-
tige Bilderwerk über den nämlichcn Gegenstand von Banrat
L. Lehbold volleüdet vorliegt. (Das Rathaus der Stadt
Llugsburg, hcrausgsgeben von Ludw. Leybold, Baurat. Ch.
Claesen L 6o., Bsrlm.) Man nahm bisher an, daß der
Augsburger Stadtwerkmeister Elias Holl nicht allein dcr
Erbauer des Rathauses gewesen sei, sondern schrieb ihm auch
die innere dekorative Ausstattung zu. Man glaubte, nach-
denr der Nat, aus Rücksichten der Sparsamkeit, den einfach-
sten seiner Entwürfe gewählt hatte, daß er nach Herstellung
des etwas nüchternen, obwohl durch massive Formen wir-
iungsvollen Baues, seiner künstlerischsn Phantasie in der
inneren Einrichtung mehr Spielraum zu geben suchte. Diese
knnere Einrichtung entfaltet auch eine solche Pracht, daß mit
Recht der größte Mittelraum den Namen „goldner Saal"
und die anstoßsnden Räums jenen der „Fürstenzimmer" er-
hielten. vr. Bufs weist aber mit seiner gründlichen und
scharssinnigen Schrift, auf viele von ihm erbrachte Belege
gestützt, nach, daß die innere Ausschmückung von einer an-
deren künstlerischen Kraft als der des Holl herrührt. Es
ist schon auffallend, daß Holl in seiner Selbstbiographie von
der inneren Herrichtung schweigt, und daß sich in der im
Augsburger Bauamte befindlichsn umfangreichen Sammlung
von Holls Bauplänen nur Entwürfe über die äußere Her-
stellung, aber keine für die innere Dekoration befinden. Auch
würde, benierkt vr. Buff hinzu, die prachtliebende Stadt,
die sich stets ebenso prompt wis generös erwies, dem Holl, als
Leiter sämtlicher Arbeiten, nach oer vollständigen Aussührung
1622—1623, eine größereBelohnung bestimmt haben, als den
silbernen und vergoldeten, mit 668 Goldgulden gefüllten
Becher, den er schon 1620 nach Beendigung semer Baumeister-
Leistung erhislt. Mehrere angeführte Belege bezeugen, daß
die reichen Augsburger Herren, verschiedene hervorragende
Männer der Wissenschast und Kunst, namentlich den ge-
lehrten Jesuitenpater Matthäus Roderus für ihren Pracht-
bau zu Rate zogen. Jcdoch ergiebt sich deutlich, daß Roder
speziell nur um passcnde Jnschriften und für Angaben histo-
rischer Merkmale zu sigürlichen Darstellungen angerufen
wurde. Auch treten, iin Vereine mit dem vorigen, Be-
ziehungen zu Peter Candid hervor. Derselbe hatte schon
ein Altarbild sür die Augsburger St. Ulrichskirche gcmalt,
das sich noch in eincr Seitenkapelle derselben befindet. Der
Ruf, den dieser genialeMeister und Dekorateur der Münchner
Residenz anch in Augsburg genoß, läßt voraussstzcn, daß
man seinen Rat nicht entbehren wvllte. Aber bei einer Kon-
kurrcnz für die Aussührung eines Freskobildes mit „König
Salomo und der Königin vonSaba"zum Vorwurf, welches aiii
Hintergebäude des R'athauses angcbracht werden solltc, und
an der sich Peter Candid, Hans Pottenheimer (irrig Rotten-
hammer geschrieben) und Mntthias Kager beteiligten, trug
letzterer den Sieg davon, was schwerlich geschehen wäre,
hätte Candid die'Leitung der dekorativen Ausschmückung ge-
habt. Dazegen lassen es die aufgeführten Thatsachen außer
Zweifel, daß Kaqer dieser Leiter ivar. Er hatte sich schon
durch seine Fresken am Augsburger Weberhause 1607, deren
letzte Spuren leider bald verschwindcn werden, als tüchtigen
Meister gezeigt, den von Holl erbauten heil. Kreuzer- und
den Frauenthorturm bemalt und hat nnch, nach einer Stelle
im Diarium des bedeutenden Kunstkenners und Sammlcrs
Philipp Hainhoser (Augsb. Stadtarchiv, vgl. p. 24a 1632,
Mai 2) für Holls Bauten ,,vil visisrnnASw' gestellt. Nuch
lassen die großen Summen, welche Kager während des Rat-
hausbaues von der Stadt gezahlt wurden, deutlich genug
erkennen, dah er nicht nur die Ausmalung des goldeneir
Saales besorgte, sondern überhaupt als Schöpfer und Leiter
der ganzen dekorativen Ausstattung der Jnnenräume des
Rathauses angesehen wurde. Den eigentlichen Beweis liefert
jedoch der llmstand, daß nach Ausweis der Stadtrechnungen
während der ganzen Bauzeit des Rathauses, also etwa
1615—1629, außer Kager kein Künstler aus der Stadtkasse
namhaftere Beträge einpfing, die als Bezahlung für die An-
fertigung der Entwürfe und Leitnng der dckorativen Aus-
stattung des Jnneren bctrachtet werden können. Mit diesem
Ergebnis von Or. Buffs Forschung steigert sich ohne Zweifel
die Bedcutung des Matth. Kagcr, namentlich ist damit seine
Einwirkung auf das damalige Kunstgcwerbe sicher gestellt
und svmit auch für die Äugsburger Kunstgeschichte ein
dankenswertcr Beitrag geliefert. Zugleich hat dcr Verfasser
für verschiedene einzelrtze Leistungen zum Nathausbau noch
zahlreiche Mcisternamen bestimmen und in deu Anhängen
eine interessante Uebersicht der Voranschläge und Abrech-
nungcn bieten können.
Ausgrabungcn und Funde.
— Ctruskischer Grabfund zu Vetulonia. Bei Colonna,
dem antiken (und neuerdings wieder so benannteli) Betu-
lonia, wurde kürziich eine altetruskische Grabstätte aufgedeckt,
die einen nngewvhnlichen Reichtum und Funde von größtem
wissenschaftlichen Jnteresse aufweist. Es ist das Grab cines
vornehmen Etruskers aus dem 7. oder 8. Jahrh. v. Chr.
nnd enthält nicht den Hohlraum, den wir bei Gräbern
jüngerer Epochen antreffen. Die Stätte (17 Meter im Um-