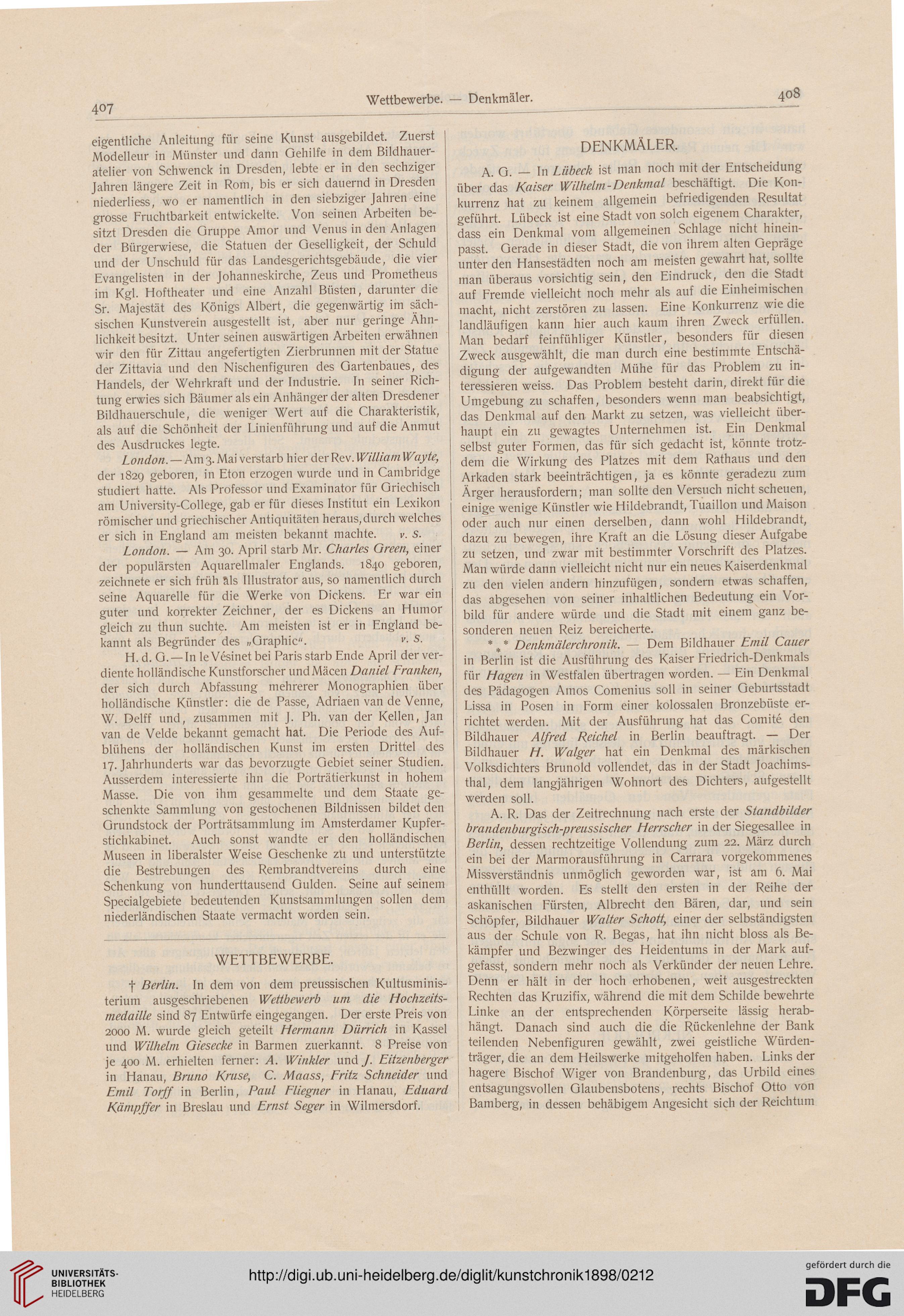407
Wettbewerbe. — Denkmäler.
408
eigentliche Anleitung für seine Kunst ausgebildet. Zuerst
Modelleur in Münster und dann Gehilfe in dem Bildhauer-
atelier von Schwenck in Dresden, lebte er in den sechziger
Jahren längere Zeit in Rom, bis er sich dauernd in Dresden
niederliess, wo er namentlich in den siebziger Jahren eine
grosse Fruchtbarkeit entwickelte. Von seinen Arbeiten be-
sitzt Dresden die Gruppe Amor und Venus in den Anlagen
der Bürgerwiese, die Statuen der Geselligkeit, der Schuld
und der Unschuld für das Landesgerichtsgebäude, die vier
Evangelisten in der Johanneskirche, Zeus und Prometheus
im Kgl. Hoftheater und eine Anzahl Büsten, darunter die
Sr. Majestät des Königs Albert, die gegenwärtig im säch-
sischen Kunstverein ausgestellt ist, aber nur geringe Ähn-
lichkeit besitzt. Unter seinen auswärtigen Arbeiten erwähnen
wir den für Zittau angefertigten Zierbrunnen mit der Statue
der Zittavia und den Nischenfiguren des Gartenbaues, des
Handels, der Wehrkraft und der Industrie. In seiner Rich-
tung erwies sich Bäumer als ein Anhänger der alten Dresdener
Bildhauerschule, die weniger Wert auf die Charakteristik,
als auf die Schönheit der Linienführung und auf die Anmut
des Ausdruckes legte.
London. — Am 3. Mai verstarb hier der Rev. William Wayte,
der 1829 geboren, in Eton erzogen wurde und in Cambridge
studiert hatte. Als Professor und Examinator für Griechisch
am University-College, gab er für dieses Institut ein Lexikon
römischer und griechischer Antiquitäten heraus,durch welches
er sich in England am meisten bekannt machte. v. S.
London. — Am 30. April starb Mr. Charles Green, einer
der populärsten Aquarellmaler Englands. 1840 geboren,
zeichnete er sich früh als Illustrator aus, so namentlich durch
seine Aquarelle für die Werke von Dickens. Er war ein
guter und korrekter Zeichner, der es Dickens an Humor
gleich zu thun suchte. Am meisten ist er in England be-
kannt als Begründer des „Graphic". s.
H. d. G. — In leVesinet bei Paris starb Ende April der ver-
diente holländische Kunstforscher undMäcen Daniel Franken,
der sich durch Abfassung mehrerer Monographien über
holländische Künstler: die de Passe, Adriaen van de Venne,
W. Delff und, zusammen mit J. Ph. van der Kellen, Jan
van de Velde bekannt gemacht hat. Die Periode des Auf-
blühens der holländischen Kunst im ersten Drittel des
17. Jahrhunderts war das bevorzugte Gebiet seiner Studien.
Ausserdem interessierte ihn die Porträtierkunst in hohem
Masse. Die von ihm gesammelte und dem Staate ge-
schenkte Sammlung von gestochenen Bildnissen bildet den
Grundstock der Porträtsammlung im Amsterdamer Kupfer-
stichkabinet. Auch sonst wandte er den holländischen
Museen in liberalster Weise Geschenke zü und unterstützte
die Bestrebungen des Rembrandtvereins durch eine
Schenkung von hunderttausend Gulden. Seine auf seinem
Specialgebiete bedeutenden Kunstsammlungen sollen dem
niederländischen Staate vermacht worden sein.
WETTBEWERBE.
f Berlin. In dem von dem preussischen Kultusminis-
terium ausgeschriebenen Wettbewerb um die Hochzeits-
medaille sind 87 Entwürfe eingegangen. Der erste Preis von
2000 M. wurde gleich geteilt Hermann Dürrich in Kassel
und Wilhelm Giesecke in Barmen zuerkannt. 8 Preise von
je 400 M. erhielten ferner: A. Winkler und /. Eitzenberger
in Hanau, Bruno Kruse, C. Maass, Fritz Schneider und
Emil Torff in Berlin, Paul Fliegner in Hanau, Eduard
Kämpf/er in Breslau und Ernst Seger in Wilmersdorf.
DENKMÄLER.
A. G. — In Lübeck ist man noch mit der Entscheidung
über das Kaiser Wilhelm-Denkmal beschäftigt. Die Kon-
kurrenz hat zu keinem allgemein befriedigenden Resultat
geführt. Lübeck ist eine Stadt von solch eigenem Charakter,
dass ein Denkmal vom allgemeinen Schlage nicht hinein-
passt. Gerade in dieser Stadt, die von ihrem alten Gepräge
unter den Hansestädten noch am meisten gewahrt hat, sollte
man überaus vorsichtig sein, den Eindruck, den die Stadt
auf Fremde vielleicht noch mehr als auf die Einheimischen
macht, nicht zerstören zu lassen. Eine Konkurrenz wie die
landläufigen kann hier auch kaum ihren Zweck erfüllen.
Man bedarf feinfühliger Künstler, besonders für diesen
Zweck ausgewählt, die man durch eine bestimmte Entschä-
digung der aufgewandten Mühe für das Problem zu in-
teressieren weiss. Das Problem besteht darin, direkt für die
Umgebung zu schaffen, besonders wenn man beabsichtigt,
das Denkmal auf den Markt zu setzen, was vielleicht über-
haupt ein zu gewagtes Unternehmen ist. Ein Denkmal
selbst guter Formen, das für sich gedacht ist, könnte trotz-
dem die Wirkung des Platzes mit dem Rathaus und den
Arkaden stark beeinträchtigen, ja es könnte geradezu zum
Ärger herausfordern; man sollte den Versuch nicht scheuen,
einige wenige Künstler wie Hildebrandt, Tuaillon und Maison
oder auch nur einen derselben, dann wohl Hildebrandt,
dazu zu bewegen, ihre Kraft an die Lösung dieser Aufgabe
zu setzen, und zwar mit bestimmter Vorschrift des Platzes.
Man würde dann vielleicht nicht nur ein neues Kaiserdenkmal
zu den vielen andern hinzufügen, sondern etwas schaffen,
das abgesehen von seiner inhaltlichen Bedeutung ein Vor-
bild für andere würde und die Stadt mit einem ganz be-
sonderen neuen Reiz bereicherte.
*, * Denkmälerchronik. — Dem Bildhauer Emil Cauer
in Berlin ist die Ausführung des Kaiser Friedrich-Denkmals
für Hagen in Westfalen übertragen worden. — Ein Denkmal
des Pädagogen Arnos Comenius soll in seiner Geburtsstadt
Lissa in Posen in Form einer kolossalen Bronzebüste er-
richtet werden. Mit der Ausführung hat das Comite den
Bildhauer Alfred Reichel in Berlin beauftragt. — Der
Bildhauer H. Walger hat ein Denkmal des märkischen
Volksdichters Brunold vollendet, das in der Stadt Joachims-
thal, dem langjährigen Wohnort des Dichters, aufgestellt
werden soll.
A. R. Das der Zeitrechnung nach erste der Standbilder
brandenburgisch-preussischer Herrscher in der Siegesallee in
Berlin, dessen rechtzeitige Vollendung zum 22. März durch
ein bei der Marmorausführung in Carrara vorgekommenes
Missverständnis unmöglich geworden war, ist am 6. Mai
enthüllt worden. Es stellt den ersten in der Reihe der
askanischen Fürsten, Albrecht den Bären, dar, und sein
Schöpfer, Bildhauer Walter Schott, einer der selbständigsten
aus der Schule von R. Begas, hat ihn nicht bloss als Be-
kämpfer und Bezwinger des Heidentums in der Mark auf-
gefasst, sondern mehr noch als Verkünder der neuen Lehre.
Denn er hält in der hoch erhobenen, weit ausgestreckten
Rechten das Kruzifix, während die mit dem Schilde bewehrte
Linke an der entsprechenden Körperseite lässig herab-
hängt. Danach sind auch die die Rückenlehne der Bank
teilenden Nebenfiguren gewählt, zwei geistliche Würden-
träger, die an dem Heilswerke mitgeholfen haben. Links der
hagere Bischof Wiger von Brandenburg, das Urbild eines
entsagungsvollen Glaubensbotens, rechts Bischof Otto von
Bamberg, in dessen behäbigem Angesicht sich der Reichtum
Wettbewerbe. — Denkmäler.
408
eigentliche Anleitung für seine Kunst ausgebildet. Zuerst
Modelleur in Münster und dann Gehilfe in dem Bildhauer-
atelier von Schwenck in Dresden, lebte er in den sechziger
Jahren längere Zeit in Rom, bis er sich dauernd in Dresden
niederliess, wo er namentlich in den siebziger Jahren eine
grosse Fruchtbarkeit entwickelte. Von seinen Arbeiten be-
sitzt Dresden die Gruppe Amor und Venus in den Anlagen
der Bürgerwiese, die Statuen der Geselligkeit, der Schuld
und der Unschuld für das Landesgerichtsgebäude, die vier
Evangelisten in der Johanneskirche, Zeus und Prometheus
im Kgl. Hoftheater und eine Anzahl Büsten, darunter die
Sr. Majestät des Königs Albert, die gegenwärtig im säch-
sischen Kunstverein ausgestellt ist, aber nur geringe Ähn-
lichkeit besitzt. Unter seinen auswärtigen Arbeiten erwähnen
wir den für Zittau angefertigten Zierbrunnen mit der Statue
der Zittavia und den Nischenfiguren des Gartenbaues, des
Handels, der Wehrkraft und der Industrie. In seiner Rich-
tung erwies sich Bäumer als ein Anhänger der alten Dresdener
Bildhauerschule, die weniger Wert auf die Charakteristik,
als auf die Schönheit der Linienführung und auf die Anmut
des Ausdruckes legte.
London. — Am 3. Mai verstarb hier der Rev. William Wayte,
der 1829 geboren, in Eton erzogen wurde und in Cambridge
studiert hatte. Als Professor und Examinator für Griechisch
am University-College, gab er für dieses Institut ein Lexikon
römischer und griechischer Antiquitäten heraus,durch welches
er sich in England am meisten bekannt machte. v. S.
London. — Am 30. April starb Mr. Charles Green, einer
der populärsten Aquarellmaler Englands. 1840 geboren,
zeichnete er sich früh als Illustrator aus, so namentlich durch
seine Aquarelle für die Werke von Dickens. Er war ein
guter und korrekter Zeichner, der es Dickens an Humor
gleich zu thun suchte. Am meisten ist er in England be-
kannt als Begründer des „Graphic". s.
H. d. G. — In leVesinet bei Paris starb Ende April der ver-
diente holländische Kunstforscher undMäcen Daniel Franken,
der sich durch Abfassung mehrerer Monographien über
holländische Künstler: die de Passe, Adriaen van de Venne,
W. Delff und, zusammen mit J. Ph. van der Kellen, Jan
van de Velde bekannt gemacht hat. Die Periode des Auf-
blühens der holländischen Kunst im ersten Drittel des
17. Jahrhunderts war das bevorzugte Gebiet seiner Studien.
Ausserdem interessierte ihn die Porträtierkunst in hohem
Masse. Die von ihm gesammelte und dem Staate ge-
schenkte Sammlung von gestochenen Bildnissen bildet den
Grundstock der Porträtsammlung im Amsterdamer Kupfer-
stichkabinet. Auch sonst wandte er den holländischen
Museen in liberalster Weise Geschenke zü und unterstützte
die Bestrebungen des Rembrandtvereins durch eine
Schenkung von hunderttausend Gulden. Seine auf seinem
Specialgebiete bedeutenden Kunstsammlungen sollen dem
niederländischen Staate vermacht worden sein.
WETTBEWERBE.
f Berlin. In dem von dem preussischen Kultusminis-
terium ausgeschriebenen Wettbewerb um die Hochzeits-
medaille sind 87 Entwürfe eingegangen. Der erste Preis von
2000 M. wurde gleich geteilt Hermann Dürrich in Kassel
und Wilhelm Giesecke in Barmen zuerkannt. 8 Preise von
je 400 M. erhielten ferner: A. Winkler und /. Eitzenberger
in Hanau, Bruno Kruse, C. Maass, Fritz Schneider und
Emil Torff in Berlin, Paul Fliegner in Hanau, Eduard
Kämpf/er in Breslau und Ernst Seger in Wilmersdorf.
DENKMÄLER.
A. G. — In Lübeck ist man noch mit der Entscheidung
über das Kaiser Wilhelm-Denkmal beschäftigt. Die Kon-
kurrenz hat zu keinem allgemein befriedigenden Resultat
geführt. Lübeck ist eine Stadt von solch eigenem Charakter,
dass ein Denkmal vom allgemeinen Schlage nicht hinein-
passt. Gerade in dieser Stadt, die von ihrem alten Gepräge
unter den Hansestädten noch am meisten gewahrt hat, sollte
man überaus vorsichtig sein, den Eindruck, den die Stadt
auf Fremde vielleicht noch mehr als auf die Einheimischen
macht, nicht zerstören zu lassen. Eine Konkurrenz wie die
landläufigen kann hier auch kaum ihren Zweck erfüllen.
Man bedarf feinfühliger Künstler, besonders für diesen
Zweck ausgewählt, die man durch eine bestimmte Entschä-
digung der aufgewandten Mühe für das Problem zu in-
teressieren weiss. Das Problem besteht darin, direkt für die
Umgebung zu schaffen, besonders wenn man beabsichtigt,
das Denkmal auf den Markt zu setzen, was vielleicht über-
haupt ein zu gewagtes Unternehmen ist. Ein Denkmal
selbst guter Formen, das für sich gedacht ist, könnte trotz-
dem die Wirkung des Platzes mit dem Rathaus und den
Arkaden stark beeinträchtigen, ja es könnte geradezu zum
Ärger herausfordern; man sollte den Versuch nicht scheuen,
einige wenige Künstler wie Hildebrandt, Tuaillon und Maison
oder auch nur einen derselben, dann wohl Hildebrandt,
dazu zu bewegen, ihre Kraft an die Lösung dieser Aufgabe
zu setzen, und zwar mit bestimmter Vorschrift des Platzes.
Man würde dann vielleicht nicht nur ein neues Kaiserdenkmal
zu den vielen andern hinzufügen, sondern etwas schaffen,
das abgesehen von seiner inhaltlichen Bedeutung ein Vor-
bild für andere würde und die Stadt mit einem ganz be-
sonderen neuen Reiz bereicherte.
*, * Denkmälerchronik. — Dem Bildhauer Emil Cauer
in Berlin ist die Ausführung des Kaiser Friedrich-Denkmals
für Hagen in Westfalen übertragen worden. — Ein Denkmal
des Pädagogen Arnos Comenius soll in seiner Geburtsstadt
Lissa in Posen in Form einer kolossalen Bronzebüste er-
richtet werden. Mit der Ausführung hat das Comite den
Bildhauer Alfred Reichel in Berlin beauftragt. — Der
Bildhauer H. Walger hat ein Denkmal des märkischen
Volksdichters Brunold vollendet, das in der Stadt Joachims-
thal, dem langjährigen Wohnort des Dichters, aufgestellt
werden soll.
A. R. Das der Zeitrechnung nach erste der Standbilder
brandenburgisch-preussischer Herrscher in der Siegesallee in
Berlin, dessen rechtzeitige Vollendung zum 22. März durch
ein bei der Marmorausführung in Carrara vorgekommenes
Missverständnis unmöglich geworden war, ist am 6. Mai
enthüllt worden. Es stellt den ersten in der Reihe der
askanischen Fürsten, Albrecht den Bären, dar, und sein
Schöpfer, Bildhauer Walter Schott, einer der selbständigsten
aus der Schule von R. Begas, hat ihn nicht bloss als Be-
kämpfer und Bezwinger des Heidentums in der Mark auf-
gefasst, sondern mehr noch als Verkünder der neuen Lehre.
Denn er hält in der hoch erhobenen, weit ausgestreckten
Rechten das Kruzifix, während die mit dem Schilde bewehrte
Linke an der entsprechenden Körperseite lässig herab-
hängt. Danach sind auch die die Rückenlehne der Bank
teilenden Nebenfiguren gewählt, zwei geistliche Würden-
träger, die an dem Heilswerke mitgeholfen haben. Links der
hagere Bischof Wiger von Brandenburg, das Urbild eines
entsagungsvollen Glaubensbotens, rechts Bischof Otto von
Bamberg, in dessen behäbigem Angesicht sich der Reichtum