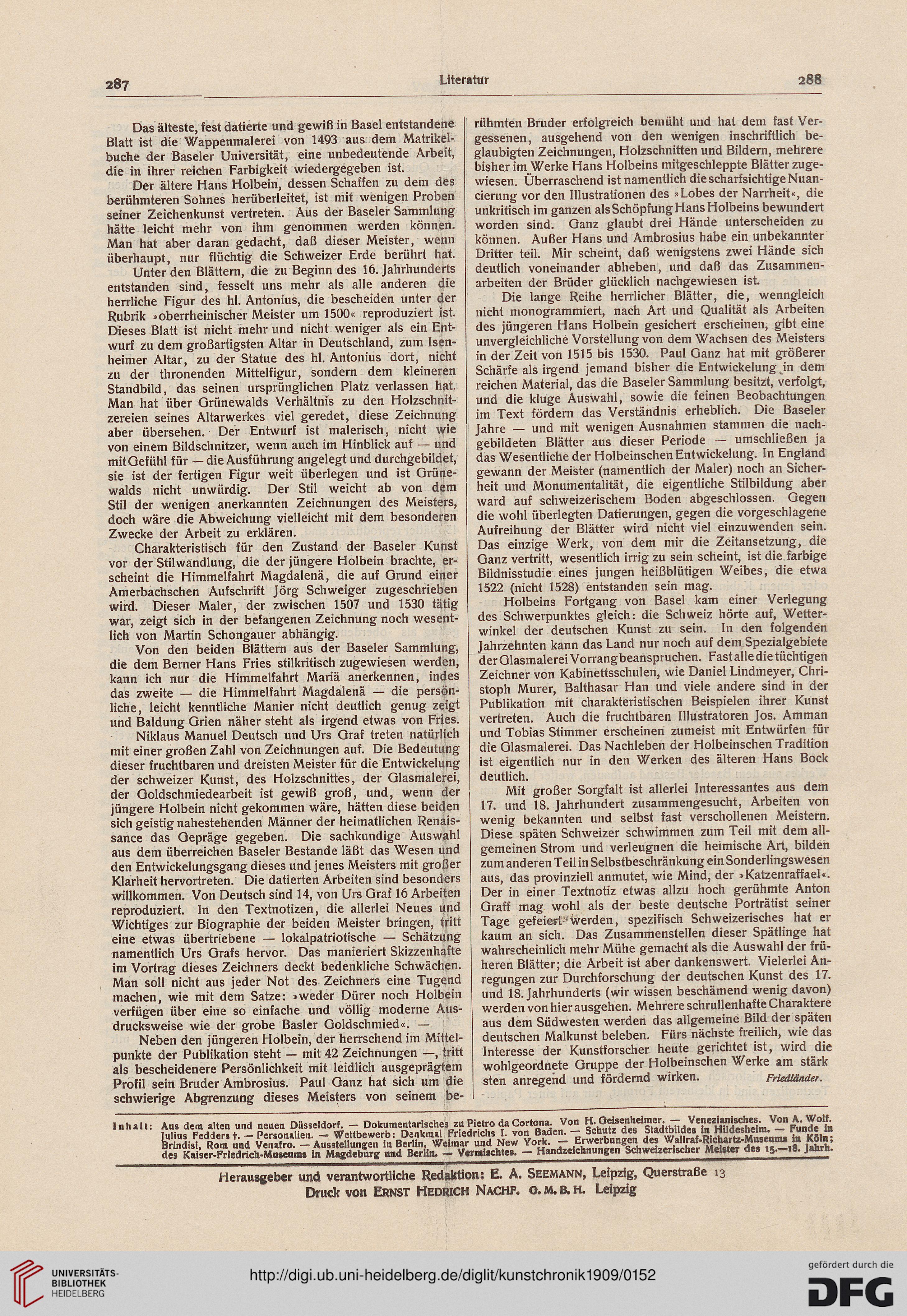287
Literatur
288
Das älteste, fest datierte und gewiß in Basel entstandene
Blatt ist die Wappenmalerei von 1493 aus dem Matrikel-
buche der Baseler Universität, eine unbedeutende Arbeit,
die in ihrer reichen Farbigkeit wiedergegeben ist.
Der ältere Hans Holbein, dessen Schaffen zu dem des
berühmteren Sohnes herüberleitet, ist mit wenigen Proben
seiner Zeichenkunst vertreten. Aus der Baseler Sammlung
hätte leicht mehr von ihm genommen werden können.
Man hat aber daran gedacht, daß dieser Meister, wenn
überhaupt, nur flüchtig die Schweizer Erde berührt hat.
Unter den Blättern, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts
entstanden sind, fesselt uns mehr als alle anderen die
herrliche Figur des hl. Antonius, die bescheiden unter der
Rubrik »oberrheinischer Meister um 1500« reproduziert ist.
Dieses Blatt ist nicht mehr und nicht weniger als ein Ent-
wurf zu dem großartigsten Altar in Deutschland, zum Isen-
heimer Altar, zu der Statue des hl. Antonius dort, nicht
zu der thronenden Mittelfigur, sondern dem kleineren
Standbild, das seinen ursprünglichen Platz verlassen hat.
Man hat über Orünewalds Verhältnis zu den Holzschnit-
zereien seines Altarwerkes viel geredet, diese Zeichnung
aber übersehen. Der Entwurf ist malerisch, nicht wie
von einem Bildschnitzer, wenn auch im Hinblick auf — und
mitQefühl für — die Ausführung angelegt und durchgebildet,
sie ist der fertigen Figur weit überlegen und ist Grüne-
walds nicht unwürdig. Der Stil weicht ab von dem
Stil der wenigen anerkannten Zeichnungen des Meisters,
doch wäre die Abweichung vielleicht mit dem besonderen
Zwecke der Arbeit zu erklären.
Charakteristisch für den Zustand der Baseler Kunst
vor der Stil Wandlung, die der jüngere Holbein brachte, er-
scheint die Himmelfahrt Magdalenä, die auf Grund einer
Amerbachschen Aufschrift Jörg Schweiger zugeschrieben
wird. Dieser Maler, der zwischen 1507 und 1530 tätig
war, zeigt sich in der befangenen Zeichnung noch wesent-
lich von Martin Schongauer abhängig.
Von den beiden Blättern aus der Baseler Sammlung,
die dem Berner Hans Fries stilkritisch zugewiesen werden,
kann ich nur die Himmelfahrt Mariä anerkennen, indes
das zweite — die Himmelfahrt Magdalenä — die persön-
liche, leicht kenntliche Manier nicht deutlich genug zeigt
und Baidung Grien näher steht als irgend etwas von Fries.
Nikiaus Manuel Deutsch und Urs Graf treten natürlich
mit einer großen Zahl von Zeichnungen auf. Die Bedeutung
dieser fruchtbaren und dreisten Meister für die Entwickelung
der schweizer Kunst, des Holzschnittes, der Glasmalerei,
der Goldschmiedearbeit ist gewiß groß, und, wenn der
jüngere Holbein nicht gekommen wäre, hätten diese beiden
sich geistig nahestehenden Männer der heimatlichen Renais-
sance das Gepräge gegeben. Die sachkundige Auswahl
aus dem überreichen Baseler Bestände läßt das Wesen und
den Entwickelungsgang dieses und jenes Meisters mit großer
Klarheit hervortreten. Die datierten Arbeiten sind besonders
willkommen. Von Deutsch sind 14, von Urs Graf 16 Arbeiten
reproduziert. In den Textnotizen, die allerlei Neues und
Wichtiges zur Biographie der beiden Meister bringen, tritt
eine etwas übertriebene — lokalpatriotische — Schätzung
namentlich Urs Grafs hervor. Das manieriert Skizzenhafte
im Vortrag dieses Zeichners deckt bedenkliche Schwächen.
Man soll nicht aus jeder Not des Zeichners eine Tugend
machen, wie mit dem Satze: >weder Dürer noch Holbein
verfügen über eine so einfache und völlig moderne Aus-
drucksweise wie der grobe Basler Goldschmied«. —
Neben den jüngeren Holbein, der herrschend im Mittel-
punkte der Publikation steht — mit 42 Zeichnungen —, tritt
als bescheidenere Persönlichkeit mit leidlich ausgeprägtem
Profil sein Bruder Ambrosius. Paul Ganz hat sich um die
schwierige Abgrenzung dieses Meisters von seinem be-
rühmten Bruder erfolgreich bemüht und hat dem fast Ver-
gessenen, ausgehend von den wenigen inschriftlich be-
glaubigten Zeichnungen, Holzschnitten und Bildern, mehrere
bisher im Werke Hans Holbeins mitgeschleppte Blätter zuge-
wiesen. Überraschend ist namentlich die scharfsichtige Nuan-
cierung vor den Illustrationen des »Lobes der Narrheit«, die
unkritisch im ganzen als Schöpfung Hans Holbeins bewundert
worden sind. Ganz glaubt drei Hände unterscheiden zu
können. Außer Hans und Ambrosius habe ein unbekannter
Dritter teil. Mir scheint, daß wenigstens zwei Hände sich
deutlich voneinander abheben, und daß das Zusammen-
arbeiten der Brüder glücklich nachgewiesen ist.
Die lange Reihe herrlicher Blätter, die, wenngleich
nicht monogrammiert, nach Art und Qualität als Arbeiten
des jüngeren Hans Holbein gesichert erscheinen, gibt eine
unvergleichliche Vorstellung von dem Wachsen des Meisters
in der Zeit von 1515 bis 1530. Paul Ganz hat mit größerer
Schärfe als irgend jemand bisher die Entwickelung Jn dem
reichen Material, das die Baseler Sammlung besitzt, verfolgt,
und die kluge Auswahl, sowie die feinen Beobachtungen
im Text fördern das Verständnis erheblich. Die Baseler
Jahre — und mit wenigen Ausnahmen stammen die nach-
gebildeten Blätter aus dieser Periode — umschließen ja
das Wesentliche der Holbeinschen Entwickelung. In England
gewann der Meister (namentlich der Maler) noch an Sicher-
heit und Monumentalität, die eigentliche Stilbildung aber
ward auf schweizerischem Boden abgeschlossen. Gegen
die wohl überlegten Datierungen, gegen die vorgeschlagene
Aufreihung der Blätter wird nicht viel einzuwenden sein.
Das einzige Werk, von dem mir die Zeitansetzung, die
Ganz vertritt, wesentlich irrig zu sein scheint, ist die farbige
Bildnisstudie eines jungen heißblütigen Weibes, die etwa
1522 (nicht 1528) entstanden sein mag.
Holbeins Fortgang von Basel kam einer Verlegung
des Schwerpunktes gleich: die Schweiz hörte auf, Wetter-
winkel der deutschen Kunst zu sein. In den folgenden
Jahrzehnten kann das Land nur noch auf dem Spezialgebiete
der Glasmalerei Vorrang beanspruchen. Fast alle die tüchtigen
Zeichner von Kabinettsschulen, wie Daniel Lindmeyer, Chri-
stoph Murer, Balthasar Han und viele andere sind in der
Publikation mit charakteristischen Beispielen ihrer Kunst
vertreten. Auch die fruchtbaren Illustratoren Jos. Amman
und Tobias Stimmer erscheinen zumeist mit Entwürfen für
die Glasmalerei. Das Nachleben der Holbeinschen Tradition
ist eigentlich nur in den Werken des älteren Hans Bock
deutlich.
Mit großer Sorgfalt ist allerlei Interessantes aus dem
17. und 18. Jahrhundert zusammengesucht, Arbeiten von
wenig bekannten und selbst fast verschollenen Meistern.
Diese späten Schweizer schwimmen zum Teil mit dem all-
gemeinen Strom und verleugnen die heimische Art, bilden
zum anderen Teil in Selbstbeschränkung ein Sonderlingswesen
aus, das provinziell anmutet, wie Mind, der »Katzenraffael«.
Der in einer Textnotiz etwas allzu hoch gerühmte Anton
Graff mag wohl als der beste deutsche Porträtist seiner
Tage gefeiert11 Werden, spezifisch Schweizerisches hat er
kaum an sich. Das Zusammenstellen dieser Spätlinge hat
wahrscheinlich mehr Mühe gemacht als die Auswahl der frü-
heren Blätter; die Arbeit ist aber dankenswert. Vielerlei An-
regungen zur Durchforschung der deutschen Kunst des 17.
und 18. Jahrhunderts (wir wissen beschämend wenig davon)
werden von hier ausgehen. Mehrere schrullenhafte Charaktere
aus dem Südwesten werden das allgemeine Bild der späten
deutschen Malkunst beleben. Fürs nächste freilich, wie das
Interesse der Kunstforscher heute gerichtet ist, wird die
wohlgeordnete Gruppe der Holbeinschen Werke am stärk
sten anregend und fördernd wirken. Friedländer.
Inhalt: Aas dem alten und neuen Düsseldorf. — Dokumentarisches zu Pietro da Cortona. Von H. Oeisenheimer. — Venezianisches. Von A.Wolf.
Julius Fedderst. — Personalien. — Wettbewerb: Denkmal Friedrichs I. von Baden. — Schutz des Stadtbildes in Hildesheim. — Funde in
Brindisi, Rom und Venafro. — Ausstellungen in Berlin, Weimar und New York. — Erwerbungen des Wallraf-Richartz-Museums in KSln;
des Kaiser-Frledrich-Museums in Magdeburg und Berlin. — Vermischtes. — Handzeichnungen Schweizerischer Meister des 15.—18. Jahrb.
Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13
Druck von Ernst Hedrich Nachf. o.m.b.H. Leipzig
Literatur
288
Das älteste, fest datierte und gewiß in Basel entstandene
Blatt ist die Wappenmalerei von 1493 aus dem Matrikel-
buche der Baseler Universität, eine unbedeutende Arbeit,
die in ihrer reichen Farbigkeit wiedergegeben ist.
Der ältere Hans Holbein, dessen Schaffen zu dem des
berühmteren Sohnes herüberleitet, ist mit wenigen Proben
seiner Zeichenkunst vertreten. Aus der Baseler Sammlung
hätte leicht mehr von ihm genommen werden können.
Man hat aber daran gedacht, daß dieser Meister, wenn
überhaupt, nur flüchtig die Schweizer Erde berührt hat.
Unter den Blättern, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts
entstanden sind, fesselt uns mehr als alle anderen die
herrliche Figur des hl. Antonius, die bescheiden unter der
Rubrik »oberrheinischer Meister um 1500« reproduziert ist.
Dieses Blatt ist nicht mehr und nicht weniger als ein Ent-
wurf zu dem großartigsten Altar in Deutschland, zum Isen-
heimer Altar, zu der Statue des hl. Antonius dort, nicht
zu der thronenden Mittelfigur, sondern dem kleineren
Standbild, das seinen ursprünglichen Platz verlassen hat.
Man hat über Orünewalds Verhältnis zu den Holzschnit-
zereien seines Altarwerkes viel geredet, diese Zeichnung
aber übersehen. Der Entwurf ist malerisch, nicht wie
von einem Bildschnitzer, wenn auch im Hinblick auf — und
mitQefühl für — die Ausführung angelegt und durchgebildet,
sie ist der fertigen Figur weit überlegen und ist Grüne-
walds nicht unwürdig. Der Stil weicht ab von dem
Stil der wenigen anerkannten Zeichnungen des Meisters,
doch wäre die Abweichung vielleicht mit dem besonderen
Zwecke der Arbeit zu erklären.
Charakteristisch für den Zustand der Baseler Kunst
vor der Stil Wandlung, die der jüngere Holbein brachte, er-
scheint die Himmelfahrt Magdalenä, die auf Grund einer
Amerbachschen Aufschrift Jörg Schweiger zugeschrieben
wird. Dieser Maler, der zwischen 1507 und 1530 tätig
war, zeigt sich in der befangenen Zeichnung noch wesent-
lich von Martin Schongauer abhängig.
Von den beiden Blättern aus der Baseler Sammlung,
die dem Berner Hans Fries stilkritisch zugewiesen werden,
kann ich nur die Himmelfahrt Mariä anerkennen, indes
das zweite — die Himmelfahrt Magdalenä — die persön-
liche, leicht kenntliche Manier nicht deutlich genug zeigt
und Baidung Grien näher steht als irgend etwas von Fries.
Nikiaus Manuel Deutsch und Urs Graf treten natürlich
mit einer großen Zahl von Zeichnungen auf. Die Bedeutung
dieser fruchtbaren und dreisten Meister für die Entwickelung
der schweizer Kunst, des Holzschnittes, der Glasmalerei,
der Goldschmiedearbeit ist gewiß groß, und, wenn der
jüngere Holbein nicht gekommen wäre, hätten diese beiden
sich geistig nahestehenden Männer der heimatlichen Renais-
sance das Gepräge gegeben. Die sachkundige Auswahl
aus dem überreichen Baseler Bestände läßt das Wesen und
den Entwickelungsgang dieses und jenes Meisters mit großer
Klarheit hervortreten. Die datierten Arbeiten sind besonders
willkommen. Von Deutsch sind 14, von Urs Graf 16 Arbeiten
reproduziert. In den Textnotizen, die allerlei Neues und
Wichtiges zur Biographie der beiden Meister bringen, tritt
eine etwas übertriebene — lokalpatriotische — Schätzung
namentlich Urs Grafs hervor. Das manieriert Skizzenhafte
im Vortrag dieses Zeichners deckt bedenkliche Schwächen.
Man soll nicht aus jeder Not des Zeichners eine Tugend
machen, wie mit dem Satze: >weder Dürer noch Holbein
verfügen über eine so einfache und völlig moderne Aus-
drucksweise wie der grobe Basler Goldschmied«. —
Neben den jüngeren Holbein, der herrschend im Mittel-
punkte der Publikation steht — mit 42 Zeichnungen —, tritt
als bescheidenere Persönlichkeit mit leidlich ausgeprägtem
Profil sein Bruder Ambrosius. Paul Ganz hat sich um die
schwierige Abgrenzung dieses Meisters von seinem be-
rühmten Bruder erfolgreich bemüht und hat dem fast Ver-
gessenen, ausgehend von den wenigen inschriftlich be-
glaubigten Zeichnungen, Holzschnitten und Bildern, mehrere
bisher im Werke Hans Holbeins mitgeschleppte Blätter zuge-
wiesen. Überraschend ist namentlich die scharfsichtige Nuan-
cierung vor den Illustrationen des »Lobes der Narrheit«, die
unkritisch im ganzen als Schöpfung Hans Holbeins bewundert
worden sind. Ganz glaubt drei Hände unterscheiden zu
können. Außer Hans und Ambrosius habe ein unbekannter
Dritter teil. Mir scheint, daß wenigstens zwei Hände sich
deutlich voneinander abheben, und daß das Zusammen-
arbeiten der Brüder glücklich nachgewiesen ist.
Die lange Reihe herrlicher Blätter, die, wenngleich
nicht monogrammiert, nach Art und Qualität als Arbeiten
des jüngeren Hans Holbein gesichert erscheinen, gibt eine
unvergleichliche Vorstellung von dem Wachsen des Meisters
in der Zeit von 1515 bis 1530. Paul Ganz hat mit größerer
Schärfe als irgend jemand bisher die Entwickelung Jn dem
reichen Material, das die Baseler Sammlung besitzt, verfolgt,
und die kluge Auswahl, sowie die feinen Beobachtungen
im Text fördern das Verständnis erheblich. Die Baseler
Jahre — und mit wenigen Ausnahmen stammen die nach-
gebildeten Blätter aus dieser Periode — umschließen ja
das Wesentliche der Holbeinschen Entwickelung. In England
gewann der Meister (namentlich der Maler) noch an Sicher-
heit und Monumentalität, die eigentliche Stilbildung aber
ward auf schweizerischem Boden abgeschlossen. Gegen
die wohl überlegten Datierungen, gegen die vorgeschlagene
Aufreihung der Blätter wird nicht viel einzuwenden sein.
Das einzige Werk, von dem mir die Zeitansetzung, die
Ganz vertritt, wesentlich irrig zu sein scheint, ist die farbige
Bildnisstudie eines jungen heißblütigen Weibes, die etwa
1522 (nicht 1528) entstanden sein mag.
Holbeins Fortgang von Basel kam einer Verlegung
des Schwerpunktes gleich: die Schweiz hörte auf, Wetter-
winkel der deutschen Kunst zu sein. In den folgenden
Jahrzehnten kann das Land nur noch auf dem Spezialgebiete
der Glasmalerei Vorrang beanspruchen. Fast alle die tüchtigen
Zeichner von Kabinettsschulen, wie Daniel Lindmeyer, Chri-
stoph Murer, Balthasar Han und viele andere sind in der
Publikation mit charakteristischen Beispielen ihrer Kunst
vertreten. Auch die fruchtbaren Illustratoren Jos. Amman
und Tobias Stimmer erscheinen zumeist mit Entwürfen für
die Glasmalerei. Das Nachleben der Holbeinschen Tradition
ist eigentlich nur in den Werken des älteren Hans Bock
deutlich.
Mit großer Sorgfalt ist allerlei Interessantes aus dem
17. und 18. Jahrhundert zusammengesucht, Arbeiten von
wenig bekannten und selbst fast verschollenen Meistern.
Diese späten Schweizer schwimmen zum Teil mit dem all-
gemeinen Strom und verleugnen die heimische Art, bilden
zum anderen Teil in Selbstbeschränkung ein Sonderlingswesen
aus, das provinziell anmutet, wie Mind, der »Katzenraffael«.
Der in einer Textnotiz etwas allzu hoch gerühmte Anton
Graff mag wohl als der beste deutsche Porträtist seiner
Tage gefeiert11 Werden, spezifisch Schweizerisches hat er
kaum an sich. Das Zusammenstellen dieser Spätlinge hat
wahrscheinlich mehr Mühe gemacht als die Auswahl der frü-
heren Blätter; die Arbeit ist aber dankenswert. Vielerlei An-
regungen zur Durchforschung der deutschen Kunst des 17.
und 18. Jahrhunderts (wir wissen beschämend wenig davon)
werden von hier ausgehen. Mehrere schrullenhafte Charaktere
aus dem Südwesten werden das allgemeine Bild der späten
deutschen Malkunst beleben. Fürs nächste freilich, wie das
Interesse der Kunstforscher heute gerichtet ist, wird die
wohlgeordnete Gruppe der Holbeinschen Werke am stärk
sten anregend und fördernd wirken. Friedländer.
Inhalt: Aas dem alten und neuen Düsseldorf. — Dokumentarisches zu Pietro da Cortona. Von H. Oeisenheimer. — Venezianisches. Von A.Wolf.
Julius Fedderst. — Personalien. — Wettbewerb: Denkmal Friedrichs I. von Baden. — Schutz des Stadtbildes in Hildesheim. — Funde in
Brindisi, Rom und Venafro. — Ausstellungen in Berlin, Weimar und New York. — Erwerbungen des Wallraf-Richartz-Museums in KSln;
des Kaiser-Frledrich-Museums in Magdeburg und Berlin. — Vermischtes. — Handzeichnungen Schweizerischer Meister des 15.—18. Jahrb.
Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13
Druck von Ernst Hedrich Nachf. o.m.b.H. Leipzig