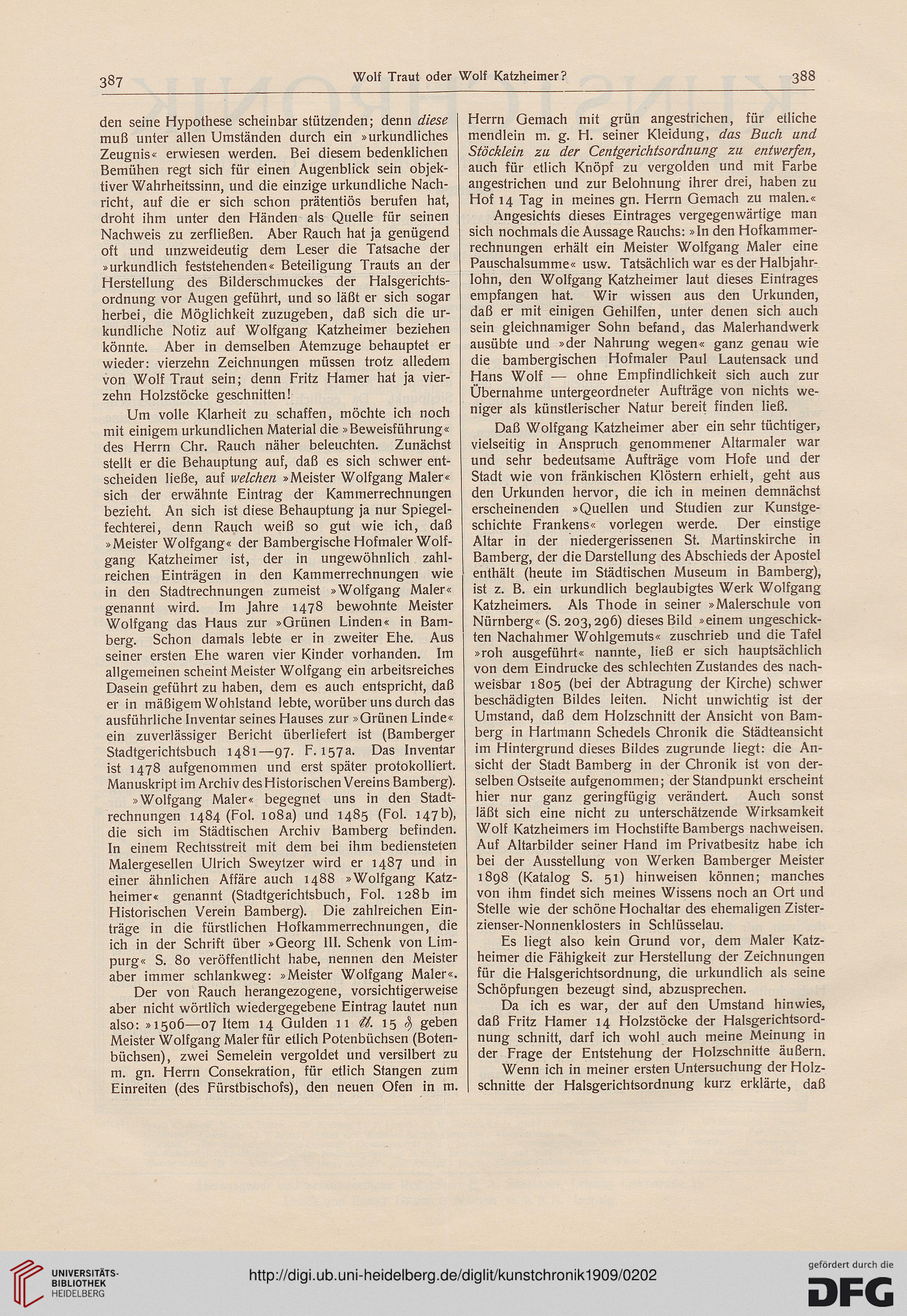387
Wolf Traut oder
Wolf Katzheimer?
388
den seine Hypothese scheinbar stützenden; denn diese
muß unter allen Umständen durch ein »urkundliches
Zeugnis« erwiesen werden. Bei diesem bedenklichen
Bemühen regt sich für einen Augenblick sein objek-
tiver Wahrheitssinn, und die einzige urkundliche Nach-
richt, auf die er sich schon prätentiös berufen hat,
droht ihm unter den Händen als Quelle für seinen
Nachweis zu zerfließen. Aber Rauch hat ja genügend
oft und unzweideutig dem Leser die Tatsache der
»urkundlich feststehenden« Beteiligung Trauts an der
Herstellung des Bilderschmuckes der Halsgerichts-
ordnung vor Augen geführt, und so läßt er sich sogar
herbei, die Möglichkeit zuzugeben, daß sich die ur-
kundliche Notiz auf Wolfgang Katzheimer beziehen
könnte. Aber in demselben Atemzuge behauptet er
wieder: vierzehn Zeichnungen müssen trotz alledem
von Wolf Traut sein; denn Fritz Hamer hat ja vier-
zehn Holzstöcke geschnitten!
Um volle Klarheit zu schaffen, möchte ich noch
mit einigem urkundlichen Material die »Beweisführung«
des Herrn Chr. Rauch näher beleuchten. Zunächst
stellt er die Behauptung auf, daß es sich schwer ent-
scheiden ließe, auf welchen »Meister Wolfgang Maler«
sich der erwähnte Eintrag der Kammerrechnungen
bezieht. An sich ist diese Behauptung ja nur Spiegel-
fechterei, denn Rauch weiß so gut wie ich, daß
»Meister Wolfgang« der Bambergische Hofmaler Wolf-
gang Katzheimer ist, der in ungewöhnlich zahl-
reichen Einträgen in den Kammerrechnungen wie
in den Stadtrechnungen zumeist »Wolfgang Maler«
genannt wird. Im Jahre 1478 bewohnte Meister
Wolfgang das Haus zur »Grünen Linden« in Bam-
berg. Schon damals lebte er in zweiter Ehe. Aus
seiner ersten Ehe waren vier Kinder vorhanden. Im
allgemeinen scheint Meister Wolfgang ein arbeitsreiches
Dasein geführt zu haben, dem es auch entspricht, daß
er in mäßigem Wohlstand lebte, worüber uns durch das
ausführliche Inventar seines Hauses zur »Orünen Linde«
ein zuverlässiger Bericht überliefert ist (Bamberger
Stadtgerichtsbuch 1481—97. F. 157a. Das Inventar
ist 1478 aufgenommen und erst später protokolliert.
Manuskript im Archiv des Historischen Vereins Bamberg).
»Wolfgang Maler« begegnet uns in den Stadt-
rechnungen 1484 (Fol. 108a) und 1485 (Fol. 147b),
die sich im Städtischen Archiv Bamberg befinden.
In einem Rechtsstreit mit dem bei ihm bediensteten
Malergesellen Ulrich Sweylzer wird er 1487 und in
einer ähnlichen Affäre auch 1488 »Wolfgang Katz-
heimer« genannt (Stadtgerichtsbuch, Fol. 128b im
Historischen Verein Bamberg). Die zahlreichen Ein-
träge in die fürstlichen Hofkammerrechnungen, die
ich in der Schrift über »Georg III. Schenk von Lim-
purg« S. 80 veröffentlicht habe, nennen den Meister
aber immer schlankweg: »Meister Wolfgang Maler«.
Der von Rauch herangezogene, vorsichtigerweise
aber nicht wörtlich wiedergegebene Eintrag lautet nun
also: »1506—07 Item 14 Gulden 11 €f. 15 3) geben
Meister Wolfgang Maler für etlich Potenbüchsen (Boten-
büchsen), zwei Semelein vergoldet und versilbert zu
m. gn. Herrn Consekration, für etlich Stangen zum
Einreiten (des Fürstbischofs), den neuen Ofen in m.
Herrn Gemach mit grün angestrichen, für etliche
mendlein m. g. H. seiner Kleidung, das Buch und
Stöcklein zu der Centgerichtsordnung zu entwerfen,
auch für etlich Knöpf zu vergolden und mit Farbe
angestrichen und zur Belohnung ihrer drei, haben zu
Hof 14 Tag in meines gn. Herrn Gemach zu malen.«
Angesichts dieses Eintrages vergegenwärtige man
sich nochmals die Aussage Rauchs: »In den Hofkammer-
rechnungen erhält ein Meister Wolfgang Maler eine
Pauschalsumme« usw. Tatsächlich war es der Halbjahr-
lohn, den Wolfgang Katzheimer laut dieses Eintrages
empfangen hat. Wir wissen aus den Urkunden,
daß er mit einigen Gehilfen, unter denen sich auch
sein gleichnamiger Sohn befand, das Malerhandwerk
ausübte und »der Nahrung wegen« ganz genau wie
die bambergischen Hofmaler Paul Lautensack und
Hans Wolf — ohne Empfindlichkeit sich auch zur
Übernahme untergeordneter Aufträge von nichts we-
niger als künstlerischer Natur bereit finden ließ.
Daß Wolfgang Katzheimer aber ein sehr tüchtiger,
vielseitig in Anspruch genommener Altarmaler war
und sehr bedeutsame Aufträge vom Hofe und der
Stadt wie von fränkischen Klöstern erhielt, geht aus
den Urkunden hervor, die ich in meinen demnächst
erscheinenden »Quellen und Studien zur Kunstge-
schichte Frankens« vorlegen werde. Der einstige
Altar in der niedergerissenen St. Martinskirche in
Bamberg, der die Darstellung des Abschieds der Apostel
enthält (heute im Städtischen Museum in Bamberg),
ist z. B. ein urkundlich beglaubigtes Werk Wolfgang
Katzheimers. Als Thode in seiner »Malerschule von
Nürnberg« (S. 203,2g6) dieses Bild »einem ungeschick-
ten Nachahmer Wohlgemuts« zuschrieb und die Tafel
»roh ausgeführt« nannte, ließ er sich hauptsächlich
von dem Eindrucke des schlechten Zustandes des nach-
weisbar 1805 (bei der Abtragung der Kirche) schwer
beschädigten Bildes leiten. Nicht unwichtig ist der
Umstand, daß dem Holzschnitt der Ansicht von Bam-
berg in Hartmann Schedels Chronik die Städteansicht
im Hintergrund dieses Bildes zugrunde liegt: die An-
sicht der Stadt Bamberg in der Chronik ist von der-
selben Ostseite aufgenommen; der Standpunkt erscheint
hier nur ganz geringfügig verändert. Auch sonst
läßt sich eine nicht zu unterschätzende Wirksamkeit
Wolf Katzheimers im Hochstifte Bambergs nachweisen.
Auf Altarbilder seiner Hand im Privatbesitz habe ich
bei der Ausstellung von Werken Bamberger Meister
1898 (Katalog S. 51) hinweisen können; manches
von ihm findet sich meines Wissens noch an Ort und
Stelle wie der schöne Hochaltar des ehemaligen Zister-
zienser-Nonnenklosters in Schlüsselau.
Es liegt also kein Grund vor, dem Maler Katz-
heimer die Fähigkeit zur Herstellung der Zeichnungen
für die Halsgerichtsordnung, die urkundlich als seine
Schöpfungen bezeugt sind, abzusprechen.
Da ich es war, der auf den Umstand hinwies,
daß Fritz Hamer 14 Holzstöcke der Halsgerichtsord-
nung schnitt, darf ich wohl auch meine Meinung in
der Frage der Entstehung der Holzschnitte äußern.
Wenn ich in meiner ersten Untersuchung der Holz-
schnitte der Halsgerichtsordnung kurz erklärte, daß
Wolf Traut oder
Wolf Katzheimer?
388
den seine Hypothese scheinbar stützenden; denn diese
muß unter allen Umständen durch ein »urkundliches
Zeugnis« erwiesen werden. Bei diesem bedenklichen
Bemühen regt sich für einen Augenblick sein objek-
tiver Wahrheitssinn, und die einzige urkundliche Nach-
richt, auf die er sich schon prätentiös berufen hat,
droht ihm unter den Händen als Quelle für seinen
Nachweis zu zerfließen. Aber Rauch hat ja genügend
oft und unzweideutig dem Leser die Tatsache der
»urkundlich feststehenden« Beteiligung Trauts an der
Herstellung des Bilderschmuckes der Halsgerichts-
ordnung vor Augen geführt, und so läßt er sich sogar
herbei, die Möglichkeit zuzugeben, daß sich die ur-
kundliche Notiz auf Wolfgang Katzheimer beziehen
könnte. Aber in demselben Atemzuge behauptet er
wieder: vierzehn Zeichnungen müssen trotz alledem
von Wolf Traut sein; denn Fritz Hamer hat ja vier-
zehn Holzstöcke geschnitten!
Um volle Klarheit zu schaffen, möchte ich noch
mit einigem urkundlichen Material die »Beweisführung«
des Herrn Chr. Rauch näher beleuchten. Zunächst
stellt er die Behauptung auf, daß es sich schwer ent-
scheiden ließe, auf welchen »Meister Wolfgang Maler«
sich der erwähnte Eintrag der Kammerrechnungen
bezieht. An sich ist diese Behauptung ja nur Spiegel-
fechterei, denn Rauch weiß so gut wie ich, daß
»Meister Wolfgang« der Bambergische Hofmaler Wolf-
gang Katzheimer ist, der in ungewöhnlich zahl-
reichen Einträgen in den Kammerrechnungen wie
in den Stadtrechnungen zumeist »Wolfgang Maler«
genannt wird. Im Jahre 1478 bewohnte Meister
Wolfgang das Haus zur »Grünen Linden« in Bam-
berg. Schon damals lebte er in zweiter Ehe. Aus
seiner ersten Ehe waren vier Kinder vorhanden. Im
allgemeinen scheint Meister Wolfgang ein arbeitsreiches
Dasein geführt zu haben, dem es auch entspricht, daß
er in mäßigem Wohlstand lebte, worüber uns durch das
ausführliche Inventar seines Hauses zur »Orünen Linde«
ein zuverlässiger Bericht überliefert ist (Bamberger
Stadtgerichtsbuch 1481—97. F. 157a. Das Inventar
ist 1478 aufgenommen und erst später protokolliert.
Manuskript im Archiv des Historischen Vereins Bamberg).
»Wolfgang Maler« begegnet uns in den Stadt-
rechnungen 1484 (Fol. 108a) und 1485 (Fol. 147b),
die sich im Städtischen Archiv Bamberg befinden.
In einem Rechtsstreit mit dem bei ihm bediensteten
Malergesellen Ulrich Sweylzer wird er 1487 und in
einer ähnlichen Affäre auch 1488 »Wolfgang Katz-
heimer« genannt (Stadtgerichtsbuch, Fol. 128b im
Historischen Verein Bamberg). Die zahlreichen Ein-
träge in die fürstlichen Hofkammerrechnungen, die
ich in der Schrift über »Georg III. Schenk von Lim-
purg« S. 80 veröffentlicht habe, nennen den Meister
aber immer schlankweg: »Meister Wolfgang Maler«.
Der von Rauch herangezogene, vorsichtigerweise
aber nicht wörtlich wiedergegebene Eintrag lautet nun
also: »1506—07 Item 14 Gulden 11 €f. 15 3) geben
Meister Wolfgang Maler für etlich Potenbüchsen (Boten-
büchsen), zwei Semelein vergoldet und versilbert zu
m. gn. Herrn Consekration, für etlich Stangen zum
Einreiten (des Fürstbischofs), den neuen Ofen in m.
Herrn Gemach mit grün angestrichen, für etliche
mendlein m. g. H. seiner Kleidung, das Buch und
Stöcklein zu der Centgerichtsordnung zu entwerfen,
auch für etlich Knöpf zu vergolden und mit Farbe
angestrichen und zur Belohnung ihrer drei, haben zu
Hof 14 Tag in meines gn. Herrn Gemach zu malen.«
Angesichts dieses Eintrages vergegenwärtige man
sich nochmals die Aussage Rauchs: »In den Hofkammer-
rechnungen erhält ein Meister Wolfgang Maler eine
Pauschalsumme« usw. Tatsächlich war es der Halbjahr-
lohn, den Wolfgang Katzheimer laut dieses Eintrages
empfangen hat. Wir wissen aus den Urkunden,
daß er mit einigen Gehilfen, unter denen sich auch
sein gleichnamiger Sohn befand, das Malerhandwerk
ausübte und »der Nahrung wegen« ganz genau wie
die bambergischen Hofmaler Paul Lautensack und
Hans Wolf — ohne Empfindlichkeit sich auch zur
Übernahme untergeordneter Aufträge von nichts we-
niger als künstlerischer Natur bereit finden ließ.
Daß Wolfgang Katzheimer aber ein sehr tüchtiger,
vielseitig in Anspruch genommener Altarmaler war
und sehr bedeutsame Aufträge vom Hofe und der
Stadt wie von fränkischen Klöstern erhielt, geht aus
den Urkunden hervor, die ich in meinen demnächst
erscheinenden »Quellen und Studien zur Kunstge-
schichte Frankens« vorlegen werde. Der einstige
Altar in der niedergerissenen St. Martinskirche in
Bamberg, der die Darstellung des Abschieds der Apostel
enthält (heute im Städtischen Museum in Bamberg),
ist z. B. ein urkundlich beglaubigtes Werk Wolfgang
Katzheimers. Als Thode in seiner »Malerschule von
Nürnberg« (S. 203,2g6) dieses Bild »einem ungeschick-
ten Nachahmer Wohlgemuts« zuschrieb und die Tafel
»roh ausgeführt« nannte, ließ er sich hauptsächlich
von dem Eindrucke des schlechten Zustandes des nach-
weisbar 1805 (bei der Abtragung der Kirche) schwer
beschädigten Bildes leiten. Nicht unwichtig ist der
Umstand, daß dem Holzschnitt der Ansicht von Bam-
berg in Hartmann Schedels Chronik die Städteansicht
im Hintergrund dieses Bildes zugrunde liegt: die An-
sicht der Stadt Bamberg in der Chronik ist von der-
selben Ostseite aufgenommen; der Standpunkt erscheint
hier nur ganz geringfügig verändert. Auch sonst
läßt sich eine nicht zu unterschätzende Wirksamkeit
Wolf Katzheimers im Hochstifte Bambergs nachweisen.
Auf Altarbilder seiner Hand im Privatbesitz habe ich
bei der Ausstellung von Werken Bamberger Meister
1898 (Katalog S. 51) hinweisen können; manches
von ihm findet sich meines Wissens noch an Ort und
Stelle wie der schöne Hochaltar des ehemaligen Zister-
zienser-Nonnenklosters in Schlüsselau.
Es liegt also kein Grund vor, dem Maler Katz-
heimer die Fähigkeit zur Herstellung der Zeichnungen
für die Halsgerichtsordnung, die urkundlich als seine
Schöpfungen bezeugt sind, abzusprechen.
Da ich es war, der auf den Umstand hinwies,
daß Fritz Hamer 14 Holzstöcke der Halsgerichtsord-
nung schnitt, darf ich wohl auch meine Meinung in
der Frage der Entstehung der Holzschnitte äußern.
Wenn ich in meiner ersten Untersuchung der Holz-
schnitte der Halsgerichtsordnung kurz erklärte, daß