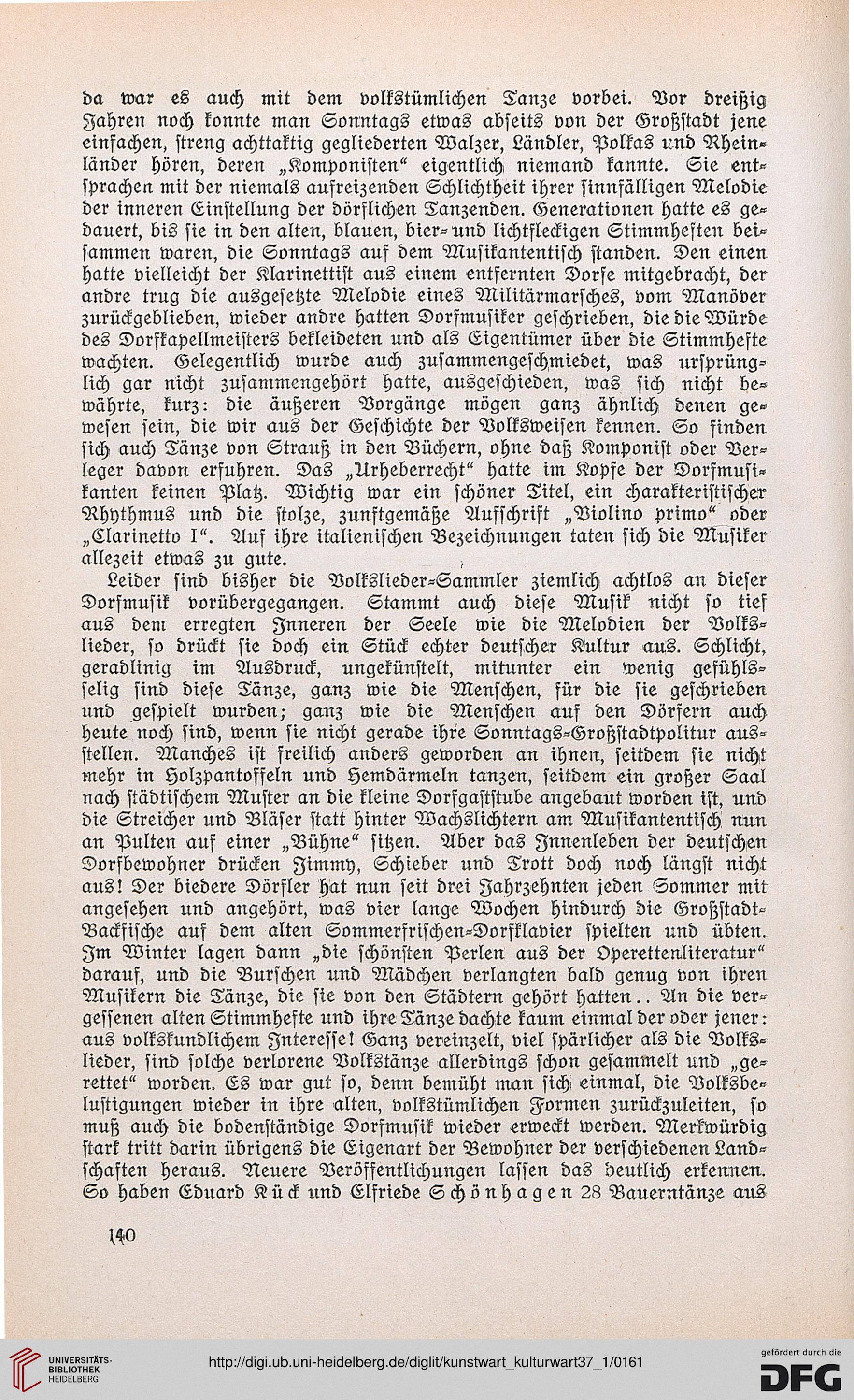da war es auch mit dem volkstümlichen Tanze vorbei. Vor dreißig
Iahren noch konnte man Sonntags etwas abseits von der Großstadt jene
einfachen, streng achttaktig gegliederten Walzer, Ländler, Polkas nnd Rhein-
länder hören, dsren „Komponisten" eigentlich niemand kannte. Sie ent-
sprachen mit der niemals aufreizenden Schlichtheit ihrer sinnfälligen Melodie
der inneren Einstellung der dörflichen Tanzenden. Generationen hatte es ge-
dauert, bis sie in den alten, blauen, bier-und lichtfleckigen Stimmhesten bei--
sammen waren, die Sonntags auf dem Musikantentisch standen. Den einen
hatte vielleicht der Klarinettist aus einem entfernten Dorfe mitgebracht, der
andrs trug die ausgesetzte Melodie eines Militärmarsches, vom Manöver
znrückgebliebsn, wieder andre hatten Dorfmusiker geschrieben, die dieWürde
des Dorfkapellmeisters bekleideten und als Eigentümer über dis Stimmhefte
wachten. Gelegentlich wurde auch zusammengeschmiedet, was nrsprüng-
lich gar nicht zusammengehört hatte, ausgeschieden, was sich nicht be--
währte, kurz: die äußeren Vorgänge mögen ganz ähnlich denen ge--
wesen sein, die wir aus der Geschichte der Volksweisen kennen. So finden
sich auch Tänze von Strauß in den Büchern, ohne daß Komponist oder Ver--
leger davon erfuhren. Das „Arheberrecht" hatte im Kopfe der Dorfmusi-.
kanten keinen Platz. Wichtig war ein schöner Titel, ein charakteristischer
Rhythmns und die stolze, zunftgemäße Aufschrift „Violino primo" oder
„Clarinetto I". Auf ihre italienischeu Bezeichnungen tatsn sich die Musiker
allezeit etwas zu gute.
Leider sind bisher die Volkslisder-Sammler ziemlich achtlos an dieser
Dorfmusik vorübergegangen. Stammt auch diese Musik nicht so tief
aus denr errsgten Inneren der Seele wie die Melodien der Volks-
lieder, so drückt sie doch ein Stück echter deutscher Kultur aus. Schlicht,
geradlinig im Ausdruck, ungekünstelt, mitunter ein wenig gefühls-
selig sind diese Tänze, ganz wie die Menschen, für die sie geschrieben
und gespielt wurdeu; ganz wie die Menschen auf den Dörfern auch
heute noch sind, wenn sie nicht gerade ihre Sonntags-Großstadtpolitur aus-
stellen. Manches ist sreilich anders geworden an ihnen, seitdem sie nicht
mehr in Holzpantoffeln und Hemdärmeln tanzeu, seitdem ein großer Saal
nach städtischem Muster an die kleine Dorfgaststube angebaut worden ist, und
die Streicher und Bläser statt hinter Wachslichtern am Musikantentisch nun
an Pulten auf einer „Bühne" sitzen. Aber das Innenleben der deutschen
Dorfbewohner drücken Iimmy, Schieber und Trott doch noch längst nicht
ausl Der biedere Dörfler hat nun seit drei Iahrzehnten jeden Sommer mit
angesehen und angehört, was visr lange Wochen hindurch die Großstadt-
Backfische auf dem alten Sommerfrischen-Dorfklavier spielten und übten.
Im Winter lagen dann „die schönsten Psrlen aus der Operettenliteratur"
darauf, und die Burschen und Mädchen verlangten bald genug von ihreu
Musikern die Tänze, die sie von den Städtern gehört hatten.. An die ver-
gessenen alten Stimmhefte und ihre Tänze dachte kaum einmal der oder jener:
aus volkskundlichem Interessel Ganz vereinzelt, viel spärlicher als die Volks-
lieder, sind solche verlorene Volkstänze allerdings schon gesammelt und „ge-
rettet" worden. Es war gut so, denn bemüht man sich einmal, die Volksbe-
lustigungen wieder in ihre alten, volkstümlichen Formen zurückzuleiten, so
muß auch die bodenständige Dorfmusik wieder erweckt werden. Merkwürdig
stark tritt darin übrigens die Eigsnart der Bewohner der verschiedenen Land-
schafteu heraus. Neuere Veröffentlichungen lassen das deutlich erkenneu.
So habeu Eduard Kück und Elfriede Schönhagen 28 Bauerntänzs aus
Iahren noch konnte man Sonntags etwas abseits von der Großstadt jene
einfachen, streng achttaktig gegliederten Walzer, Ländler, Polkas nnd Rhein-
länder hören, dsren „Komponisten" eigentlich niemand kannte. Sie ent-
sprachen mit der niemals aufreizenden Schlichtheit ihrer sinnfälligen Melodie
der inneren Einstellung der dörflichen Tanzenden. Generationen hatte es ge-
dauert, bis sie in den alten, blauen, bier-und lichtfleckigen Stimmhesten bei--
sammen waren, die Sonntags auf dem Musikantentisch standen. Den einen
hatte vielleicht der Klarinettist aus einem entfernten Dorfe mitgebracht, der
andrs trug die ausgesetzte Melodie eines Militärmarsches, vom Manöver
znrückgebliebsn, wieder andre hatten Dorfmusiker geschrieben, die dieWürde
des Dorfkapellmeisters bekleideten und als Eigentümer über dis Stimmhefte
wachten. Gelegentlich wurde auch zusammengeschmiedet, was nrsprüng-
lich gar nicht zusammengehört hatte, ausgeschieden, was sich nicht be--
währte, kurz: die äußeren Vorgänge mögen ganz ähnlich denen ge--
wesen sein, die wir aus der Geschichte der Volksweisen kennen. So finden
sich auch Tänze von Strauß in den Büchern, ohne daß Komponist oder Ver--
leger davon erfuhren. Das „Arheberrecht" hatte im Kopfe der Dorfmusi-.
kanten keinen Platz. Wichtig war ein schöner Titel, ein charakteristischer
Rhythmns und die stolze, zunftgemäße Aufschrift „Violino primo" oder
„Clarinetto I". Auf ihre italienischeu Bezeichnungen tatsn sich die Musiker
allezeit etwas zu gute.
Leider sind bisher die Volkslisder-Sammler ziemlich achtlos an dieser
Dorfmusik vorübergegangen. Stammt auch diese Musik nicht so tief
aus denr errsgten Inneren der Seele wie die Melodien der Volks-
lieder, so drückt sie doch ein Stück echter deutscher Kultur aus. Schlicht,
geradlinig im Ausdruck, ungekünstelt, mitunter ein wenig gefühls-
selig sind diese Tänze, ganz wie die Menschen, für die sie geschrieben
und gespielt wurdeu; ganz wie die Menschen auf den Dörfern auch
heute noch sind, wenn sie nicht gerade ihre Sonntags-Großstadtpolitur aus-
stellen. Manches ist sreilich anders geworden an ihnen, seitdem sie nicht
mehr in Holzpantoffeln und Hemdärmeln tanzeu, seitdem ein großer Saal
nach städtischem Muster an die kleine Dorfgaststube angebaut worden ist, und
die Streicher und Bläser statt hinter Wachslichtern am Musikantentisch nun
an Pulten auf einer „Bühne" sitzen. Aber das Innenleben der deutschen
Dorfbewohner drücken Iimmy, Schieber und Trott doch noch längst nicht
ausl Der biedere Dörfler hat nun seit drei Iahrzehnten jeden Sommer mit
angesehen und angehört, was visr lange Wochen hindurch die Großstadt-
Backfische auf dem alten Sommerfrischen-Dorfklavier spielten und übten.
Im Winter lagen dann „die schönsten Psrlen aus der Operettenliteratur"
darauf, und die Burschen und Mädchen verlangten bald genug von ihreu
Musikern die Tänze, die sie von den Städtern gehört hatten.. An die ver-
gessenen alten Stimmhefte und ihre Tänze dachte kaum einmal der oder jener:
aus volkskundlichem Interessel Ganz vereinzelt, viel spärlicher als die Volks-
lieder, sind solche verlorene Volkstänze allerdings schon gesammelt und „ge-
rettet" worden. Es war gut so, denn bemüht man sich einmal, die Volksbe-
lustigungen wieder in ihre alten, volkstümlichen Formen zurückzuleiten, so
muß auch die bodenständige Dorfmusik wieder erweckt werden. Merkwürdig
stark tritt darin übrigens die Eigsnart der Bewohner der verschiedenen Land-
schafteu heraus. Neuere Veröffentlichungen lassen das deutlich erkenneu.
So habeu Eduard Kück und Elfriede Schönhagen 28 Bauerntänzs aus