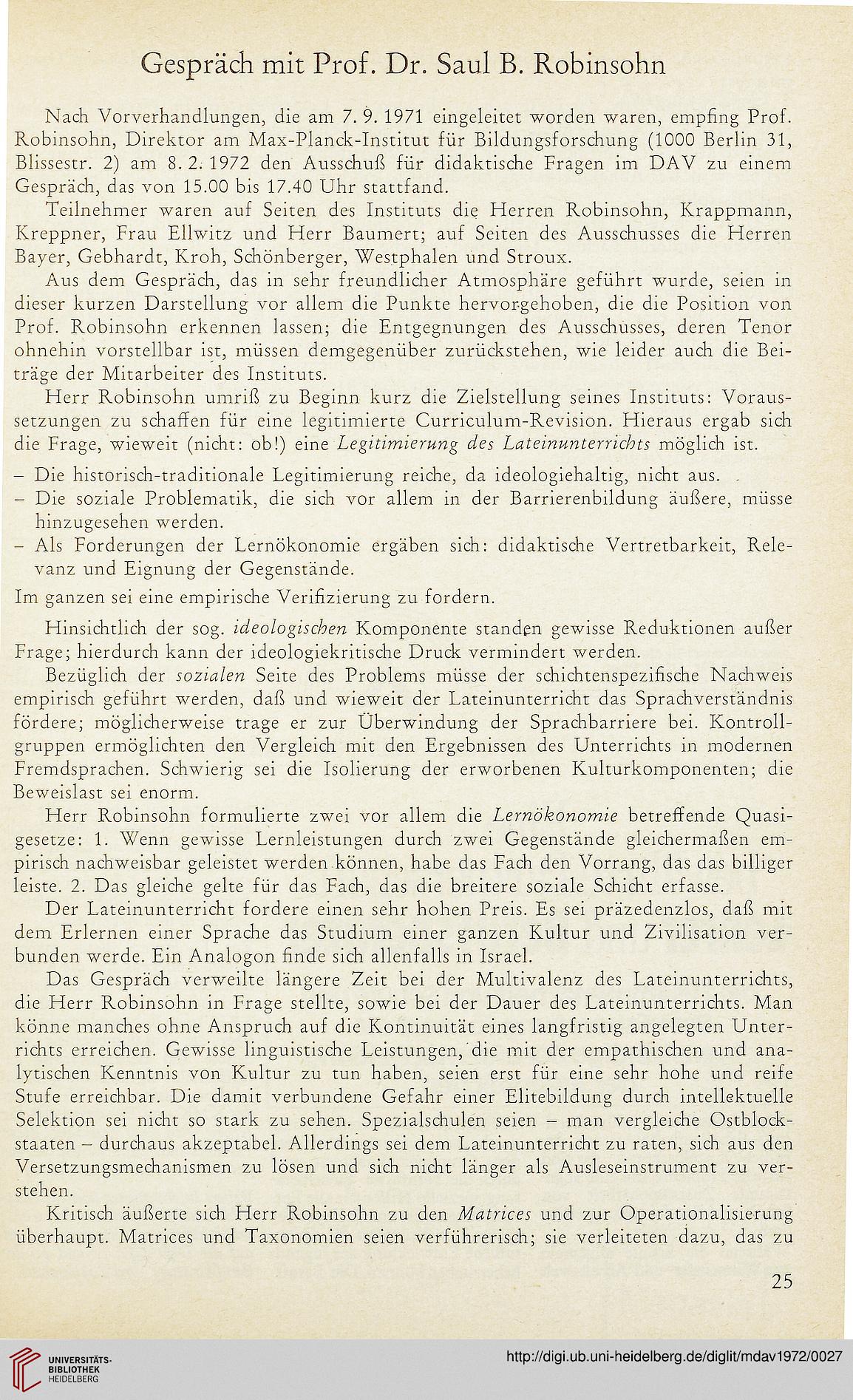Gespräch mit Prof. Dr. Saul B. Robinsohn
Nach Vorverhandlungen, die am 7. 9. 1971 eingeleitet worden waren, empfing Prof.
Robinsohn, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (1000 Berlin 31,
Blissestr. 2) am 8. 2. 1972 den Ausschuß für didaktische Fragen im DAV zu einem
Gespräch, das von 15.00 bis 17.40 Uhr stattfand.
Teilnehmer waren auf Seiten des Instituts die Herren Robinsohn, Krappmann,
Kreppner, Frau Ellwitz und Herr Baumert; auf Seiten des Ausschusses die Herren
Bayer, Gebhardt, Kroh, Schönberger, Westphalen und Stroux.
Aus dem Gespräch, das in sehr freundlicher Atmosphäre geführt wurde, seien in
dieser kurzen Darstellung vor allem die Punkte hervor-gehoben, die die Position von
Prof. Robinsohn erkennen lassen; die Entgegnungen des Ausschusses, deren Tenor
ohnehin vorstellbar ist, müssen demgegenüber zurückstehen, wie leider auch die Bei-
träge der Mitarbeiter des Instituts.
Herr Robinsohn umriß zu Beginn kurz die Zielstellung seines Instituts: Voraus-
setzungen zu schaffen für eine legitimierte Curriculum-Revision. Hieraus ergab sich
die Frage, wieweit (nicht: ob!) eint Legitimierung des Lateinunterrichts möglich ist.
- Die historisch-traditionale Legitimierung reiche, da ideologiehaltig, nicht aus. .
- Die soziale Problematik, die sich vor allem in der Barrierenbildung äußere, müsse
hinzugesehen werden.
- Als Forderungen der Lernökonomie ergäben sich: didaktische Vertretbarkeit, Rele-
vanz und Eignung der Gegenstände.
Im ganzen sei eine empirische Verifizierung zu fordern.
Hinsichtlich der sog. ideologischen Komponente standen gewisse Reduktionen außer
Frage; hierdurch kann der ideologiekritische Druck vermindert werden.
Bezüglich der sozialen Seite des Problems müsse der schichtenspezifische Nachweis
empirisch geführt werden, daß und wieweit der Lateinunterricht das Sprachverständnis
fördere; möglicherweise trage er zur Überwindung der Sprachbarriere bei. Kontroll-
gruppen ermöglichten den Vergleich mit den Ergebnissen des Unterrichts in modernen
Fremdsprachen. Schwierig sei die Isolierung der erworbenen Kulturkomponenten; die
Beweislast sei enorm.
Herr Robinsohn formulierte zwei vor allem die Lernökonomie betreffende Quasi-
gesetze: 1. Wenn gewisse Lernleistungen durch zwei Gegenstände gleichermaßen em-
pirisch nachweisbar geleistet werden können, habe das Fach den Vorrang, das das billiger
leiste. 2. Das gleiche gelte für das Fach, das die breitere soziale Schicht erfasse.
Der Lateinunterricht fordere einen sehr hohen Preis. Es sei präzedenzlos, daß mit
dem Erlernen einer Sprache das Studium einer ganzen Kultur und Zivilisation ver-
bunden werde. Ein Analogon finde sich allenfalls in Israel.
Das Gespräch verweilte längere Zeit bei der Multivalenz des Lateinunterrichts,
die Herr Robinsohn in Frage stellte, sowie bei der Dauer des Lateinunterrichts. Man
könne manches ohne Anspruch auf die Kontinuität eines langfristig angelegten Unter-
richts erreichen. Gewisse linguistische Leistungen, die mit der empathischen und ana-
lytischen Kenntnis von Kultur zu tun haben, seien erst für eine sehr hohe und reife
Stufe erreichbar. Die damit verbundene Gefahr einer Elitebildung durch intellektuelle
Selektion sei nicht so stark zu sehen. Spezialschulen seien - man vergleiche Ostblock-
staaten - durchaus akzeptabel. Allerdings sei dem Lateinunterricht zu raten, sich aus den
Versetzungsmechanismen zu lösen und sich nicht länger als Ausleseinstrument zu ver-
stehen.
Kritisch äußerte sich Herr Robinsohn zu den Matrices und zur Operationalisierung
überhaupt. Matrices und Taxonomien seien verführerisch; sie verleiteten dazu, das zu
25
Nach Vorverhandlungen, die am 7. 9. 1971 eingeleitet worden waren, empfing Prof.
Robinsohn, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (1000 Berlin 31,
Blissestr. 2) am 8. 2. 1972 den Ausschuß für didaktische Fragen im DAV zu einem
Gespräch, das von 15.00 bis 17.40 Uhr stattfand.
Teilnehmer waren auf Seiten des Instituts die Herren Robinsohn, Krappmann,
Kreppner, Frau Ellwitz und Herr Baumert; auf Seiten des Ausschusses die Herren
Bayer, Gebhardt, Kroh, Schönberger, Westphalen und Stroux.
Aus dem Gespräch, das in sehr freundlicher Atmosphäre geführt wurde, seien in
dieser kurzen Darstellung vor allem die Punkte hervor-gehoben, die die Position von
Prof. Robinsohn erkennen lassen; die Entgegnungen des Ausschusses, deren Tenor
ohnehin vorstellbar ist, müssen demgegenüber zurückstehen, wie leider auch die Bei-
träge der Mitarbeiter des Instituts.
Herr Robinsohn umriß zu Beginn kurz die Zielstellung seines Instituts: Voraus-
setzungen zu schaffen für eine legitimierte Curriculum-Revision. Hieraus ergab sich
die Frage, wieweit (nicht: ob!) eint Legitimierung des Lateinunterrichts möglich ist.
- Die historisch-traditionale Legitimierung reiche, da ideologiehaltig, nicht aus. .
- Die soziale Problematik, die sich vor allem in der Barrierenbildung äußere, müsse
hinzugesehen werden.
- Als Forderungen der Lernökonomie ergäben sich: didaktische Vertretbarkeit, Rele-
vanz und Eignung der Gegenstände.
Im ganzen sei eine empirische Verifizierung zu fordern.
Hinsichtlich der sog. ideologischen Komponente standen gewisse Reduktionen außer
Frage; hierdurch kann der ideologiekritische Druck vermindert werden.
Bezüglich der sozialen Seite des Problems müsse der schichtenspezifische Nachweis
empirisch geführt werden, daß und wieweit der Lateinunterricht das Sprachverständnis
fördere; möglicherweise trage er zur Überwindung der Sprachbarriere bei. Kontroll-
gruppen ermöglichten den Vergleich mit den Ergebnissen des Unterrichts in modernen
Fremdsprachen. Schwierig sei die Isolierung der erworbenen Kulturkomponenten; die
Beweislast sei enorm.
Herr Robinsohn formulierte zwei vor allem die Lernökonomie betreffende Quasi-
gesetze: 1. Wenn gewisse Lernleistungen durch zwei Gegenstände gleichermaßen em-
pirisch nachweisbar geleistet werden können, habe das Fach den Vorrang, das das billiger
leiste. 2. Das gleiche gelte für das Fach, das die breitere soziale Schicht erfasse.
Der Lateinunterricht fordere einen sehr hohen Preis. Es sei präzedenzlos, daß mit
dem Erlernen einer Sprache das Studium einer ganzen Kultur und Zivilisation ver-
bunden werde. Ein Analogon finde sich allenfalls in Israel.
Das Gespräch verweilte längere Zeit bei der Multivalenz des Lateinunterrichts,
die Herr Robinsohn in Frage stellte, sowie bei der Dauer des Lateinunterrichts. Man
könne manches ohne Anspruch auf die Kontinuität eines langfristig angelegten Unter-
richts erreichen. Gewisse linguistische Leistungen, die mit der empathischen und ana-
lytischen Kenntnis von Kultur zu tun haben, seien erst für eine sehr hohe und reife
Stufe erreichbar. Die damit verbundene Gefahr einer Elitebildung durch intellektuelle
Selektion sei nicht so stark zu sehen. Spezialschulen seien - man vergleiche Ostblock-
staaten - durchaus akzeptabel. Allerdings sei dem Lateinunterricht zu raten, sich aus den
Versetzungsmechanismen zu lösen und sich nicht länger als Ausleseinstrument zu ver-
stehen.
Kritisch äußerte sich Herr Robinsohn zu den Matrices und zur Operationalisierung
überhaupt. Matrices und Taxonomien seien verführerisch; sie verleiteten dazu, das zu
25