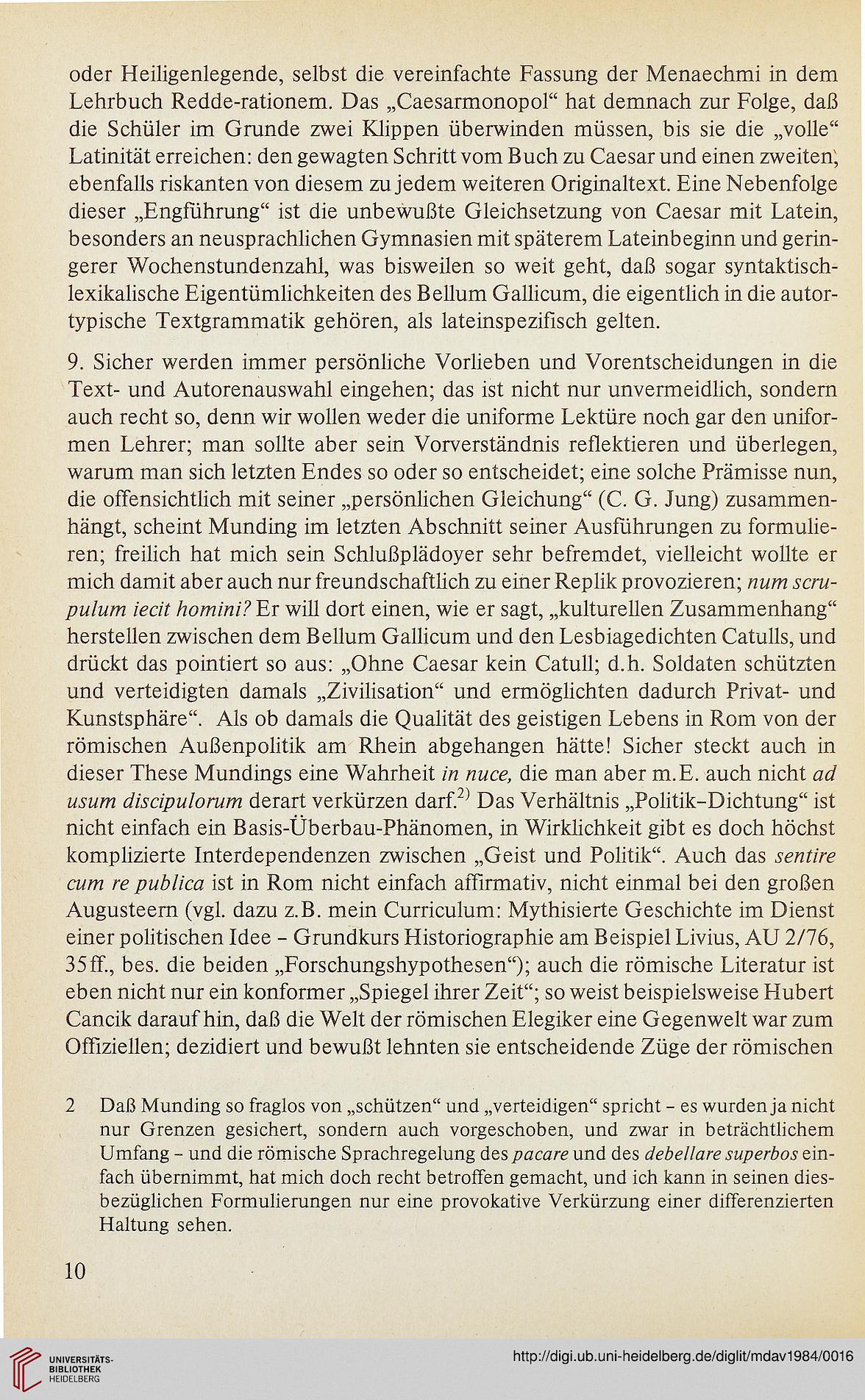oder Heiligenlegende, selbst die vereinfachte Fassung der Menaechmi in dem
Lehrbuch Redde-rationem. Das „Caesarmonopol“ hat demnach zur Folge, daß
die Schüler im Grunde zwei Klippen überwinden müssen, bis sie die „volle“
Latinität erreichen: den gewagten Schritt vom Buch zu Caesar und einen zweiten,
ebenfalls riskanten von diesem zu jedem weiteren Originaltext. Eine Nebenfolge
dieser „Engführung“ ist die unbewußte Gleichsetzung von Caesar mit Latein,
besonders an neusprachlichen Gymnasien mit späterem Lateinbeginn und gerin-
gerer Wochenstundenzahl, was bisweilen so weit geht, daß sogar syntaktisch-
lexikalische Eigentümlichkeiten des Bellum Gallicum, die eigentlich in die autor-
typische Textgrammatik gehören, als lateinspezifisch gelten.
9. Sicher werden immer persönliche Vorlieben und Vorentscheidungen in die
Text- und Autorenauswahl eingehen; das ist nicht nur unvermeidlich, sondern
auch recht so, denn wir wollen weder die uniforme Lektüre noch gar den unifor-
men Lehrer; man sollte aber sein Vorverständnis reflektieren und überlegen,
warum man sich letzten Endes so oder so entscheidet; eine solche Prämisse nun,
die offensichtlich mit seiner „persönlichen Gleichung“ (C. G. Jung) zusammen-
hängt, scheint Munding im letzten Abschnitt seiner Ausführungen zu formulie-
ren; freilich hat mich sein Schlußplädoyer sehr befremdet, vielleicht wollte er
mich damit aber auch nur freundschaftlich zu einer Replik provozieren; num scru-
pulum iecit homini? Er will dort einen, wie er sagt, „kulturellen Zusammenhang“
hersteilen zwischen dem Bellum Gallicum und den Lesbiagedichten Catulls, und
drückt das pointiert so aus: „Ohne Caesar kein Catull; d.h. Soldaten schützten
und verteidigten damals „Zivilisation“ und ermöglichten dadurch Privat- und
Kunstsphäre“. Als ob damals die Qualität des geistigen Lebens in Rom von der
römischen Außenpolitik am Rhein abgehangen hätte! Sicher steckt auch in
dieser These Mundings eine Wahrheit in nuce, die man aber m.E. auch nicht ad
usum discipulorum derart verkürzen darf.21 Das Verhältnis „Politik-Dichtung“ ist
nicht einfach ein Basis-Überbau-Phänomen, in Wirklichkeit gibt es doch höchst
komplizierte Interdependenzen zwischen „Geist und Politik“. Auch das sentire
cum re publica ist in Rom nicht einfach affirmativ, nicht einmal bei den großen
Augusteem (vgl. dazu z.B. mein Curriculum: Mythisierte Geschichte im Dienst
einer politischen Idee - Grundkurs Historiographie am Beispiel Livius, AU 2/76,
35ff., bes. die beiden „Forschungshypothesen“); auch die römische Literatur ist
eben nicht nur ein konformer „Spiegel ihrer Zeit“; so weist beispielsweise Hubert
Cancik daraufhin, daß die Welt der römischen Elegiker eine Gegenwelt war zum
Offiziellen; dezidiert und bewußt lehnten sie entscheidende Züge der römischen
2 Daß Munding so fraglos von „schützen“ und „verteidigen“ spricht - es wurden ja nicht
nur Grenzen gesichert, sondern auch vorgeschoben, und zwar in beträchtlichem
Umfang - und die römische Sprachregelung des pacare und des debellare superbos ein-
fach übernimmt, hat mich doch recht betroffen gemacht, und ich kann in seinen dies-
bezüglichen Formulierungen nur eine provokative Verkürzung einer differenzierten
Haltung sehen.
10
Lehrbuch Redde-rationem. Das „Caesarmonopol“ hat demnach zur Folge, daß
die Schüler im Grunde zwei Klippen überwinden müssen, bis sie die „volle“
Latinität erreichen: den gewagten Schritt vom Buch zu Caesar und einen zweiten,
ebenfalls riskanten von diesem zu jedem weiteren Originaltext. Eine Nebenfolge
dieser „Engführung“ ist die unbewußte Gleichsetzung von Caesar mit Latein,
besonders an neusprachlichen Gymnasien mit späterem Lateinbeginn und gerin-
gerer Wochenstundenzahl, was bisweilen so weit geht, daß sogar syntaktisch-
lexikalische Eigentümlichkeiten des Bellum Gallicum, die eigentlich in die autor-
typische Textgrammatik gehören, als lateinspezifisch gelten.
9. Sicher werden immer persönliche Vorlieben und Vorentscheidungen in die
Text- und Autorenauswahl eingehen; das ist nicht nur unvermeidlich, sondern
auch recht so, denn wir wollen weder die uniforme Lektüre noch gar den unifor-
men Lehrer; man sollte aber sein Vorverständnis reflektieren und überlegen,
warum man sich letzten Endes so oder so entscheidet; eine solche Prämisse nun,
die offensichtlich mit seiner „persönlichen Gleichung“ (C. G. Jung) zusammen-
hängt, scheint Munding im letzten Abschnitt seiner Ausführungen zu formulie-
ren; freilich hat mich sein Schlußplädoyer sehr befremdet, vielleicht wollte er
mich damit aber auch nur freundschaftlich zu einer Replik provozieren; num scru-
pulum iecit homini? Er will dort einen, wie er sagt, „kulturellen Zusammenhang“
hersteilen zwischen dem Bellum Gallicum und den Lesbiagedichten Catulls, und
drückt das pointiert so aus: „Ohne Caesar kein Catull; d.h. Soldaten schützten
und verteidigten damals „Zivilisation“ und ermöglichten dadurch Privat- und
Kunstsphäre“. Als ob damals die Qualität des geistigen Lebens in Rom von der
römischen Außenpolitik am Rhein abgehangen hätte! Sicher steckt auch in
dieser These Mundings eine Wahrheit in nuce, die man aber m.E. auch nicht ad
usum discipulorum derart verkürzen darf.21 Das Verhältnis „Politik-Dichtung“ ist
nicht einfach ein Basis-Überbau-Phänomen, in Wirklichkeit gibt es doch höchst
komplizierte Interdependenzen zwischen „Geist und Politik“. Auch das sentire
cum re publica ist in Rom nicht einfach affirmativ, nicht einmal bei den großen
Augusteem (vgl. dazu z.B. mein Curriculum: Mythisierte Geschichte im Dienst
einer politischen Idee - Grundkurs Historiographie am Beispiel Livius, AU 2/76,
35ff., bes. die beiden „Forschungshypothesen“); auch die römische Literatur ist
eben nicht nur ein konformer „Spiegel ihrer Zeit“; so weist beispielsweise Hubert
Cancik daraufhin, daß die Welt der römischen Elegiker eine Gegenwelt war zum
Offiziellen; dezidiert und bewußt lehnten sie entscheidende Züge der römischen
2 Daß Munding so fraglos von „schützen“ und „verteidigen“ spricht - es wurden ja nicht
nur Grenzen gesichert, sondern auch vorgeschoben, und zwar in beträchtlichem
Umfang - und die römische Sprachregelung des pacare und des debellare superbos ein-
fach übernimmt, hat mich doch recht betroffen gemacht, und ich kann in seinen dies-
bezüglichen Formulierungen nur eine provokative Verkürzung einer differenzierten
Haltung sehen.
10