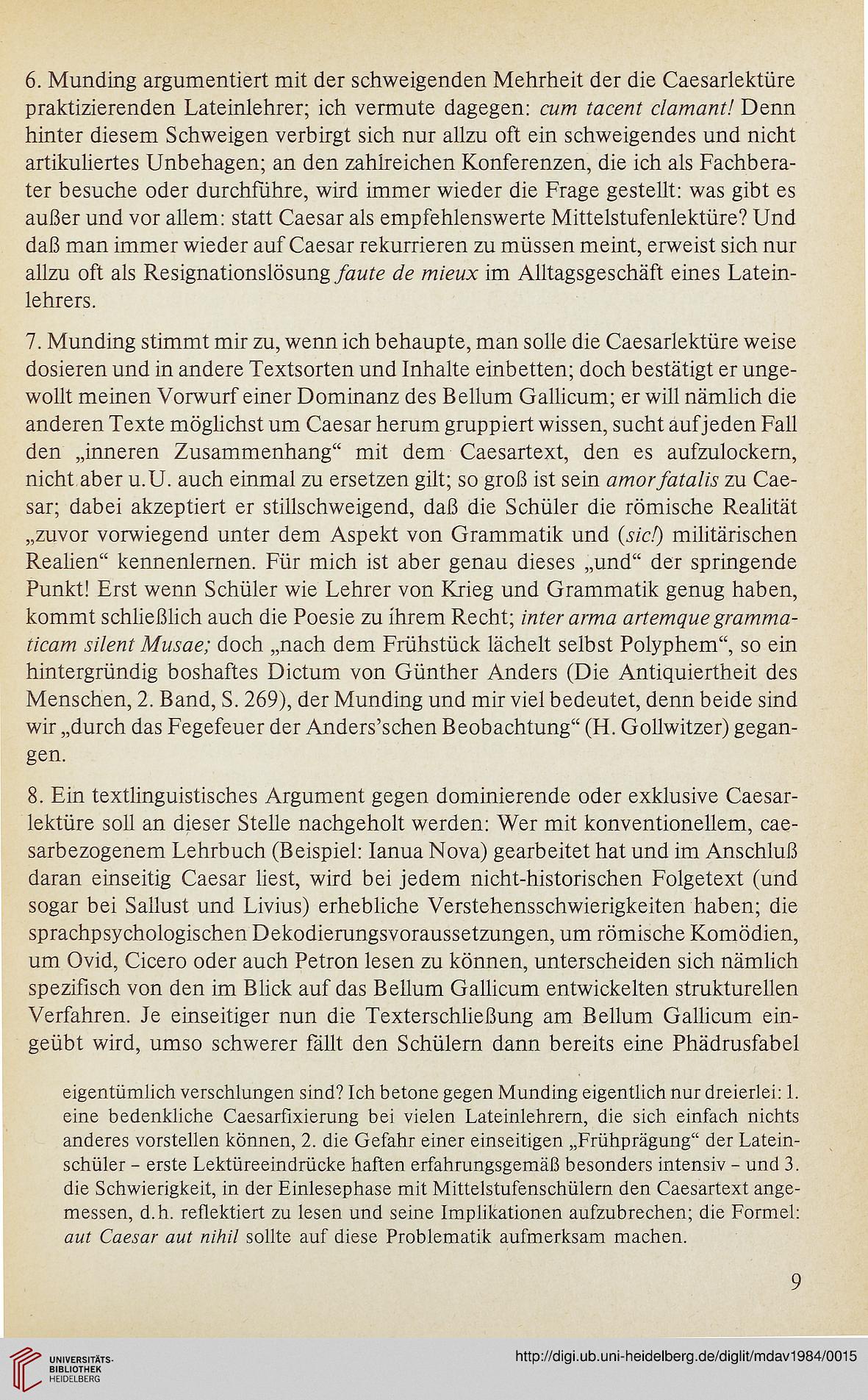6. Munding argumentiert mit der schweigenden Mehrheit der die Caesarlektüre
praktizierenden Lateinlehrer; ich vermute dagegen: cum tacent clamant! Denn
hinter diesem Schweigen verbirgt sich nur allzu oft ein schweigendes und nicht
artikuliertes Unbehagen; an den zahlreichen Konferenzen, die ich als Fachbera-
ter besuche oder durchführe, wird immer wieder die Frage gestellt: was gibt es
außer und vor allem: statt Caesar als empfehlenswerte Mittelstufenlektüre? Und
daß man immer wieder auf Caesar rekurrieren zu müssen meint, erweist sich nur
allzu oft als Resignationslösung faute de mieux im Alltagsgeschäft eines Latein-
lehrers.
7. Munding stimmt mir zu, wenn ich behaupte, man solle die Caesarlektüre weise
dosieren und in andere Textsorten und Inhalte einbetten; doch bestätigt er unge-
wollt meinen Vorwurf einer Dominanz des Bellum Gallicum; er will nämlich die
anderen Texte möglichst um Caesar herum gruppiert wissen, sucht auf jeden Fall
den „inneren Zusammenhang“ mit dem Caesartext, den es aufzulockem,
nicht aber u.U. auch einmal zu ersetzen gilt; so groß ist sein amorfatalis zu Cae-
sar; dabei akzeptiert er stillschweigend, daß die Schüler die römische Realität
„zuvor vorwiegend unter dem Aspekt von Grammatik und (sic!) militärischen
Realien“ kennenlemen. Für mich ist aber genau dieses „und“ der springende
Punkt! Erst wenn Schüler wie Lehrer von Krieg und Grammatik genug haben,
kommt schließlich auch die Poesie zu ihrem Recht; interarma artemque gramma-
ticam silent Musae; doch „nach dem Frühstück lächelt selbst Polyphem“, so ein
hintergründig boshaftes Dictum von Günther Anders (Die Antiquiertheit des
Menschen, 2. Band, S. 269), der Munding und mir viel bedeutet, denn beide sind
wir „durch das Fegefeuer der Anders’schen Beobachtung“ (H. Gollwitzer) gegan-
gen.
8. Ein textlinguistisches Argument gegen dominierende oder exklusive Caesar-
lektüre soll an dieser Stelle nachgeholt werden: Wer mit konventionellem, cae-
sarbezogenem Lehrbuch (Beispiel: Ianua Nova) gearbeitet hat und im Anschluß
daran einseitig Caesar liest, wird bei jedem nicht-historischen Folgetext (und
sogar bei Sallust und Livius) erhebliche Verstehensschwierigkeiten haben; die
sprachpsychologischen Dekodierungsvoraussetzungen, um römische Komödien,
um Ovid, Cicero oder auch Petron lesen zu können, unterscheiden sich nämlich
spezifisch von den im Blick auf das Bellum Gallicum entwickelten strukturellen
Verfahren. Je einseitiger nun die Texterschließung am Bellum Gallicum ein-
geübt wird, umso schwerer fällt den Schülern dann bereits eine Phädrusfabel
eigentümlich verschlungen sind? Ich betone gegen Munding eigentlich nur dreierlei: 1.
eine bedenkliche Caesarfixierung bei vielen Lateinlehrem, die sich einfach nichts
anderes vorstellen können, 2. die Gefahr einer einseitigen „Frühprägung“ der Latein-
schüler - erste Lektüreeindrücke haften erfahrungsgemäß besonders intensiv - und 3.
die Schwierigkeit, in der Einlesephase mit Mittelstufenschülem den Caesartext ange-
messen, d.h. reflektiert zu lesen und seine Implikationen aufzubrechen; die Formel:
aut Caesar aut nihil sollte auf diese Problematik aufmerksam machen.
9
praktizierenden Lateinlehrer; ich vermute dagegen: cum tacent clamant! Denn
hinter diesem Schweigen verbirgt sich nur allzu oft ein schweigendes und nicht
artikuliertes Unbehagen; an den zahlreichen Konferenzen, die ich als Fachbera-
ter besuche oder durchführe, wird immer wieder die Frage gestellt: was gibt es
außer und vor allem: statt Caesar als empfehlenswerte Mittelstufenlektüre? Und
daß man immer wieder auf Caesar rekurrieren zu müssen meint, erweist sich nur
allzu oft als Resignationslösung faute de mieux im Alltagsgeschäft eines Latein-
lehrers.
7. Munding stimmt mir zu, wenn ich behaupte, man solle die Caesarlektüre weise
dosieren und in andere Textsorten und Inhalte einbetten; doch bestätigt er unge-
wollt meinen Vorwurf einer Dominanz des Bellum Gallicum; er will nämlich die
anderen Texte möglichst um Caesar herum gruppiert wissen, sucht auf jeden Fall
den „inneren Zusammenhang“ mit dem Caesartext, den es aufzulockem,
nicht aber u.U. auch einmal zu ersetzen gilt; so groß ist sein amorfatalis zu Cae-
sar; dabei akzeptiert er stillschweigend, daß die Schüler die römische Realität
„zuvor vorwiegend unter dem Aspekt von Grammatik und (sic!) militärischen
Realien“ kennenlemen. Für mich ist aber genau dieses „und“ der springende
Punkt! Erst wenn Schüler wie Lehrer von Krieg und Grammatik genug haben,
kommt schließlich auch die Poesie zu ihrem Recht; interarma artemque gramma-
ticam silent Musae; doch „nach dem Frühstück lächelt selbst Polyphem“, so ein
hintergründig boshaftes Dictum von Günther Anders (Die Antiquiertheit des
Menschen, 2. Band, S. 269), der Munding und mir viel bedeutet, denn beide sind
wir „durch das Fegefeuer der Anders’schen Beobachtung“ (H. Gollwitzer) gegan-
gen.
8. Ein textlinguistisches Argument gegen dominierende oder exklusive Caesar-
lektüre soll an dieser Stelle nachgeholt werden: Wer mit konventionellem, cae-
sarbezogenem Lehrbuch (Beispiel: Ianua Nova) gearbeitet hat und im Anschluß
daran einseitig Caesar liest, wird bei jedem nicht-historischen Folgetext (und
sogar bei Sallust und Livius) erhebliche Verstehensschwierigkeiten haben; die
sprachpsychologischen Dekodierungsvoraussetzungen, um römische Komödien,
um Ovid, Cicero oder auch Petron lesen zu können, unterscheiden sich nämlich
spezifisch von den im Blick auf das Bellum Gallicum entwickelten strukturellen
Verfahren. Je einseitiger nun die Texterschließung am Bellum Gallicum ein-
geübt wird, umso schwerer fällt den Schülern dann bereits eine Phädrusfabel
eigentümlich verschlungen sind? Ich betone gegen Munding eigentlich nur dreierlei: 1.
eine bedenkliche Caesarfixierung bei vielen Lateinlehrem, die sich einfach nichts
anderes vorstellen können, 2. die Gefahr einer einseitigen „Frühprägung“ der Latein-
schüler - erste Lektüreeindrücke haften erfahrungsgemäß besonders intensiv - und 3.
die Schwierigkeit, in der Einlesephase mit Mittelstufenschülem den Caesartext ange-
messen, d.h. reflektiert zu lesen und seine Implikationen aufzubrechen; die Formel:
aut Caesar aut nihil sollte auf diese Problematik aufmerksam machen.
9