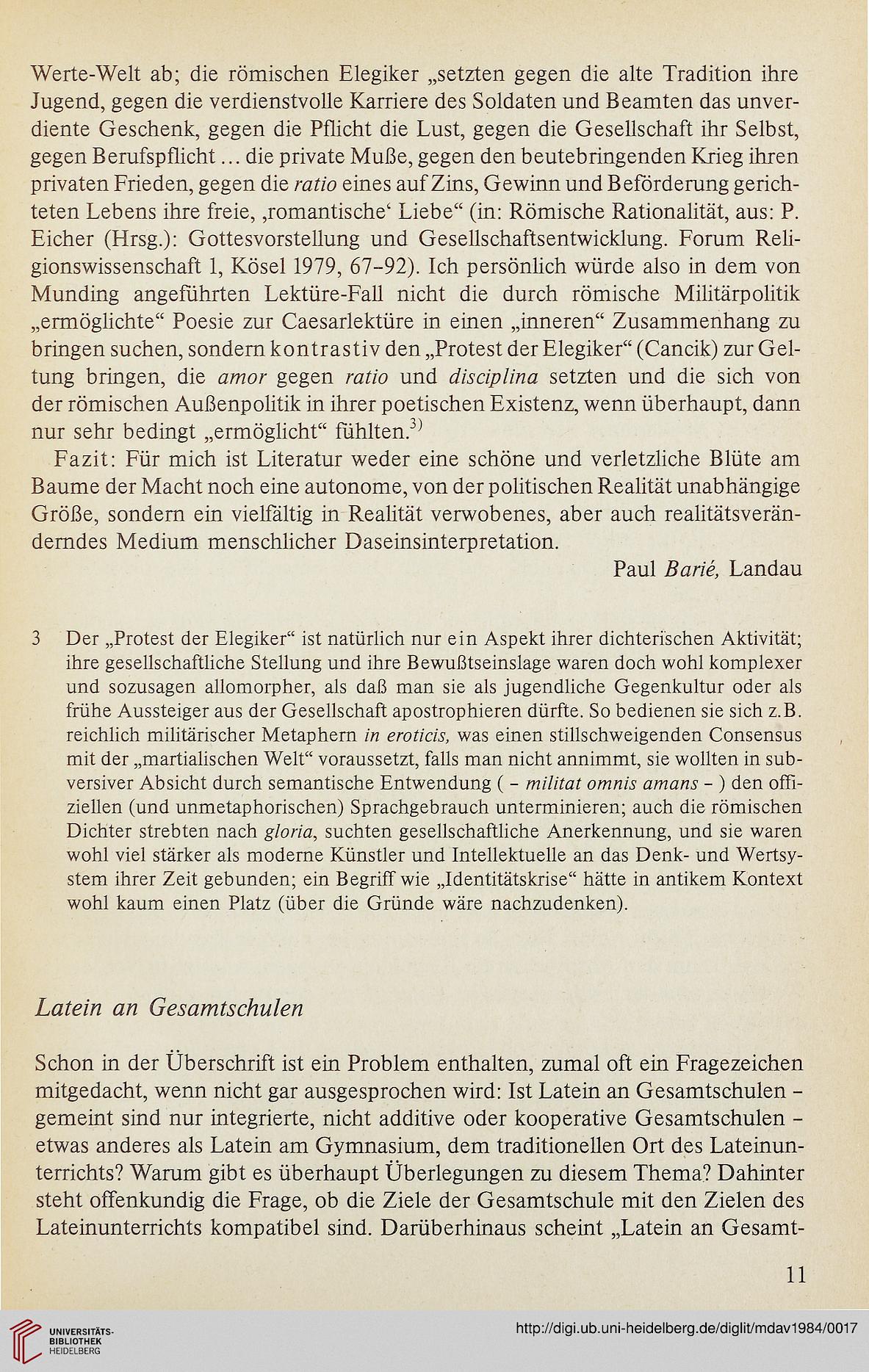Werte-Welt ab; die römischen Elegiker „setzten gegen die alte Tradition ihre
Jugend, gegen die verdienstvolle Karriere des Soldaten und Beamten das unver-
diente Geschenk, gegen die Pflicht die Lust, gegen die Gesellschaft ihr Selbst,
gegen Berufspflicht... die private Muße, gegen den beutebringenden Krieg ihren
privaten Frieden, gegen die ratio eines auf Zins, Gewinn und Beförderung gerich-
teten Lebens ihre freie, ,romantische‘ Liebe“ (in: Römische Rationalität, aus: P.
Eicher (Hrsg.): Gottesvorstellung und Gesellschaftsentwicklung. Forum Reli-
gionswissenschaft 1, Kösel 1979, 67-92). Ich persönlich würde also in dem von
Munding angeführten Lektüre-Fall nicht die durch römische Militärpolitik
„ermöglichte“ Poesie zur Caesarlektüre in einen „inneren“ Zusammenhang zu
bringen suchen, sondern kontrastiv den „Protest der Elegiker“ (Cancik) zur Gel-
tung bringen, die amor gegen ratio und disciplina setzten und die sich von
der römischen Außenpolitik in ihrer poetischen Existenz, wenn überhaupt, dann
nur sehr bedingt „ermöglicht“ fühlten.3]
Fazit: Für mich ist Literatur weder eine schöne und verletzliche Blüte am
Baume der Macht noch eine autonome, von der politischen Realität unabhängige
Größe, sondern ein vielfältig in Realität verwobenes, aber auch realitätsverän-
demdes Medium menschlicher Daseinsinterpretation.
Paul Barie, Landau
3 Der „Protest der Elegiker“ ist natürlich nur ein Aspekt ihrer dichterischen Aktivität;
ihre gesellschaftliche Stellung und ihre Bewußtseinslage waren doch wohl komplexer
und sozusagen allomorpher, als daß man sie als jugendliche Gegenkultur oder als
frühe Aussteiger aus der Gesellschaft apostrophieren dürfte. So bedienen sie sich z.B.
reichlich militärischer Metaphern in eroticis, was einen stillschweigenden Consensus
mit der „martialischen Welt“ voraussetzt, falls man nicht annimmt, sie wollten in sub-
versiver Absicht durch semantische Entwendung ( - militat omnis amans - ) den offi-
ziellen (und unmetaphorischen) Sprachgebrauch unterminieren; auch die römischen
Dichter strebten nach gloria, suchten gesellschaftliche Anerkennung, und sie waren
wohl viel stärker als moderne Künstler und Intellektuelle an das Denk- und Wertsy-
stem ihrer Zeit gebunden; ein Begriff wie „Identitätskrise“ hätte in antikem Kontext
wohl kaum einen Platz (über die Gründe wäre nachzudenken).
Latein an Gesamtschulen
Schon in der Überschrift ist ein Problem enthalten, zumal oft ein Fragezeichen
mitgedacht, wenn nicht gar ausgesprochen wird: Ist Latein an Gesamtschulen -
gemeint sind nur integrierte, nicht additive oder kooperative Gesamtschulen -
etwas anderes als Latein am Gymnasium, dem traditionellen Ort des Lateinun-
terrichts? Warum gibt es überhaupt Überlegungen zu diesem Thema? Dahinter
steht offenkundig die Frage, ob die Ziele der Gesamtschule mit den Zielen des
Lateinunterrichts kompatibel sind. Darüberhinaus scheint „Latein an Gesamt-
11
Jugend, gegen die verdienstvolle Karriere des Soldaten und Beamten das unver-
diente Geschenk, gegen die Pflicht die Lust, gegen die Gesellschaft ihr Selbst,
gegen Berufspflicht... die private Muße, gegen den beutebringenden Krieg ihren
privaten Frieden, gegen die ratio eines auf Zins, Gewinn und Beförderung gerich-
teten Lebens ihre freie, ,romantische‘ Liebe“ (in: Römische Rationalität, aus: P.
Eicher (Hrsg.): Gottesvorstellung und Gesellschaftsentwicklung. Forum Reli-
gionswissenschaft 1, Kösel 1979, 67-92). Ich persönlich würde also in dem von
Munding angeführten Lektüre-Fall nicht die durch römische Militärpolitik
„ermöglichte“ Poesie zur Caesarlektüre in einen „inneren“ Zusammenhang zu
bringen suchen, sondern kontrastiv den „Protest der Elegiker“ (Cancik) zur Gel-
tung bringen, die amor gegen ratio und disciplina setzten und die sich von
der römischen Außenpolitik in ihrer poetischen Existenz, wenn überhaupt, dann
nur sehr bedingt „ermöglicht“ fühlten.3]
Fazit: Für mich ist Literatur weder eine schöne und verletzliche Blüte am
Baume der Macht noch eine autonome, von der politischen Realität unabhängige
Größe, sondern ein vielfältig in Realität verwobenes, aber auch realitätsverän-
demdes Medium menschlicher Daseinsinterpretation.
Paul Barie, Landau
3 Der „Protest der Elegiker“ ist natürlich nur ein Aspekt ihrer dichterischen Aktivität;
ihre gesellschaftliche Stellung und ihre Bewußtseinslage waren doch wohl komplexer
und sozusagen allomorpher, als daß man sie als jugendliche Gegenkultur oder als
frühe Aussteiger aus der Gesellschaft apostrophieren dürfte. So bedienen sie sich z.B.
reichlich militärischer Metaphern in eroticis, was einen stillschweigenden Consensus
mit der „martialischen Welt“ voraussetzt, falls man nicht annimmt, sie wollten in sub-
versiver Absicht durch semantische Entwendung ( - militat omnis amans - ) den offi-
ziellen (und unmetaphorischen) Sprachgebrauch unterminieren; auch die römischen
Dichter strebten nach gloria, suchten gesellschaftliche Anerkennung, und sie waren
wohl viel stärker als moderne Künstler und Intellektuelle an das Denk- und Wertsy-
stem ihrer Zeit gebunden; ein Begriff wie „Identitätskrise“ hätte in antikem Kontext
wohl kaum einen Platz (über die Gründe wäre nachzudenken).
Latein an Gesamtschulen
Schon in der Überschrift ist ein Problem enthalten, zumal oft ein Fragezeichen
mitgedacht, wenn nicht gar ausgesprochen wird: Ist Latein an Gesamtschulen -
gemeint sind nur integrierte, nicht additive oder kooperative Gesamtschulen -
etwas anderes als Latein am Gymnasium, dem traditionellen Ort des Lateinun-
terrichts? Warum gibt es überhaupt Überlegungen zu diesem Thema? Dahinter
steht offenkundig die Frage, ob die Ziele der Gesamtschule mit den Zielen des
Lateinunterrichts kompatibel sind. Darüberhinaus scheint „Latein an Gesamt-
11