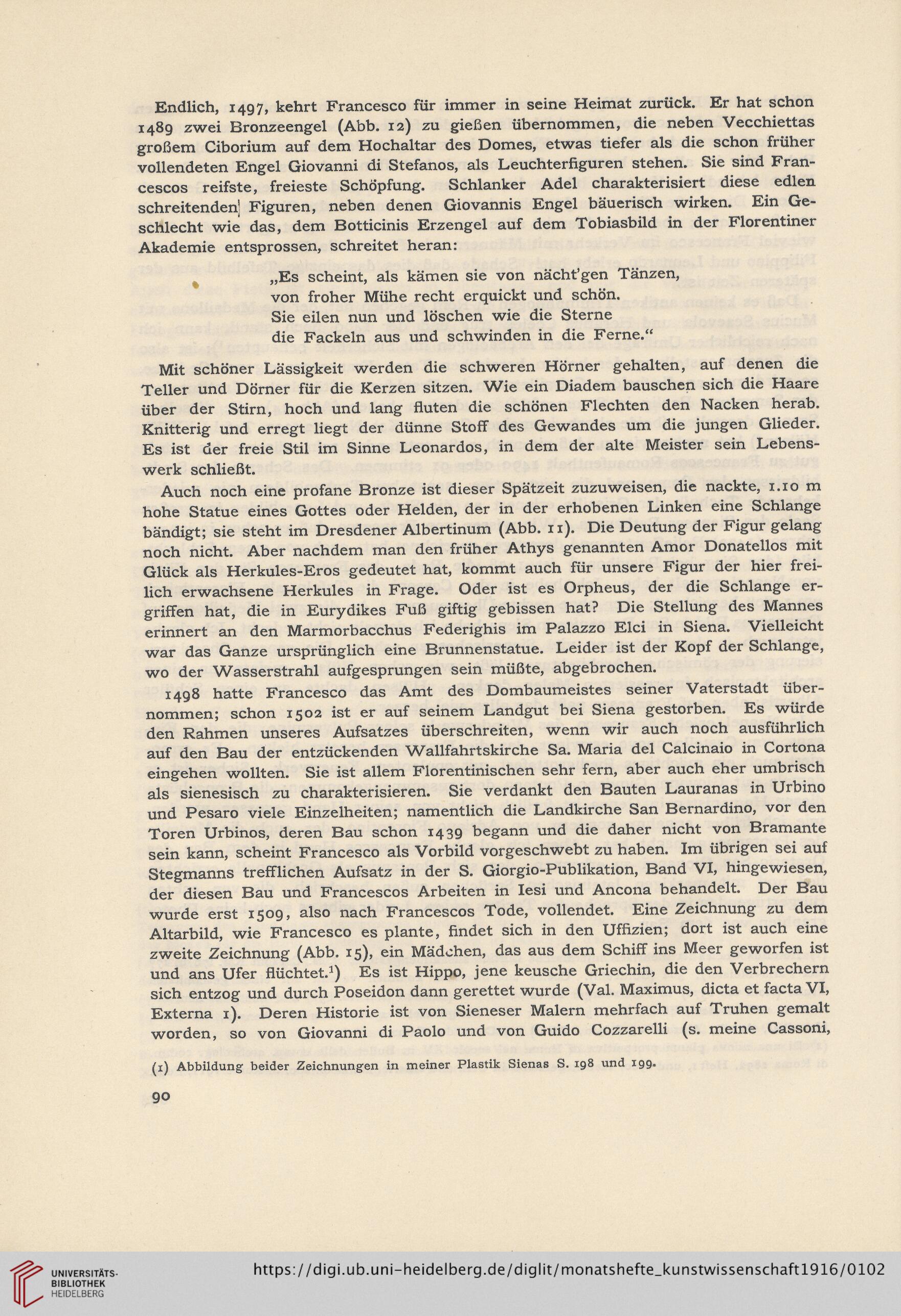Endlich, 1497, kehrt Francesco für immer in seine Heimat zurück. Er hat schon
1489 zwei Bronzeengel (Abb. 12) zu gießen übernommen, die neben Vecchiettas
großem Ciborium auf dem Hochaltar des Domes, etwas tiefer als die schon früher
vollendeten Engel Giovanni di Stefanos, als Leuchterfiguren stehen. Sie sind Fran-
cescos reifste, freieste Schöpfung. Schlanker Adel charakterisiert diese edlen
schreitenden’ Figuren, neben denen Giovannis Engel bäuerisch wirken. Ein Ge-
schlecht wie das, dem Botticinis Erzengel auf dem Tobiasbild in der Florentiner
Akademie entsprossen, schreitet heran:
„Es scheint, als kämen sie von nächt’gen Tänzen,
von froher Mühe recht erquickt und schön.
Sie eilen nun und löschen wie die Sterne
die Fackeln aus und schwinden in die Ferne.“
Mit schöner Lässigkeit werden die schweren Hörner gehalten, auf denen die
Teller und Dörner für die Kerzen sitzen. Wie ein Diadem bauschen sich die Haare
über der Stirn, hoch und lang fluten die schönen Flechten den Nacken herab.
Knitterig und erregt liegt der dünne Stoff des Gewandes um die jungen Glieder.
Es ist der freie Stil im Sinne Leonardos, in dem der alte Meister sein Lebens-
werk schließt.
Auch noch eine profane Bronze ist dieser Spätzeit zuzuweisen, die nackte, 1.10 m
hohe Statue eines Gottes oder Helden, der in der erhobenen Linken eine Schlange
bändigt; sie steht im Dresdener Albertinum (Abb. 11). Die Deutung der Figur gelang
noch nicht. Aber nachdem man den früher Athys genannten Amor Donatellos mit
Glück als Herkules-Eros gedeutet hat, kommt auch für unsere Figur der hier frei-
lich erwachsene Herkules in Frage. Oder ist es Orpheus, der die Schlange er-
griffen hat, die in Eurydikes Fuß giftig gebissen hat? Die Stellung des Mannes
erinnert an den Marmorbacchus Federighis im Palazzo Elci in Siena. Vielleicht
war das Ganze ursprünglich eine Brunnenstatue. Leider ist der Kopf der Schlange,
wo der Wasserstrahl aufgesprungen sein müßte, abgebrochen.
1498 hatte Francesco das Amt des Dombaumeistes seiner Vaterstadt über-
nommen; schon 1502 ist er auf seinem Landgut bei Siena gestorben. Es würde
den Rahmen unseres Aufsatzes überschreiten, wenn wir auch noch ausführlich
auf den Bau der entzückenden Wallfahrtskirche Sa. Maria del Calcinaio in Cortona
eingehen wollten. Sie ist allem Florentinischen sehr fern, aber auch eher umbrisch
als sienesisch zu charakterisieren. Sie verdankt den Bauten Lauranas in Urbino
und Pesaro viele Einzelheiten; namentlich die Landkirche San Bernardino, vor den
Toren Urbinos, deren Bau schon 1439 begann und die daher nicht von Bramante
sein kann, scheint Francesco als Vorbild vorgeschwebt zu haben. Im übrigen sei auf
Stegmanns trefflichen Aufsatz in der S. Giorgio-Publikation, Band VI, hingewiesen,
der diesen Bau und Francescos Arbeiten in lesi und Ancona behandelt. Der Bau
wurde erst 1509, also nach Francescos Tode, vollendet. Eine Zeichnung zu dem
Altarbild, wie Francesco es plante, findet sich in den Uffizien; dort ist auch eine
zweite Zeichnung (Abb. 15), ein Mädchen, das aus dem Schiff ins Meer geworfen ist
und ans Ufer flüchtet.1) Es ist Hippo, jene keusche Griechin, die den Verbrechern
sich entzog und durch Poseidon dann gerettet wurde (Val. Maximus, dicta et facta VI,
Externa 1). Deren Historie ist von Sieneser Malern mehrfach auf Truhen gemalt
worden, so von Giovanni di Paolo und von Guido Cozzarelli (s. meine Cassoni,
(i) Abbildung beider Zeichnungen in meiner Plastik Sienas S. 198 und 199.
90
1489 zwei Bronzeengel (Abb. 12) zu gießen übernommen, die neben Vecchiettas
großem Ciborium auf dem Hochaltar des Domes, etwas tiefer als die schon früher
vollendeten Engel Giovanni di Stefanos, als Leuchterfiguren stehen. Sie sind Fran-
cescos reifste, freieste Schöpfung. Schlanker Adel charakterisiert diese edlen
schreitenden’ Figuren, neben denen Giovannis Engel bäuerisch wirken. Ein Ge-
schlecht wie das, dem Botticinis Erzengel auf dem Tobiasbild in der Florentiner
Akademie entsprossen, schreitet heran:
„Es scheint, als kämen sie von nächt’gen Tänzen,
von froher Mühe recht erquickt und schön.
Sie eilen nun und löschen wie die Sterne
die Fackeln aus und schwinden in die Ferne.“
Mit schöner Lässigkeit werden die schweren Hörner gehalten, auf denen die
Teller und Dörner für die Kerzen sitzen. Wie ein Diadem bauschen sich die Haare
über der Stirn, hoch und lang fluten die schönen Flechten den Nacken herab.
Knitterig und erregt liegt der dünne Stoff des Gewandes um die jungen Glieder.
Es ist der freie Stil im Sinne Leonardos, in dem der alte Meister sein Lebens-
werk schließt.
Auch noch eine profane Bronze ist dieser Spätzeit zuzuweisen, die nackte, 1.10 m
hohe Statue eines Gottes oder Helden, der in der erhobenen Linken eine Schlange
bändigt; sie steht im Dresdener Albertinum (Abb. 11). Die Deutung der Figur gelang
noch nicht. Aber nachdem man den früher Athys genannten Amor Donatellos mit
Glück als Herkules-Eros gedeutet hat, kommt auch für unsere Figur der hier frei-
lich erwachsene Herkules in Frage. Oder ist es Orpheus, der die Schlange er-
griffen hat, die in Eurydikes Fuß giftig gebissen hat? Die Stellung des Mannes
erinnert an den Marmorbacchus Federighis im Palazzo Elci in Siena. Vielleicht
war das Ganze ursprünglich eine Brunnenstatue. Leider ist der Kopf der Schlange,
wo der Wasserstrahl aufgesprungen sein müßte, abgebrochen.
1498 hatte Francesco das Amt des Dombaumeistes seiner Vaterstadt über-
nommen; schon 1502 ist er auf seinem Landgut bei Siena gestorben. Es würde
den Rahmen unseres Aufsatzes überschreiten, wenn wir auch noch ausführlich
auf den Bau der entzückenden Wallfahrtskirche Sa. Maria del Calcinaio in Cortona
eingehen wollten. Sie ist allem Florentinischen sehr fern, aber auch eher umbrisch
als sienesisch zu charakterisieren. Sie verdankt den Bauten Lauranas in Urbino
und Pesaro viele Einzelheiten; namentlich die Landkirche San Bernardino, vor den
Toren Urbinos, deren Bau schon 1439 begann und die daher nicht von Bramante
sein kann, scheint Francesco als Vorbild vorgeschwebt zu haben. Im übrigen sei auf
Stegmanns trefflichen Aufsatz in der S. Giorgio-Publikation, Band VI, hingewiesen,
der diesen Bau und Francescos Arbeiten in lesi und Ancona behandelt. Der Bau
wurde erst 1509, also nach Francescos Tode, vollendet. Eine Zeichnung zu dem
Altarbild, wie Francesco es plante, findet sich in den Uffizien; dort ist auch eine
zweite Zeichnung (Abb. 15), ein Mädchen, das aus dem Schiff ins Meer geworfen ist
und ans Ufer flüchtet.1) Es ist Hippo, jene keusche Griechin, die den Verbrechern
sich entzog und durch Poseidon dann gerettet wurde (Val. Maximus, dicta et facta VI,
Externa 1). Deren Historie ist von Sieneser Malern mehrfach auf Truhen gemalt
worden, so von Giovanni di Paolo und von Guido Cozzarelli (s. meine Cassoni,
(i) Abbildung beider Zeichnungen in meiner Plastik Sienas S. 198 und 199.
90