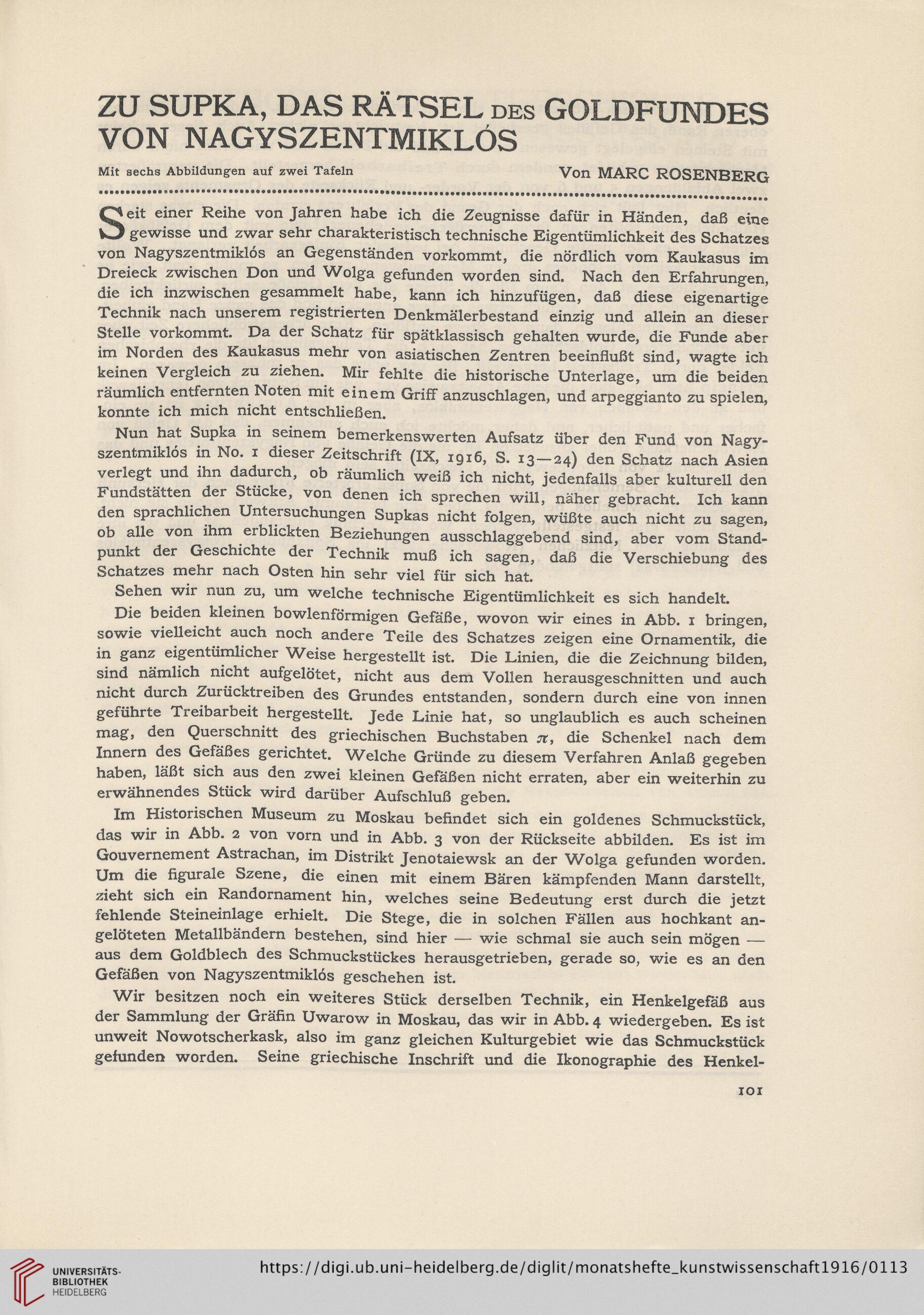ZU SUPKA, DAS RÄTSEL des GOLDFUNDES
VON NAGYSZENTMIKLOS
Mit sechs Abbildungen auf zwei Tafeln Von MARC ROSENBERG
Seit einer Reihe von Jahren habe ich die Zeugnisse dafür in Händen, daß eine
gewisse und zwar sehr charakteristisch technische Eigentümlichkeit des Schatzes
von Nagyszentmiklos an Gegenständen vorkommt, die nördlich vom Kaukasus im
Dreieck zwischen Don und Wolga gefunden worden sind. Nach den Erfahrungen,
die ich inzwischen gesammelt habe, kann ich hinzufügen, daß diese eigenartige
Technik nach unserem registrierten Denkmälerbestand einzig und allein an dieser
Stelle vorkommt. Da der Schatz für spätklassisch gehalten wurde, die Funde aber
im Norden des Kaukasus mehr von asiatischen Zentren beeinflußt sind, wagte ich
keinen Vergleich zu ziehen. Mir fehlte die historische Unterlage, um die beiden
räumlich entfernten Noten mit einem Griff anzuschlagen, und arpeggianto zu spielen,
konnte ich mich nicht entschließen.
Nun hat Supka in seinem bemerkenswerten Aufsatz über den Fund von Nagy-
szentmiklos in No. i dieser Zeitschrift (IX, igrg, S. 13-24) den Schatz nach Asien
verlegt und ihn dadurch, ob räumlich weiß ich nicht, jedenfalls aber kulturell den
Fundstätten der Stücke, von denen ich sprechen will, näher gebracht. Ich kann
den sprachlichen Untersuchungen Supkas nicht folgen, wüßte auch nicht zu sagen,
ob alle von ihm erblickten Beziehungen ausschlaggebend sind, aber vom Stand-
punkt der Geschichte der Technik muß ich sagen, daß die Verschiebung des
Schatzes mehr nach Osten hin sehr viel für sich hat.
Sehen wir nun zu, um welche technische Eigentümlichkeit es sich handelt.
Die beiden kleinen bowlenförmigen Gefäße, wovon wir eines in Abb. i bringen,
sowie viefleicht auch noch andere Teile des Schatzes zeigen eine Ornamentik, die
in ganz eigentümlicher Weise hergestellt ist. Die Linien, die die Zeichnung bilden,
sind nämlich nicht aufgelötet, nicht aus dem Vollen herausgeschnitten und auch
nicht durch Zurücktreiben des Grundes entstanden, sondern durch eine von innen
geführte Treibarbeit hergestellt. Jede Linie hat, so unglaublich es auch scheinen
mag, den Querschnitt . des griechischen Buchstaben π, die Schenkel nach dem
Innern des Gefäßes gerichtet. Welche Gründe zu diesem Verfahren Anlaß gegeben
haben, läßt sich aus den zwei kleinen Gefäßen nicht erraten, aber ein weiterhin zu
erwähnendes Stück wird darüber Aufschluß geben.
Im Historischen Museum zu Moskau befindet sich ein goldenes Schmuckstück,
das wir in Abb. 2 von vorn und in Abb. 3 von der Rückseite abbilden. Es ist im
Gouvernement Astrachan, im Distrikt Jenotaiewsk an der Wolga gefunden worden.
Um die figurale Szene, die einen mit einem Bären kämpfenden Mann darstellt,
zieht sich ein Randornament hin, welches seine Bedeutung erst durch die jetzt
fehlende Steineinlage erhielt. Die Stege, die in solchen Fällen aus hochkant an-
gelöteten Metallbändern bestehen, sind hier — wie schmal sie auch sein mögen —
aus dem Goldblech des Schmuckstückes herausgetrieben, gerade so, wie es an den
Gefäßen von Nagyszentmiklos geschehen ist.
Wir besitzen noch ein weiteres Stück derselben Technik, ein Henkelgefäß aus
der Sammlung der Gräfin Uwarow in Moskau, das wir in Abb. 4 wiedergeben. Es ist
unweit Nowotscherkask, also im ganz gleichen Kulturgebiet wie das Schmuckstück
gefunden worden. Seine griechische Inschrift und die Ikonographie des Henkel-
101
VON NAGYSZENTMIKLOS
Mit sechs Abbildungen auf zwei Tafeln Von MARC ROSENBERG
Seit einer Reihe von Jahren habe ich die Zeugnisse dafür in Händen, daß eine
gewisse und zwar sehr charakteristisch technische Eigentümlichkeit des Schatzes
von Nagyszentmiklos an Gegenständen vorkommt, die nördlich vom Kaukasus im
Dreieck zwischen Don und Wolga gefunden worden sind. Nach den Erfahrungen,
die ich inzwischen gesammelt habe, kann ich hinzufügen, daß diese eigenartige
Technik nach unserem registrierten Denkmälerbestand einzig und allein an dieser
Stelle vorkommt. Da der Schatz für spätklassisch gehalten wurde, die Funde aber
im Norden des Kaukasus mehr von asiatischen Zentren beeinflußt sind, wagte ich
keinen Vergleich zu ziehen. Mir fehlte die historische Unterlage, um die beiden
räumlich entfernten Noten mit einem Griff anzuschlagen, und arpeggianto zu spielen,
konnte ich mich nicht entschließen.
Nun hat Supka in seinem bemerkenswerten Aufsatz über den Fund von Nagy-
szentmiklos in No. i dieser Zeitschrift (IX, igrg, S. 13-24) den Schatz nach Asien
verlegt und ihn dadurch, ob räumlich weiß ich nicht, jedenfalls aber kulturell den
Fundstätten der Stücke, von denen ich sprechen will, näher gebracht. Ich kann
den sprachlichen Untersuchungen Supkas nicht folgen, wüßte auch nicht zu sagen,
ob alle von ihm erblickten Beziehungen ausschlaggebend sind, aber vom Stand-
punkt der Geschichte der Technik muß ich sagen, daß die Verschiebung des
Schatzes mehr nach Osten hin sehr viel für sich hat.
Sehen wir nun zu, um welche technische Eigentümlichkeit es sich handelt.
Die beiden kleinen bowlenförmigen Gefäße, wovon wir eines in Abb. i bringen,
sowie viefleicht auch noch andere Teile des Schatzes zeigen eine Ornamentik, die
in ganz eigentümlicher Weise hergestellt ist. Die Linien, die die Zeichnung bilden,
sind nämlich nicht aufgelötet, nicht aus dem Vollen herausgeschnitten und auch
nicht durch Zurücktreiben des Grundes entstanden, sondern durch eine von innen
geführte Treibarbeit hergestellt. Jede Linie hat, so unglaublich es auch scheinen
mag, den Querschnitt . des griechischen Buchstaben π, die Schenkel nach dem
Innern des Gefäßes gerichtet. Welche Gründe zu diesem Verfahren Anlaß gegeben
haben, läßt sich aus den zwei kleinen Gefäßen nicht erraten, aber ein weiterhin zu
erwähnendes Stück wird darüber Aufschluß geben.
Im Historischen Museum zu Moskau befindet sich ein goldenes Schmuckstück,
das wir in Abb. 2 von vorn und in Abb. 3 von der Rückseite abbilden. Es ist im
Gouvernement Astrachan, im Distrikt Jenotaiewsk an der Wolga gefunden worden.
Um die figurale Szene, die einen mit einem Bären kämpfenden Mann darstellt,
zieht sich ein Randornament hin, welches seine Bedeutung erst durch die jetzt
fehlende Steineinlage erhielt. Die Stege, die in solchen Fällen aus hochkant an-
gelöteten Metallbändern bestehen, sind hier — wie schmal sie auch sein mögen —
aus dem Goldblech des Schmuckstückes herausgetrieben, gerade so, wie es an den
Gefäßen von Nagyszentmiklos geschehen ist.
Wir besitzen noch ein weiteres Stück derselben Technik, ein Henkelgefäß aus
der Sammlung der Gräfin Uwarow in Moskau, das wir in Abb. 4 wiedergeben. Es ist
unweit Nowotscherkask, also im ganz gleichen Kulturgebiet wie das Schmuckstück
gefunden worden. Seine griechische Inschrift und die Ikonographie des Henkel-
101