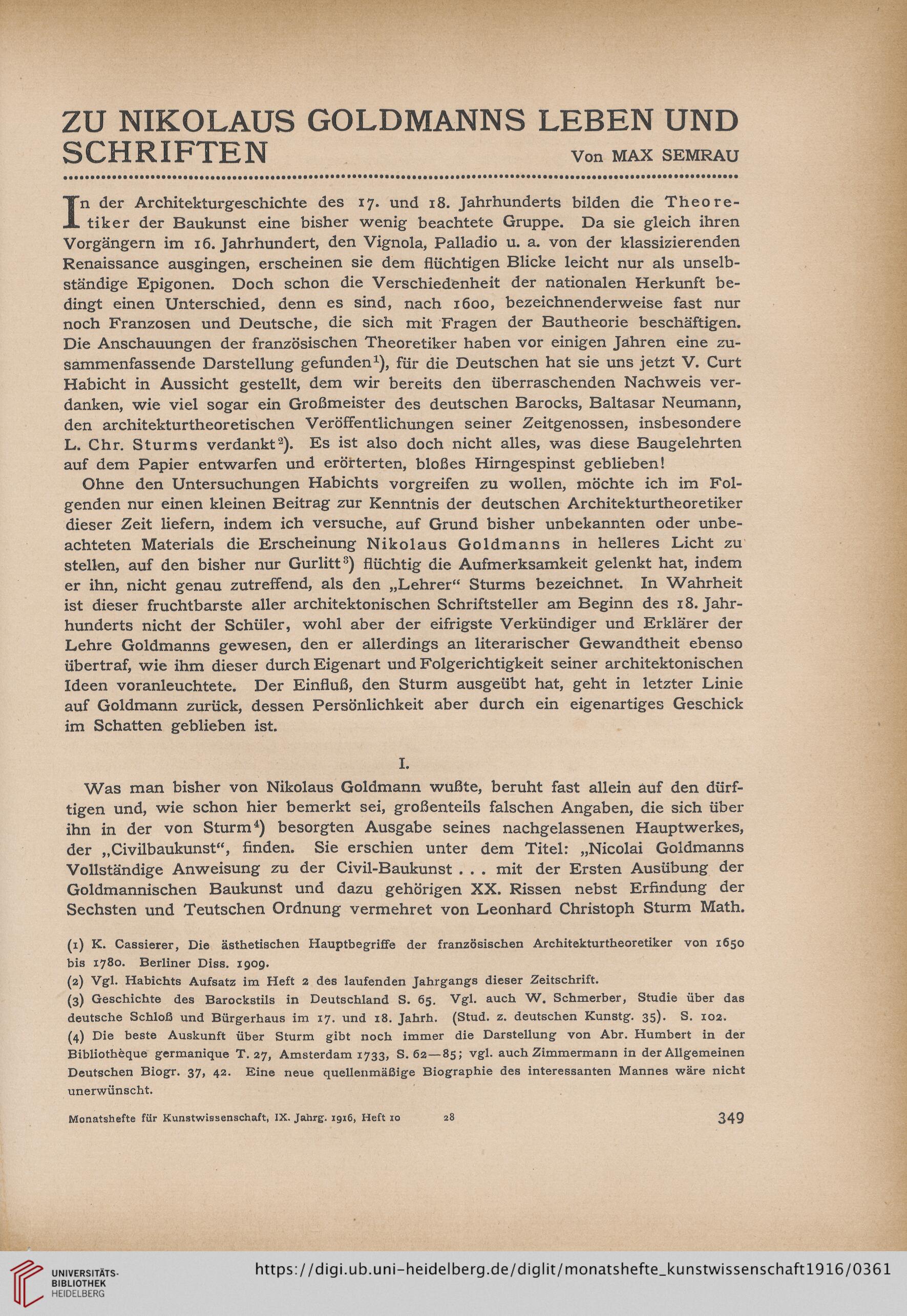ZU NIKOLAUS GOLDMANNS LEBEN UND
SCHRIFTEN Von MAX SEMRAU
····························································································································
In der Architekturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts bilden die Theore-
tiker der Baukunst eine bisher wenig beachtete Gruppe. Da sie gleich ihren
Vorgängern im 16. Jahrhundert, den Vignola, Palladio u. a. von der klassizierenden
Renaissance ausgingen, erscheinen sie dem flüchtigen Blicke leicht nur als unselb-
ständige Epigonen. Doch schon die Verschiedenheit der nationalen Herkunft be-
dingt einen Unterschied, denn es sind, nach 1600, bezeichnenderweise fast nur
noch Franzosen und Deutsche, die sich mit Fragen der Bautheorie beschäftigen.
Die Anschauungen der französischen Theoretiker haben vor einigen Jahren eine zu-
sammenfassende Darstellung gefunden1), für die Deutschen hat sie uns jetzt V. Curt
Habicht in Aussicht gestellt, dem wir bereits den überraschenden Nachweis ver-
danken, wie viel sogar ein Großmeister des deutschen Barocks, Baltasar Neumann,
den architekturtheoretischen Veröffentlichungen seiner Zeitgenossen, insbesondere
L. Chr. Sturms verdankt2 3). Es ist also doch nicht alles, was diese Baugelehrten
auf dem Papier entwarfen und erörterten, bloßes Hirngespinst geblieben!
Ohne den Untersuchungen Habichts vorgreifen zu wollen, möchte ich im Fol-
genden nur einen kleinen Beitrag zur Kenntnis der deutschen Architekturtheoretiker
dieser Zeit liefern, indem ich versuche, auf Grund bisher unbekannten oder unbe-
achteten Materials die Erscheinung Nikolaus Goldmanns in helleres Licht zu
stellen, auf den bisher nur Gurlitt8) flüchtig die Aufmerksamkeit gelenkt hat, indem
er ihn, nicht genau zutreffend, als den „Lehrer“ Sturms bezeichnet. In Wahrheit
ist dieser fruchtbarste aller architektonischen Schriftsteller am Beginn des 18. Jahr-
hunderts nicht der Schüler, wohl aber der eifrigste Verkündiger und Erklärer der
Lehre Goldmanns gewesen, den er allerdings an literarischer Gewandtheit ebenso
übertraf, wie ihm dieser durch Eigenart und Folgerichtigkeit seiner architektonischen
Ideen voranleuchtete. Der Einfluß, den Sturm ausgeübt hat, geht in letzter Linie
auf Goldmann zurück, dessen Persönlichkeit aber durch ein eigenartiges Geschick
im Schatten geblieben ist.
I.
Was man bisher von Nikolaus Goldmann wußte, beruht fast allein auf den dürf-
tigen und, wie schon hier bemerkt sei, großenteils falschen Angaben, die sich über
ihn in der von Sturm4 * * *) besorgten Ausgabe seines nachgelassenen Hauptwerkes,
der „Civilbaukunst“, finden. Sie erschien unter dem Titel: „Nicolai Goldmanns
Vollständige Anweisung zu der Civil-Baukunst . . . mit der Ersten Ausübung der
Goldmannischen Baukunst und dazu gehörigen XX. Rissen nebst Erfindung der
Sechsten und Teutschen Ordnung vermehret von Leonhard Christoph Sturm Math.
(1) K. Cassierer, Die ästhetischen Hauptbegriffe der französischen Architekturtheoretiker von 1650
bis 1780. Berliner Diss. 1909·
(2) Vgl. Habichts Aufsatz im Heft 2 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift.
(3) Geschichte des Barockstils in Deutschland S. 65. Vgl. auch W. Schmerber, Studie über das
deutsche Schloß und Bürgerhaus im 17. und 18. Jahrh. (Stud. z. deutschen Kunstg. 35). S. 102.
(4) Die beste Auskunft über Sturm gibt noch immer die Darstellung von Abr. Humbert in der
Bibliotheque germanique T. 27, Amsterdam 1733, S. 62—85; vgl. auch Zimmermann in der Allgemeinen
Deutschen Biogr. 37, 42. Eine neue quellenmäßige Biographie des interessanten Mannes wäre nicht
unerwünscht.
Monatshefte für Kunstwissenschaft, IX. Jahrg. 1916, Heft 10
28
349
SCHRIFTEN Von MAX SEMRAU
····························································································································
In der Architekturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts bilden die Theore-
tiker der Baukunst eine bisher wenig beachtete Gruppe. Da sie gleich ihren
Vorgängern im 16. Jahrhundert, den Vignola, Palladio u. a. von der klassizierenden
Renaissance ausgingen, erscheinen sie dem flüchtigen Blicke leicht nur als unselb-
ständige Epigonen. Doch schon die Verschiedenheit der nationalen Herkunft be-
dingt einen Unterschied, denn es sind, nach 1600, bezeichnenderweise fast nur
noch Franzosen und Deutsche, die sich mit Fragen der Bautheorie beschäftigen.
Die Anschauungen der französischen Theoretiker haben vor einigen Jahren eine zu-
sammenfassende Darstellung gefunden1), für die Deutschen hat sie uns jetzt V. Curt
Habicht in Aussicht gestellt, dem wir bereits den überraschenden Nachweis ver-
danken, wie viel sogar ein Großmeister des deutschen Barocks, Baltasar Neumann,
den architekturtheoretischen Veröffentlichungen seiner Zeitgenossen, insbesondere
L. Chr. Sturms verdankt2 3). Es ist also doch nicht alles, was diese Baugelehrten
auf dem Papier entwarfen und erörterten, bloßes Hirngespinst geblieben!
Ohne den Untersuchungen Habichts vorgreifen zu wollen, möchte ich im Fol-
genden nur einen kleinen Beitrag zur Kenntnis der deutschen Architekturtheoretiker
dieser Zeit liefern, indem ich versuche, auf Grund bisher unbekannten oder unbe-
achteten Materials die Erscheinung Nikolaus Goldmanns in helleres Licht zu
stellen, auf den bisher nur Gurlitt8) flüchtig die Aufmerksamkeit gelenkt hat, indem
er ihn, nicht genau zutreffend, als den „Lehrer“ Sturms bezeichnet. In Wahrheit
ist dieser fruchtbarste aller architektonischen Schriftsteller am Beginn des 18. Jahr-
hunderts nicht der Schüler, wohl aber der eifrigste Verkündiger und Erklärer der
Lehre Goldmanns gewesen, den er allerdings an literarischer Gewandtheit ebenso
übertraf, wie ihm dieser durch Eigenart und Folgerichtigkeit seiner architektonischen
Ideen voranleuchtete. Der Einfluß, den Sturm ausgeübt hat, geht in letzter Linie
auf Goldmann zurück, dessen Persönlichkeit aber durch ein eigenartiges Geschick
im Schatten geblieben ist.
I.
Was man bisher von Nikolaus Goldmann wußte, beruht fast allein auf den dürf-
tigen und, wie schon hier bemerkt sei, großenteils falschen Angaben, die sich über
ihn in der von Sturm4 * * *) besorgten Ausgabe seines nachgelassenen Hauptwerkes,
der „Civilbaukunst“, finden. Sie erschien unter dem Titel: „Nicolai Goldmanns
Vollständige Anweisung zu der Civil-Baukunst . . . mit der Ersten Ausübung der
Goldmannischen Baukunst und dazu gehörigen XX. Rissen nebst Erfindung der
Sechsten und Teutschen Ordnung vermehret von Leonhard Christoph Sturm Math.
(1) K. Cassierer, Die ästhetischen Hauptbegriffe der französischen Architekturtheoretiker von 1650
bis 1780. Berliner Diss. 1909·
(2) Vgl. Habichts Aufsatz im Heft 2 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift.
(3) Geschichte des Barockstils in Deutschland S. 65. Vgl. auch W. Schmerber, Studie über das
deutsche Schloß und Bürgerhaus im 17. und 18. Jahrh. (Stud. z. deutschen Kunstg. 35). S. 102.
(4) Die beste Auskunft über Sturm gibt noch immer die Darstellung von Abr. Humbert in der
Bibliotheque germanique T. 27, Amsterdam 1733, S. 62—85; vgl. auch Zimmermann in der Allgemeinen
Deutschen Biogr. 37, 42. Eine neue quellenmäßige Biographie des interessanten Mannes wäre nicht
unerwünscht.
Monatshefte für Kunstwissenschaft, IX. Jahrg. 1916, Heft 10
28
349