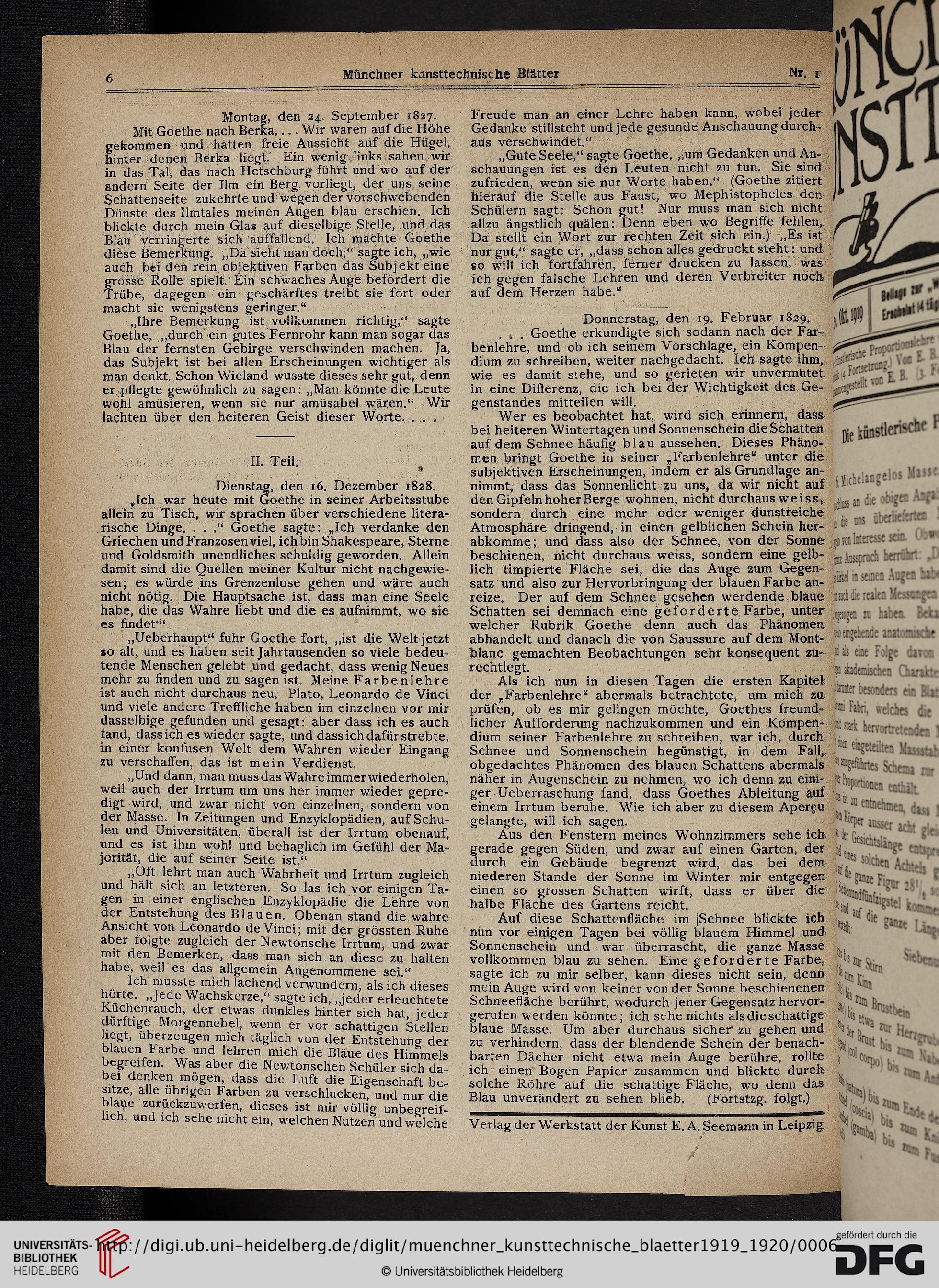6
Münchner kansttechnische Blätter
Nr. r
Montag, den 24. September 1827.
Mit Goethe nach Berka_Wir waren auf die Höhe
gekommen und hatten freie Aussicht auf die Hügel,
hinter denen Berka liegt. Ein wenig links sahen wir
in das Tal, das nach Hetschburg führt und wo auf der
andern Seite der Ilm ein Berg vorliegt, der uns seine
Schattenseite zukehrte und wegen der vorschwebenden
Dünste des Ilmtales meinen Augen blau erschien. Ich
blickte durch mein Glas auf dieselbige Stelle, und das
Blau verringerte sich auffallend. Ich machte Goethe
diese Bemerkung. „Da sieht man doch,“ sagte ich, „wie
auch bei den rein objektiven Farben das Subjekt eine
grosse Rolle spielt. Ein schwaches Auge befördert die
Trübe, dagegen ein geschärftes treibt sie fort oder
macht sie wenigstens geringer.“
„Ihre Bemerkung ist vollkommen richtig,“ sagte
Goethe, „durch ein gutes Fernrohr kann man sogar das
Blau der fernsten Gebirge verschwinden machen. Ja,
das Subjekt ist bei allen Erscheinungen wichtiger als
man denkt. Schon Wieland wusste dieses sehr gut, denn
er pflegte gewöhnlich zu sagen: „Man könnte die Leute
wohl amüsieren, wenn sie nur amüsabel wären.“ Wir
lachten über den heiteren Geist dieser Worte. . . .
II. Teil.
Dienstag, den 16. Dezember 1828.
»Ich war heute mit Goethe in seiner Arbeitsstube
allein zu Tisch, wir sprachen über verschiedene litera-
rische Dinge. . . .“ Goethe sagte: „Ich verdanke den
Griechen und Franzosen viel, ich bin Shakespeare, Sterne
und Goldsmith unendliches schuldig geworden. Allein
damit sind die Quellen meiner Kultur nicht nachgewie-
sen; es würde ins Grenzenlose gehen und wäre auch
nicht nötig. Die Hauptsache ist, dass man eine Seele
habe, die das Wahre liebt und die es aufnimmt, wo sie
es findet*“
„Ueberhaupt“ fuhr Goethe fort, „ist die Welt jetzt
so alt, und es haben seit Jahrtausenden so viele bedeu-
tende Menschen gelebt und gedacht, dass wenig Neues
mehr zu finden und zu sagen ist. Meine Farbenlehre
ist auch nicht durchaus neu. Plato, Leonardo de Vinci
und viele andere Treffliche haben im einzelnen vor mir
dasselbige gefunden und gesagt: aber dass ich es auch
fand, dass ich es wieder sagte, und dass ich dafür strebte,
in einer konfusen Welt dem Wahren wieder Eingang
zu verschaffen, das ist mein Verdienst.
„Und dann, man muss das Wahre immer wiederholen,
weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepre-
digt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von
der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schu-
len und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf,
und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Ma-
jorität, die auf seiner Seite ist.“
„Oft lehrt man auch Wahrheit und Irrtum zugleich
und hält sich an letzteren. So las ich vor einigen Ta-
gen in einer englischen Enzyklopädie die Lehre von
der Entstehung des Blauen. Obenan stand die wahre
Ansicht von Leonardo de Vinci; mit der grössten Ruhe
aber folgte zugleich der Newtonsche Irrtum, und zwar
mit den Bemerken, dass man sich an diese zu halten
habe, weil es das allgemein Angenommene sei.“
Ich musste mich lachend verwundern, als ich dieses
horte. „Jede Wachskerze,“ sagte ich, „jeder erleuchtete
T? v vnrauc^> der etwas dunkles hinter sich hat, jeder
dürftige Morgennebel, wenn er vor schattigen Stellen
liegt, überzeugen mich täglich von der Entstehung der
blauen h arbe und lehren mich die Bläue des Himmels
begreifen. Was aber die Newtonschen Schüler sich da-
bei denken mögen, dass die Luft die Eigenschaft be-
sitze, alle übrigen Farben zu verschlucken, und nur die
blaye zurückzuwerfen, dieses ist mir völlig unbegreif-
lich, und ich sehe nicht ein, welchen Nutzen und welche
Freude man an einer Lehre haben kann, wobei jeder
Gedanke stillsteht und jede gesunde Anschauung durch-
aus verschwindet.“
„Gute Seele,“ sagte Goethe, „um Gedanken und An-
schauungen ist es den Leuten nicht zu tun. Sie sind
zufrieden, wenn sie nur Worte haben.“ (Goethe zitiert
hierauf die Stelle aus Faust, wo Mephistopheles den
Schülern sagt: Schon gut! Nur muss man sich nicht
allzu ängstlich quälen: Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.) „Es ist
nur gut,“ sagte er, „dass schon alles gedruckt steht: und
so will ich fortfahren, ferner drucken zu lassen, was
ich gegen falsche Lehren und deren Verbreiter noch
auf dem Herzen habe.“
Donnerstag, den 19. Februar 1829.
. . . Goethe erkundigte sich sodann nach der Far-
benlehre, und ob ich seinem Vorschläge, ein Kompen-
dium zu schreiben, weiter nachgedacht. Ich sagte ihm,
wie es damit stehe, und so gerieten wir unvermutet
in eine Differenz, die ich bei der Wichtigkeit des Ge-
genstandes mitteilen will.
Wer es beobachtet hat, wird sich erinnern, dass
bei heiteren Wintertagen und Sonnenschein die Schatten
auf dem Schnee häufig blau aussehen. Dieses Phäno-
men bringt Goethe in seiner „Farbenlehre“ unter die
subjektiven Erscheinungen, indem er als Grundlage an-
nimmt, dass das Sonnenlicht zu uns, da wir nicht auf
den Gipfeln hoher Berge wohnen, nicht durchaus weis s,
sondern durch eine mehr oder weniger dunstreiche
Atmosphäre dringend, in einen gelblichen Schein her-
abkomme ; und dass also der Schnee, von der Sonne
beschienen, nicht durchaus weiss, sondern eine^ gelb-
lich timpierte Fläche sei, die das Auge zum Gegen-
satz und also zur Hervorbringung der blauen Farbe an-
reize. Der auf dem Schnee gesehen werdende blaue
Schatten sei demnach eine geforderte Farbe, unter
welcher Rubrik Goethe denn auch das Phänomen
abhandelt und danach die von Saussure auf dem Mont-
blanc gemachten Beobachtungen sehr konsequent zu-
rechtlegt.
Als ich nun in diesen Tagen die ersten Kapitel
der „Farbenlehre“ abermals betrachtete, um mich zu
prüfen, ob es mir gelingen möchte, Goethes freund-
licher Aufforderung nachzukommen und ein Kompen-
dium seiner Farbenlehre zu schreiben, war ich, durch
Schnee und Sonnenschein begünstigt, in dem Fall,,
obgedachtes Phänomen des blauen Schattens abermals
näher in Augenschein zu nehmen, wo ich denn zu eini-
ger Ueberraschung fand, dass Goethes Ableitung auf
einem Irrtum beruhe. Wie ich aber zu diesem Apergu
gelangte, will ich sagen.
Aus den Fenstern meines Wohnzimmers sehe ich
gerade gegen Süden, und zwar auf einen Garten, der
durch ein Gebäude begrenzt wird, das bei dem
niederen Stande der Sonne im Winter mir entgegen
einen so grossen Schatten wirft, dass er über die
halbe Fläche des Gartens reicht.
Auf diese Schattenfläche im [Schnee blickte ich
nun vor einigen Tagen bei völlig blauem Himmel und
Sonnenschein und war überrascht, die ganze Masse
vollkommen blau zu sehen. Eine geforderte Farbe,
sagte ich zu mir selber, kann dieses nicht sein, denn
mein Auge wird von keiner von der Sonne beschienenen
Schneefläche berührt, wodurch jener Gegensatz hervor-
gerufen werden könnte; ich sehe nichts als die schattige
blaue Masse. Um aber durchaus sicher* zu gehen und
zu verhindern, dass der blendende Schein der benach-
barten Dächer nicht etwa mein Auge berühre, rollte
ich einen Bogen Papier zusammen und blickte durch
solche Röhre auf die schattige Fläche, wo denn das
Blau unverändert zu sehen blieb. (Fortstzg. folgt.)
Verlag der Werkstatt der Kunst E. A. Seemann in Leipzig
Münchner kansttechnische Blätter
Nr. r
Montag, den 24. September 1827.
Mit Goethe nach Berka_Wir waren auf die Höhe
gekommen und hatten freie Aussicht auf die Hügel,
hinter denen Berka liegt. Ein wenig links sahen wir
in das Tal, das nach Hetschburg führt und wo auf der
andern Seite der Ilm ein Berg vorliegt, der uns seine
Schattenseite zukehrte und wegen der vorschwebenden
Dünste des Ilmtales meinen Augen blau erschien. Ich
blickte durch mein Glas auf dieselbige Stelle, und das
Blau verringerte sich auffallend. Ich machte Goethe
diese Bemerkung. „Da sieht man doch,“ sagte ich, „wie
auch bei den rein objektiven Farben das Subjekt eine
grosse Rolle spielt. Ein schwaches Auge befördert die
Trübe, dagegen ein geschärftes treibt sie fort oder
macht sie wenigstens geringer.“
„Ihre Bemerkung ist vollkommen richtig,“ sagte
Goethe, „durch ein gutes Fernrohr kann man sogar das
Blau der fernsten Gebirge verschwinden machen. Ja,
das Subjekt ist bei allen Erscheinungen wichtiger als
man denkt. Schon Wieland wusste dieses sehr gut, denn
er pflegte gewöhnlich zu sagen: „Man könnte die Leute
wohl amüsieren, wenn sie nur amüsabel wären.“ Wir
lachten über den heiteren Geist dieser Worte. . . .
II. Teil.
Dienstag, den 16. Dezember 1828.
»Ich war heute mit Goethe in seiner Arbeitsstube
allein zu Tisch, wir sprachen über verschiedene litera-
rische Dinge. . . .“ Goethe sagte: „Ich verdanke den
Griechen und Franzosen viel, ich bin Shakespeare, Sterne
und Goldsmith unendliches schuldig geworden. Allein
damit sind die Quellen meiner Kultur nicht nachgewie-
sen; es würde ins Grenzenlose gehen und wäre auch
nicht nötig. Die Hauptsache ist, dass man eine Seele
habe, die das Wahre liebt und die es aufnimmt, wo sie
es findet*“
„Ueberhaupt“ fuhr Goethe fort, „ist die Welt jetzt
so alt, und es haben seit Jahrtausenden so viele bedeu-
tende Menschen gelebt und gedacht, dass wenig Neues
mehr zu finden und zu sagen ist. Meine Farbenlehre
ist auch nicht durchaus neu. Plato, Leonardo de Vinci
und viele andere Treffliche haben im einzelnen vor mir
dasselbige gefunden und gesagt: aber dass ich es auch
fand, dass ich es wieder sagte, und dass ich dafür strebte,
in einer konfusen Welt dem Wahren wieder Eingang
zu verschaffen, das ist mein Verdienst.
„Und dann, man muss das Wahre immer wiederholen,
weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepre-
digt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von
der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schu-
len und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf,
und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Ma-
jorität, die auf seiner Seite ist.“
„Oft lehrt man auch Wahrheit und Irrtum zugleich
und hält sich an letzteren. So las ich vor einigen Ta-
gen in einer englischen Enzyklopädie die Lehre von
der Entstehung des Blauen. Obenan stand die wahre
Ansicht von Leonardo de Vinci; mit der grössten Ruhe
aber folgte zugleich der Newtonsche Irrtum, und zwar
mit den Bemerken, dass man sich an diese zu halten
habe, weil es das allgemein Angenommene sei.“
Ich musste mich lachend verwundern, als ich dieses
horte. „Jede Wachskerze,“ sagte ich, „jeder erleuchtete
T? v vnrauc^> der etwas dunkles hinter sich hat, jeder
dürftige Morgennebel, wenn er vor schattigen Stellen
liegt, überzeugen mich täglich von der Entstehung der
blauen h arbe und lehren mich die Bläue des Himmels
begreifen. Was aber die Newtonschen Schüler sich da-
bei denken mögen, dass die Luft die Eigenschaft be-
sitze, alle übrigen Farben zu verschlucken, und nur die
blaye zurückzuwerfen, dieses ist mir völlig unbegreif-
lich, und ich sehe nicht ein, welchen Nutzen und welche
Freude man an einer Lehre haben kann, wobei jeder
Gedanke stillsteht und jede gesunde Anschauung durch-
aus verschwindet.“
„Gute Seele,“ sagte Goethe, „um Gedanken und An-
schauungen ist es den Leuten nicht zu tun. Sie sind
zufrieden, wenn sie nur Worte haben.“ (Goethe zitiert
hierauf die Stelle aus Faust, wo Mephistopheles den
Schülern sagt: Schon gut! Nur muss man sich nicht
allzu ängstlich quälen: Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.) „Es ist
nur gut,“ sagte er, „dass schon alles gedruckt steht: und
so will ich fortfahren, ferner drucken zu lassen, was
ich gegen falsche Lehren und deren Verbreiter noch
auf dem Herzen habe.“
Donnerstag, den 19. Februar 1829.
. . . Goethe erkundigte sich sodann nach der Far-
benlehre, und ob ich seinem Vorschläge, ein Kompen-
dium zu schreiben, weiter nachgedacht. Ich sagte ihm,
wie es damit stehe, und so gerieten wir unvermutet
in eine Differenz, die ich bei der Wichtigkeit des Ge-
genstandes mitteilen will.
Wer es beobachtet hat, wird sich erinnern, dass
bei heiteren Wintertagen und Sonnenschein die Schatten
auf dem Schnee häufig blau aussehen. Dieses Phäno-
men bringt Goethe in seiner „Farbenlehre“ unter die
subjektiven Erscheinungen, indem er als Grundlage an-
nimmt, dass das Sonnenlicht zu uns, da wir nicht auf
den Gipfeln hoher Berge wohnen, nicht durchaus weis s,
sondern durch eine mehr oder weniger dunstreiche
Atmosphäre dringend, in einen gelblichen Schein her-
abkomme ; und dass also der Schnee, von der Sonne
beschienen, nicht durchaus weiss, sondern eine^ gelb-
lich timpierte Fläche sei, die das Auge zum Gegen-
satz und also zur Hervorbringung der blauen Farbe an-
reize. Der auf dem Schnee gesehen werdende blaue
Schatten sei demnach eine geforderte Farbe, unter
welcher Rubrik Goethe denn auch das Phänomen
abhandelt und danach die von Saussure auf dem Mont-
blanc gemachten Beobachtungen sehr konsequent zu-
rechtlegt.
Als ich nun in diesen Tagen die ersten Kapitel
der „Farbenlehre“ abermals betrachtete, um mich zu
prüfen, ob es mir gelingen möchte, Goethes freund-
licher Aufforderung nachzukommen und ein Kompen-
dium seiner Farbenlehre zu schreiben, war ich, durch
Schnee und Sonnenschein begünstigt, in dem Fall,,
obgedachtes Phänomen des blauen Schattens abermals
näher in Augenschein zu nehmen, wo ich denn zu eini-
ger Ueberraschung fand, dass Goethes Ableitung auf
einem Irrtum beruhe. Wie ich aber zu diesem Apergu
gelangte, will ich sagen.
Aus den Fenstern meines Wohnzimmers sehe ich
gerade gegen Süden, und zwar auf einen Garten, der
durch ein Gebäude begrenzt wird, das bei dem
niederen Stande der Sonne im Winter mir entgegen
einen so grossen Schatten wirft, dass er über die
halbe Fläche des Gartens reicht.
Auf diese Schattenfläche im [Schnee blickte ich
nun vor einigen Tagen bei völlig blauem Himmel und
Sonnenschein und war überrascht, die ganze Masse
vollkommen blau zu sehen. Eine geforderte Farbe,
sagte ich zu mir selber, kann dieses nicht sein, denn
mein Auge wird von keiner von der Sonne beschienenen
Schneefläche berührt, wodurch jener Gegensatz hervor-
gerufen werden könnte; ich sehe nichts als die schattige
blaue Masse. Um aber durchaus sicher* zu gehen und
zu verhindern, dass der blendende Schein der benach-
barten Dächer nicht etwa mein Auge berühre, rollte
ich einen Bogen Papier zusammen und blickte durch
solche Röhre auf die schattige Fläche, wo denn das
Blau unverändert zu sehen blieb. (Fortstzg. folgt.)
Verlag der Werkstatt der Kunst E. A. Seemann in Leipzig