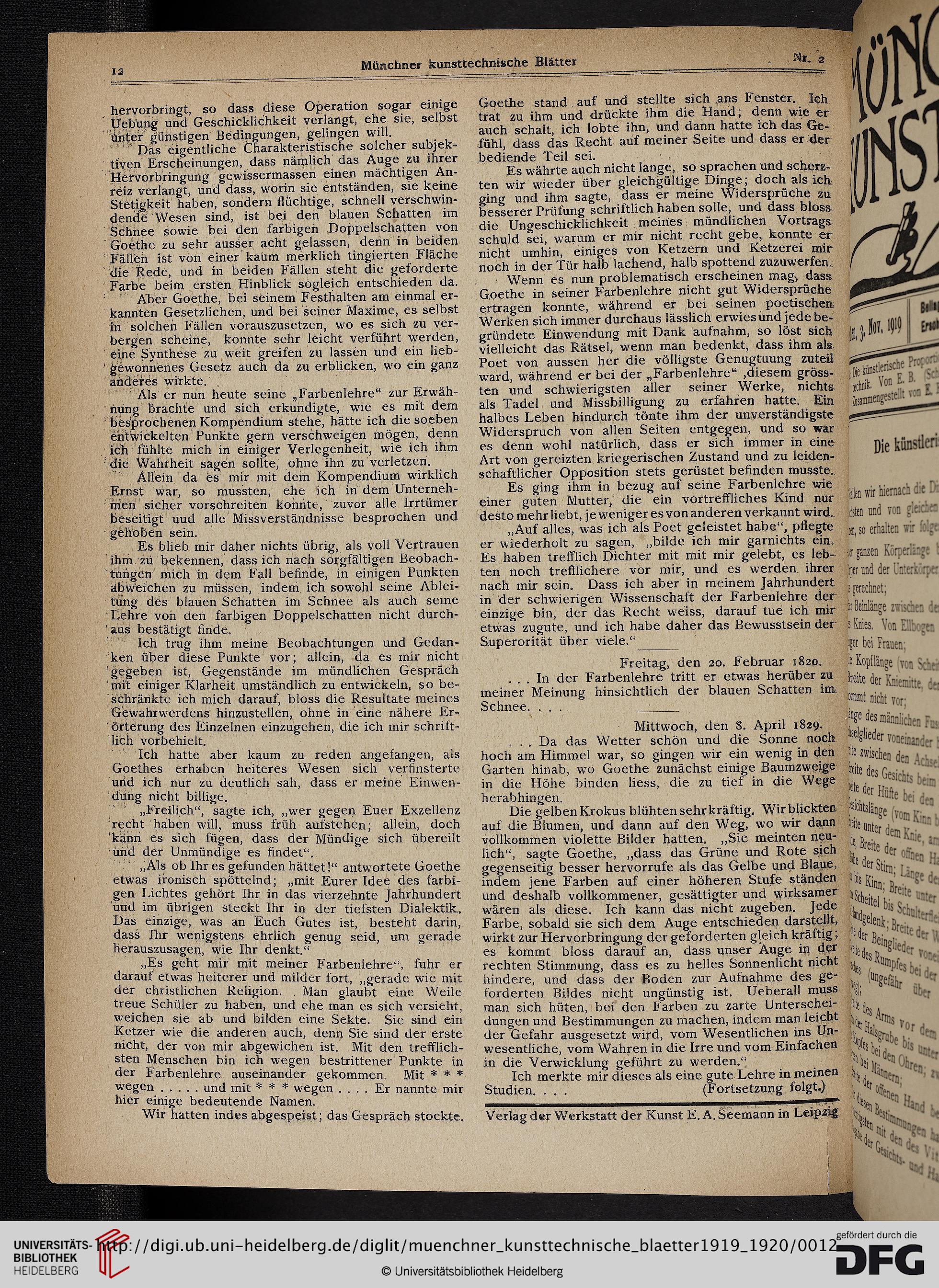I«
Münchner kunsttechnische Blätter
^ Nr*
hervorbringt, so dass diese Operation sogar einige
Uebung und Geschicklichkeit verlangt, ehe sie, selbst
ünter günstigen Bedingungen, gelingen will.
Das eigentliche Charakteristische solcher subjek-
tiven Erscheinungen, dass nämlich das Auge zu ihrer
Hervorbringung gewissermassen einen mächtigen An-
reiz verlangt, und dass, worin sie entständen, sie keine
Stetigkeit haben, sondern flüchtige, schnell verschwin-
dende Wesen sind, ist bei den blauen Schatten im
Schnee sowie bei den farbigen Doppelschatten von
Goethe zu sehr ausser acht gelassen, denn in beiden
Fällen ist von einer kaum merklich tingierten Fläche
die Rede, und in beiden Fällen steht die geforderte
Farbe beim ersten Hinblick sogleich entschieden da.
Aber Goethe, bei seinem Festhalten am einmal er-
kannten Gesetzlichen, und bei seiner Maxime, es selbst
in solchen Fällen vorauszusetzen, wo es sich zu ver-
bergen scheine, konnte sehr leicht verführt werden,
eine Synthese zu weit greifen zu lassen und ein lieb-
gewonnenes Gesetz auch da zu erblicken, wo ein ganz
ahderes wirkte.
Als er nun heute seine „Farbenlehre“ zur Erwäh-
nung brachte und sich erkundigte, wie es mit dem
besprochenen Kompendium stehe, hätte ich die soeben
entwickelten Punkte gern verschweigen mögen, denn
ich fühlte mich in einiger Verlegenheit, wie ich ihm
die Wahrheit sagen sollte, ohne ihn zu verletzen.
Allein da es mir mit dem Kompendium wirklich
Ernst war, so mussten, ehe ich in dem Unterneh-
men sicher vorschreiten konnte, zuvor alle Irrtümer
beseitigt uud alle Missverständnisse besprochen und
gehoben sein.
Es blieb mir daher nichts übrig, als voll Vertrauen
ihm zu bekennen, dass ich nach sorgfältigen Beobach-
tungen mich in dem Fall befinde, in einigen Punkten
äbweichen zu müssen, indem ich sowohl seine Ablei-
tung des blauen Schatten im Schnee als auch seine
Lehre von den farbigen Doppelschatten nicht durch-
aus bestätigt finde.
Ich trug ihm meine Beobachtungen und Gedan-
ken über diese Punkte vor; allein, da es mir nicht
gegeben ist, Gegenstände im mündlichen Gespräch
mit einiger Klarheit umständlich zu entwickeln, so be-
schränkte ich mich darauf, bloss die Resultate meines
Gewahrwerdens hinzustellen, ohne in eine nähere Er-
örterung des Einzelnen einzugehen, die ich mir schrift-
lich vorbehielt.
Ich hatte aber kaum zu reden angefangen, als
Goethes erhaben heiteres Wesen sich verfinsterte
und ich nur zu deutlich sah, dass er meine Einwen-
dung nicht billige.
„Freilich“, sagte ich, „wer gegen Euer Exzellenz
recht haben will, muss früh aufstehen ; allein, doch
kann es sich fügen, dass der Mündige sich übereilt
und der Unmündige es findet“.
„Als ob Ihr es gefunden hättet!“ antwortete Goethe
etwas ironisch spöttelnd; „mit Eurer Idee des farbi-
gen Lichtes gehört Ihr in das vierzehnte Jahrhundert
uud im übrigen steckt Ihr in der tiefsten Dialektik*
Das einzige, was an Euch Gutes ist, besteht darin,
dass Ihr wenigstens ehrlich genug seid, um gerade
herauszusagen, wie Ihr denkt“
„Es geht mir mit meiner Farbenlehre“, fuhr er
darauf etwas heiterer und milder fort, „gerade wie mit
der christlichen Religion. Man glaubt eine Weile
treue Schüler zu haben, und ehe man es sich versieht,
weichen sie ab und bilden eine Sekte. Sie sind ein
Ketzer wie die anderen auch, denn Sie sind der erste
nicht, der von mir abgewichen ist. Mit den trefflich-
sten Menschen bin ich wegen bestrittener Punkte in
der Farbenlehre auseinander gekommen. Mit * * *
wegen
und mit * * *
wegen
Er nannte mir
hier einige bedeutende Namen.
Wir hatten indes abgespeist; das Gespräch stockte.
Goethe stand auf und stellte sich ans Fenster. Ich
trat zu ihm und drückte ihm die Hand; denn wie er
auch schalt, ich lobte ihn, und dann hatte ich das Ge-
fühl, dass das Recht auf meiner Seite und dass er der
bediende Teil sei.
Es währte auch nicht lange, so sprachen und scherz-
ten wir wieder über gleichgültige Dinge; doch als ich
ging und ihm sagte, dass er meine Widersprüche zu
besserer Prüfung schriftlich haben solle, und dass bloss
die Ungeschicklichkeit meines mündlichen Vortrags
schuld sei, warum er mir nicht recht gebe, konnte er
nicht umhin, einiges von Ketzern und Ketzerei mir
noch in der Tür halb lachend, halb spottend zuzuwerfen*
Wenn es nun problematisch erscheinen mag> dass
Goethe in seiner Farbenlehre nicht gut Widersprüche
ertragen konnte, während er bei seinen poetischen
Werken sich immer durchaus lässlich erwies und jede be-
gründete Einwendung mit Dank aufnahm, so löst sich
vielleicht das Rätsel, wenn man bedenkt, dass ihm als
Poet von aussen her die völligste Genugtuung zuteil
ward, während er bei der „Farbenlehre“ ,diesem gröss-
ten und schwierigsten aller seiner Werke, nichts
als Tadel und Missbilligung zu erfahren hatte. Ein
halbes Leben hindurch tönte ihm der unverständigste
Widerspruch von allen Seiten entgegen, und so war
es denn wohl natürlich, dass er sich immer in eine
Art von gereizten kriegerischen Zustand und zu leiden-
schaftlicher Opposition stets gerüstet befinden musste.
Es ging ihm in bezug auf seine Farbenlehre wie
einer guten Mutter, die ein vortreffliches Kind nur
desto mehr liebt, je weniger es von anderen verkannt wird.
„Auf alles, was ich als Poet geleistet habe“, pflegte
er wiederholt zu sagen, „bilde ich mir garnichts ein.
Es haben trefflich Dichter mit mit mir gelebt, es leb-
ten noch trefflichere vor mir, und es werden ihrer
nach mir sein. Dass ich aber in meinem Jahrhundert
in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der
einzige bin, der das Recht weiss, darauf tue ich mir
etwas zugute, und ich habe daher das Bewusstsein der
Superorität über viele.“
Freitag, den 20. Februar 1820.
... In der Farbenlehre tritt er etwas herüber zu
meiner Meinung hinsichtlich der blauen Schatten im
Schnee. , . . _
Mittwoch, den 8. April 1829.
. . . Da das Wetter schön und die Sonne noch
hoch am Himmel war, so gingen wir ein wenig in den
Garten hinab, wo Goethe zunächst einige Baumzweige
in die Höhe binden liess, die zu tief in die Wege
herabhingen.
Die gelben Krokus blühten sehr kräftig. Wir blickten
auf die Blumen, und dann auf den Weg, wo wir dann
vollkommen violette Bilder hatten. „Sie meinten neu-
lich“, sagte Goethe, „dass das Grüne und Rote sich
gegenseitig besser hervorrufe als das Gelbe und Blaue,
indem jene Farben auf einer höheren Stufe ständen
und deshalb vollkommener, gesättigter und wirksamer
wären als diese. Ich kann das nicht zugeben. Jede
Farbe, sobald sie sich dem Auge entschieden darstellt,
wirkt zur Hervorbringung der geforderten gleich kräftig;
es kommt bloss darauf an, dass unser Äuge in der
rechten Stimmung, dass es zu helles Sonnenlicht nicht
hindere, und dass der Boden zur Aufnahme des ge-
forderten Bildes nicht ungünstig ist. Ueberall muss
man sich hüten, bei den Farben zu zarte Unterschei-
dungen und Bestimmungen zu machen, indem man leicht
der Gefahr ausgesetzt wird, vom Wesentlichen ins Un-
wesentliche, vom Wahren in die Irre und vom Einfachen
in die Verwacklung geführt zu werden.“
Ich merkte mir dieses als eine gute Lehre in meinen
Studien. . . . (Fortsetzung folgt.)
Verlag der Werkstatt der Kunst E.A. Seemann in Leipzig
Die kün
Iden wir hiernach
pten und tob fl
a, so erhalten wir
i ganzen Körperi.
|nr und der Unter''
| gerechnet;
a Beinläßge zwisd»
| Knies. Von Eflh
|ger bei Frauen:
* Kopflänge tob
freite der Knienüt
■.«nt nicht vor:
männliche
4 zwischen de"
fite des Gesichts
|ite der Hüfte
»länge,Vom Ir
ieife “«er dem K-*
Breite der
Hr Stirn;]r?
f%lenk;B?r
k der d « re,fe r
i', r ip/c
Ne ik p
% SfesK,
* (»»7
|des a
Pdp,,? %$ tv
■ ‘Hu
VS*.
Münchner kunsttechnische Blätter
^ Nr*
hervorbringt, so dass diese Operation sogar einige
Uebung und Geschicklichkeit verlangt, ehe sie, selbst
ünter günstigen Bedingungen, gelingen will.
Das eigentliche Charakteristische solcher subjek-
tiven Erscheinungen, dass nämlich das Auge zu ihrer
Hervorbringung gewissermassen einen mächtigen An-
reiz verlangt, und dass, worin sie entständen, sie keine
Stetigkeit haben, sondern flüchtige, schnell verschwin-
dende Wesen sind, ist bei den blauen Schatten im
Schnee sowie bei den farbigen Doppelschatten von
Goethe zu sehr ausser acht gelassen, denn in beiden
Fällen ist von einer kaum merklich tingierten Fläche
die Rede, und in beiden Fällen steht die geforderte
Farbe beim ersten Hinblick sogleich entschieden da.
Aber Goethe, bei seinem Festhalten am einmal er-
kannten Gesetzlichen, und bei seiner Maxime, es selbst
in solchen Fällen vorauszusetzen, wo es sich zu ver-
bergen scheine, konnte sehr leicht verführt werden,
eine Synthese zu weit greifen zu lassen und ein lieb-
gewonnenes Gesetz auch da zu erblicken, wo ein ganz
ahderes wirkte.
Als er nun heute seine „Farbenlehre“ zur Erwäh-
nung brachte und sich erkundigte, wie es mit dem
besprochenen Kompendium stehe, hätte ich die soeben
entwickelten Punkte gern verschweigen mögen, denn
ich fühlte mich in einiger Verlegenheit, wie ich ihm
die Wahrheit sagen sollte, ohne ihn zu verletzen.
Allein da es mir mit dem Kompendium wirklich
Ernst war, so mussten, ehe ich in dem Unterneh-
men sicher vorschreiten konnte, zuvor alle Irrtümer
beseitigt uud alle Missverständnisse besprochen und
gehoben sein.
Es blieb mir daher nichts übrig, als voll Vertrauen
ihm zu bekennen, dass ich nach sorgfältigen Beobach-
tungen mich in dem Fall befinde, in einigen Punkten
äbweichen zu müssen, indem ich sowohl seine Ablei-
tung des blauen Schatten im Schnee als auch seine
Lehre von den farbigen Doppelschatten nicht durch-
aus bestätigt finde.
Ich trug ihm meine Beobachtungen und Gedan-
ken über diese Punkte vor; allein, da es mir nicht
gegeben ist, Gegenstände im mündlichen Gespräch
mit einiger Klarheit umständlich zu entwickeln, so be-
schränkte ich mich darauf, bloss die Resultate meines
Gewahrwerdens hinzustellen, ohne in eine nähere Er-
örterung des Einzelnen einzugehen, die ich mir schrift-
lich vorbehielt.
Ich hatte aber kaum zu reden angefangen, als
Goethes erhaben heiteres Wesen sich verfinsterte
und ich nur zu deutlich sah, dass er meine Einwen-
dung nicht billige.
„Freilich“, sagte ich, „wer gegen Euer Exzellenz
recht haben will, muss früh aufstehen ; allein, doch
kann es sich fügen, dass der Mündige sich übereilt
und der Unmündige es findet“.
„Als ob Ihr es gefunden hättet!“ antwortete Goethe
etwas ironisch spöttelnd; „mit Eurer Idee des farbi-
gen Lichtes gehört Ihr in das vierzehnte Jahrhundert
uud im übrigen steckt Ihr in der tiefsten Dialektik*
Das einzige, was an Euch Gutes ist, besteht darin,
dass Ihr wenigstens ehrlich genug seid, um gerade
herauszusagen, wie Ihr denkt“
„Es geht mir mit meiner Farbenlehre“, fuhr er
darauf etwas heiterer und milder fort, „gerade wie mit
der christlichen Religion. Man glaubt eine Weile
treue Schüler zu haben, und ehe man es sich versieht,
weichen sie ab und bilden eine Sekte. Sie sind ein
Ketzer wie die anderen auch, denn Sie sind der erste
nicht, der von mir abgewichen ist. Mit den trefflich-
sten Menschen bin ich wegen bestrittener Punkte in
der Farbenlehre auseinander gekommen. Mit * * *
wegen
und mit * * *
wegen
Er nannte mir
hier einige bedeutende Namen.
Wir hatten indes abgespeist; das Gespräch stockte.
Goethe stand auf und stellte sich ans Fenster. Ich
trat zu ihm und drückte ihm die Hand; denn wie er
auch schalt, ich lobte ihn, und dann hatte ich das Ge-
fühl, dass das Recht auf meiner Seite und dass er der
bediende Teil sei.
Es währte auch nicht lange, so sprachen und scherz-
ten wir wieder über gleichgültige Dinge; doch als ich
ging und ihm sagte, dass er meine Widersprüche zu
besserer Prüfung schriftlich haben solle, und dass bloss
die Ungeschicklichkeit meines mündlichen Vortrags
schuld sei, warum er mir nicht recht gebe, konnte er
nicht umhin, einiges von Ketzern und Ketzerei mir
noch in der Tür halb lachend, halb spottend zuzuwerfen*
Wenn es nun problematisch erscheinen mag> dass
Goethe in seiner Farbenlehre nicht gut Widersprüche
ertragen konnte, während er bei seinen poetischen
Werken sich immer durchaus lässlich erwies und jede be-
gründete Einwendung mit Dank aufnahm, so löst sich
vielleicht das Rätsel, wenn man bedenkt, dass ihm als
Poet von aussen her die völligste Genugtuung zuteil
ward, während er bei der „Farbenlehre“ ,diesem gröss-
ten und schwierigsten aller seiner Werke, nichts
als Tadel und Missbilligung zu erfahren hatte. Ein
halbes Leben hindurch tönte ihm der unverständigste
Widerspruch von allen Seiten entgegen, und so war
es denn wohl natürlich, dass er sich immer in eine
Art von gereizten kriegerischen Zustand und zu leiden-
schaftlicher Opposition stets gerüstet befinden musste.
Es ging ihm in bezug auf seine Farbenlehre wie
einer guten Mutter, die ein vortreffliches Kind nur
desto mehr liebt, je weniger es von anderen verkannt wird.
„Auf alles, was ich als Poet geleistet habe“, pflegte
er wiederholt zu sagen, „bilde ich mir garnichts ein.
Es haben trefflich Dichter mit mit mir gelebt, es leb-
ten noch trefflichere vor mir, und es werden ihrer
nach mir sein. Dass ich aber in meinem Jahrhundert
in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der
einzige bin, der das Recht weiss, darauf tue ich mir
etwas zugute, und ich habe daher das Bewusstsein der
Superorität über viele.“
Freitag, den 20. Februar 1820.
... In der Farbenlehre tritt er etwas herüber zu
meiner Meinung hinsichtlich der blauen Schatten im
Schnee. , . . _
Mittwoch, den 8. April 1829.
. . . Da das Wetter schön und die Sonne noch
hoch am Himmel war, so gingen wir ein wenig in den
Garten hinab, wo Goethe zunächst einige Baumzweige
in die Höhe binden liess, die zu tief in die Wege
herabhingen.
Die gelben Krokus blühten sehr kräftig. Wir blickten
auf die Blumen, und dann auf den Weg, wo wir dann
vollkommen violette Bilder hatten. „Sie meinten neu-
lich“, sagte Goethe, „dass das Grüne und Rote sich
gegenseitig besser hervorrufe als das Gelbe und Blaue,
indem jene Farben auf einer höheren Stufe ständen
und deshalb vollkommener, gesättigter und wirksamer
wären als diese. Ich kann das nicht zugeben. Jede
Farbe, sobald sie sich dem Auge entschieden darstellt,
wirkt zur Hervorbringung der geforderten gleich kräftig;
es kommt bloss darauf an, dass unser Äuge in der
rechten Stimmung, dass es zu helles Sonnenlicht nicht
hindere, und dass der Boden zur Aufnahme des ge-
forderten Bildes nicht ungünstig ist. Ueberall muss
man sich hüten, bei den Farben zu zarte Unterschei-
dungen und Bestimmungen zu machen, indem man leicht
der Gefahr ausgesetzt wird, vom Wesentlichen ins Un-
wesentliche, vom Wahren in die Irre und vom Einfachen
in die Verwacklung geführt zu werden.“
Ich merkte mir dieses als eine gute Lehre in meinen
Studien. . . . (Fortsetzung folgt.)
Verlag der Werkstatt der Kunst E.A. Seemann in Leipzig
Die kün
Iden wir hiernach
pten und tob fl
a, so erhalten wir
i ganzen Körperi.
|nr und der Unter''
| gerechnet;
a Beinläßge zwisd»
| Knies. Von Eflh
|ger bei Frauen:
* Kopflänge tob
freite der Knienüt
■.«nt nicht vor:
männliche
4 zwischen de"
fite des Gesichts
|ite der Hüfte
»länge,Vom Ir
ieife “«er dem K-*
Breite der
Hr Stirn;]r?
f%lenk;B?r
k der d « re,fe r
i', r ip/c
Ne ik p
% SfesK,
* (»»7
|des a
Pdp,,? %$ tv
■ ‘Hu
VS*.