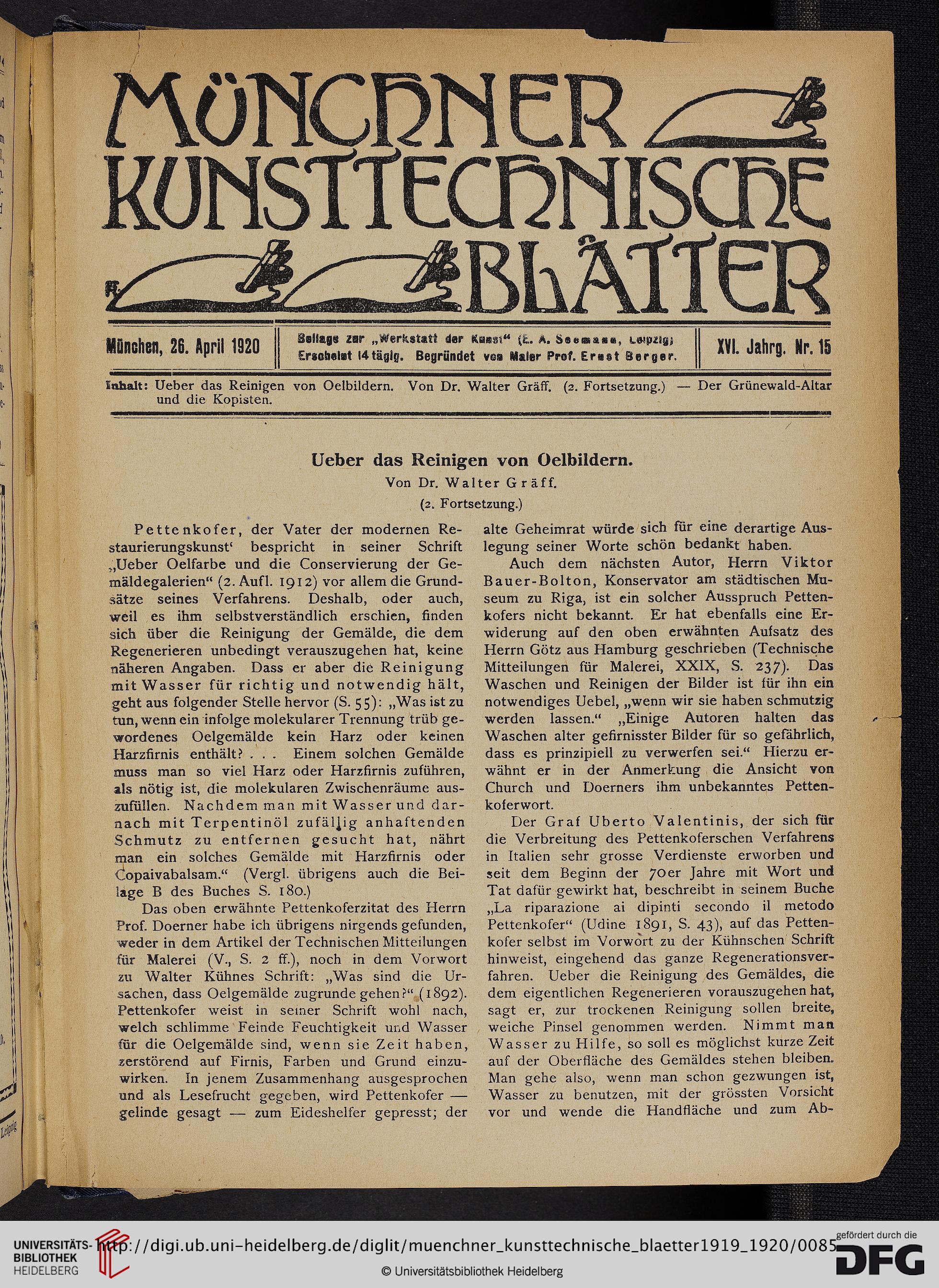MSnchett, 26. April 1920
Sflllag« iwr „Werkstatt der Haast“ (E. A. Seeaaaa, unpagj
Ersobalat 14tägig. Begründet voa Maler Prof. Ernst Berger.
XVI. Jahrg. Nr. IS
Inhalt: Ueber das Reinigen von Oelbildern. Von Dr. Walter Gräff. (2. Fortsetzung.)
und die Kopisten.
Der Grünewald-Altar
Ueber das Reinigen von Oelbildern.
Von Dr. Walter Gräff.
(2. Fortsetzung.)
Pettenkofer, der Vater der modernen Re-
staurierungskunsf bespricht in seiner Schrift
„Ueber Oelfarbe und die Conservierung der Ge-
mäldegalerien“ (2. Aufh 1912) vor allem die Grund-
sätze seines Verfahrens. Deshalb, oder auch,
weil es ihm selbstverständlich erschien, finden
sich über die Reinigung der Gemälde, die dem
Regenerieren unbedingt verauszugehen hat, keine
näheren Angaben. Dass er aber die Reinigung
mit Wasser für richtig und notwendig hält,
geht aus folgender Stelle hervor (S. 55): „Was ist zu
tun, wenn ein infolge molekularer Trennung trüb ge-
wordenes Oelgemälde kein Harz oder keinen
Harzfirnis enthält? . . . Einem solchen Gemälde
muss man so viel Harz oder Harzfirnis zuführen,
als nötig ist, die molekularen Zwischenräume aus-
zufüllen. Nachdem man mit Wasser und dar-
nach mit Terpentinöl zufällig anhaftenden
Schmutz zu entfernen gesucht hat, nährt
man ein solches Gemälde mit Harzfirnis oder
<!opaivabalsam.“ (Vergl. übrigens auch die Bei-
lage B des Buches S. 180.)
Das oben erwähnte Pettenkoferzitat des Herrn
Prof. Doerner habe ich übrigens nirgends gefunden,
weder in dem Artikel der Technischen Mitteilungen
für Malerei (V., S. 2 ff.), noch in dem Vorwort
zu Walter Kühnes Schrift: „Was sind die Ur-
sachen, dass Oelgemälde zugrunde gehen?“ (1892).
Pettenkofer weist in seiner Schrift wohl nach,
welch schlimme Feinde Feuchtigkeit und Wasser
für die Oelgemälde sind, wenn sie Zeit haben,
zerstörend auf Firnis, Farben und Grund einzu-
wirken. In jenem Zusammenhang ausgesprochen
und als Lesefrucht gegeben, wird Pettenkofer —
gelinde gesagt — zum Eideshelfer gepresst; der
alte Geheimrat würde sich für eine derartige Aus-
legung seiner Worte schön bedankt haben.
Auch dem nächsten Autor, Herrn Viktor
Bauer-Bolton, Konservator am städtischen Mu-
seum zu Riga, ist ein solcher Ausspruch Petten-
kofers nicht bekannt. Er hat ebenfalls eine Er-
widerung auf den oben erwähnten Aufsatz des
Herrn Götz aus Hamburg geschrieben (Technische
Mitteilungen für Malerei, XXIX, S. 237). Das
Waschen und Reinigen der Bilder ist für ihn ein
notwendiges Uebel, „wenn wir sie haben schmutzig
werden lassen.“ „Einige Autoren halten das
Waschen alter gefirnisster Bilder für so gefährlich,
dass es prinzipiell zu verwerfen sei.“ Hierzu er-
wähnt er in der Anmerkung die Ansicht von
Church und Doerners ihm unbekanntes Petten-
koferwort.
Der Graf Uberto Valentinis, der sich für
die Verbreitung des Pettenkoferschen Verfahrens
in Italien sehr grosse Verdienste erworben und
seit dem Beginn der 70er Jahre mit Wort und
Tat dafür gewirkt hat, beschreibt in seinem Buche
„La riparazione ai dipinti secondo il metodo
Pettenkofer“ (Udine 1891, S. 43), auf das Petten-
kofer selbst im Vorwort zu der Kühnschen Schrift
hinweist, eingehend das ganze Regenerationsver-
fahren. Ueber die Reinigung des Gemäldes, die
dem eigentlichen Regenerieren vorauszugehen hat,
sagt er, zur trockenen Reinigung sollen breite,
weiche Pinsel genommen werden. Nimmt man
Wasser zu Hilfe, so soll es möglichst kurze Zeit
auf der Oberfläche des Gemäldes stehen bleiben«.
Man gehe also, wenn man schon gezwungen ist,
Wasser zu benutzen, mit der grössten Vorsicht
vor und wende die Handfläche und zum Ab-