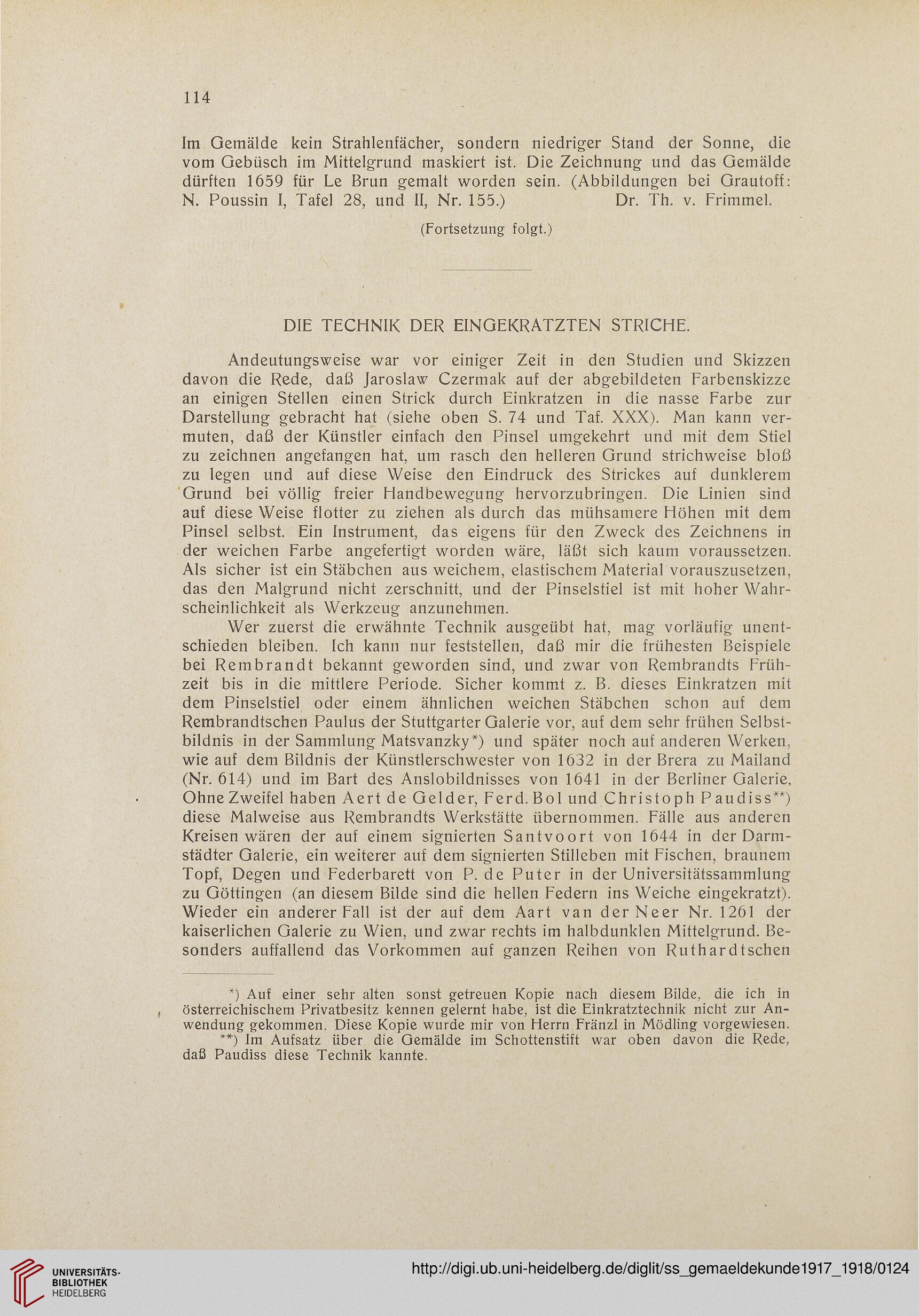114
Im Gemälde kein Strahlenfächer, sondern niedriger Stand der Sonne, die
vom Gebüsch im Mittelgrund maskiert ist. Die Zeichnung und das Gemälde
dürften 1659 für Le Brun gemalt worden sein. (Abbildungen bei Grautoff:
N. Poussin I, Tafel 28, und II, Nr. 155.) Dr. Th. v. Frimmel.
(Fortsetzung folgt.)
DIE TECHNIK DER EINGEKRATZTEN STRICHE.
Andeutungsweise war vor einiger Zeit in den Studien und Skizzen
davon die Rede, daß Jaroslaw Czermak auf der abgebildeten Farbenskizze
an einigen Stellen einen Strick durch Einkratzen in die nasse Farbe zur
Darstellung gebracht hat (siehe oben S. 74 und Taf. XXX). Man kann ver-
muten, daß der Künstler einfach den Pinsel umgekehrt und mit dem Stiel
zu zeichnen angefangen hat, um rasch den helleren Grund strichweise bloß
zu legen und auf diese Weise den Eindruck des Strickes auf dunklerem
Grund bei völlig freier Handbewegung hervorzubringen. Die Linien sind
auf diese Weise flotter zu ziehen als durch das mühsamere Höhen mit dem
Pinsel selbst. Ein Instrument, das eigens für den Zweck des Zeichnens in
der weichen Farbe angefertigt worden wäre, läßt sich kaum voraussetzen.
Als sicher ist ein Stäbchen aus weichem, elastischem Material vorauszusetzen,
das den Malgrund nicht zerschnitt, und der Pinselstiel ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit als Werkzeug anzunehmen.
Wer zuerst die erwähnte Technik ausgeübt hat, mag vorläufig unent-
schieden bleiben. Ich kann nur feststellen, daß mir die frühesten Beispiele
bei Rembrandt bekannt geworden sind, und zwar von Rembrandts Früh-
zeit bis in die mittlere Periode. Sicher kommt z. B. dieses Einkratzen mit
dem Pinselstiel oder einem ähnlichen weichen Stäbchen schon auf dem
Rembrandtschen Paulus der Stuttgarter Galerie vor, auf dem sehr frühen Selbst-
bildnis in der Sammlung Matsvanzky*) und später noch auf anderen Werken,
wie auf dem Bildnis der Künstlerschwester von 1632 in der Brera zu Mailand
(Nr. 614) und im Bart des Anslobildnisses von 1641 in der Berliner Galerie,
Ohne Zweifel haben Aert de Gelder, Ferd. Boi und Christoph Paudiss**)
diese Malweise aus Rembrandts Werkstätte übernommen. Fälle aus anderen
Kreisen wären der auf einem signierten Santvoort von 1644 in der Darm-
städter Galerie, ein weiterer auf dem signierten Stilleben mit Fischen, braunem
Topf, Degen und Federbarett von P. de Puter in der Universitätssammlung
zu Göttingen (an diesem Bilde sind die hellen Federn ins Weiche eingekratzt).
Wieder ein anderer Fall ist der auf dem Aart van der Neer Nr. 1261 der
kaiserlichen Galerie zu Wien, und zwar rechts im halbdunklen Mittelgrund. Be-
sonders auffallend das Vorkommen auf ganzen Reihen von Ruthardtschen
*) Auf einer sehr alten sonst getreuen Kopie nach diesem Bilde, die ich in
österreichischem Privatbesitz kennen gelernt habe, ist die Einkratztechnik nicht zur An-
wendung gekommen. Diese Kopie wurde mir von Herrn Fränzl in Mödling vorgewiesen.
**) Im Aufsatz über die Gemälde im Schottenstift war oben davon die Rede,
daß Paudiss diese Technik kannte.
Im Gemälde kein Strahlenfächer, sondern niedriger Stand der Sonne, die
vom Gebüsch im Mittelgrund maskiert ist. Die Zeichnung und das Gemälde
dürften 1659 für Le Brun gemalt worden sein. (Abbildungen bei Grautoff:
N. Poussin I, Tafel 28, und II, Nr. 155.) Dr. Th. v. Frimmel.
(Fortsetzung folgt.)
DIE TECHNIK DER EINGEKRATZTEN STRICHE.
Andeutungsweise war vor einiger Zeit in den Studien und Skizzen
davon die Rede, daß Jaroslaw Czermak auf der abgebildeten Farbenskizze
an einigen Stellen einen Strick durch Einkratzen in die nasse Farbe zur
Darstellung gebracht hat (siehe oben S. 74 und Taf. XXX). Man kann ver-
muten, daß der Künstler einfach den Pinsel umgekehrt und mit dem Stiel
zu zeichnen angefangen hat, um rasch den helleren Grund strichweise bloß
zu legen und auf diese Weise den Eindruck des Strickes auf dunklerem
Grund bei völlig freier Handbewegung hervorzubringen. Die Linien sind
auf diese Weise flotter zu ziehen als durch das mühsamere Höhen mit dem
Pinsel selbst. Ein Instrument, das eigens für den Zweck des Zeichnens in
der weichen Farbe angefertigt worden wäre, läßt sich kaum voraussetzen.
Als sicher ist ein Stäbchen aus weichem, elastischem Material vorauszusetzen,
das den Malgrund nicht zerschnitt, und der Pinselstiel ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit als Werkzeug anzunehmen.
Wer zuerst die erwähnte Technik ausgeübt hat, mag vorläufig unent-
schieden bleiben. Ich kann nur feststellen, daß mir die frühesten Beispiele
bei Rembrandt bekannt geworden sind, und zwar von Rembrandts Früh-
zeit bis in die mittlere Periode. Sicher kommt z. B. dieses Einkratzen mit
dem Pinselstiel oder einem ähnlichen weichen Stäbchen schon auf dem
Rembrandtschen Paulus der Stuttgarter Galerie vor, auf dem sehr frühen Selbst-
bildnis in der Sammlung Matsvanzky*) und später noch auf anderen Werken,
wie auf dem Bildnis der Künstlerschwester von 1632 in der Brera zu Mailand
(Nr. 614) und im Bart des Anslobildnisses von 1641 in der Berliner Galerie,
Ohne Zweifel haben Aert de Gelder, Ferd. Boi und Christoph Paudiss**)
diese Malweise aus Rembrandts Werkstätte übernommen. Fälle aus anderen
Kreisen wären der auf einem signierten Santvoort von 1644 in der Darm-
städter Galerie, ein weiterer auf dem signierten Stilleben mit Fischen, braunem
Topf, Degen und Federbarett von P. de Puter in der Universitätssammlung
zu Göttingen (an diesem Bilde sind die hellen Federn ins Weiche eingekratzt).
Wieder ein anderer Fall ist der auf dem Aart van der Neer Nr. 1261 der
kaiserlichen Galerie zu Wien, und zwar rechts im halbdunklen Mittelgrund. Be-
sonders auffallend das Vorkommen auf ganzen Reihen von Ruthardtschen
*) Auf einer sehr alten sonst getreuen Kopie nach diesem Bilde, die ich in
österreichischem Privatbesitz kennen gelernt habe, ist die Einkratztechnik nicht zur An-
wendung gekommen. Diese Kopie wurde mir von Herrn Fränzl in Mödling vorgewiesen.
**) Im Aufsatz über die Gemälde im Schottenstift war oben davon die Rede,
daß Paudiss diese Technik kannte.