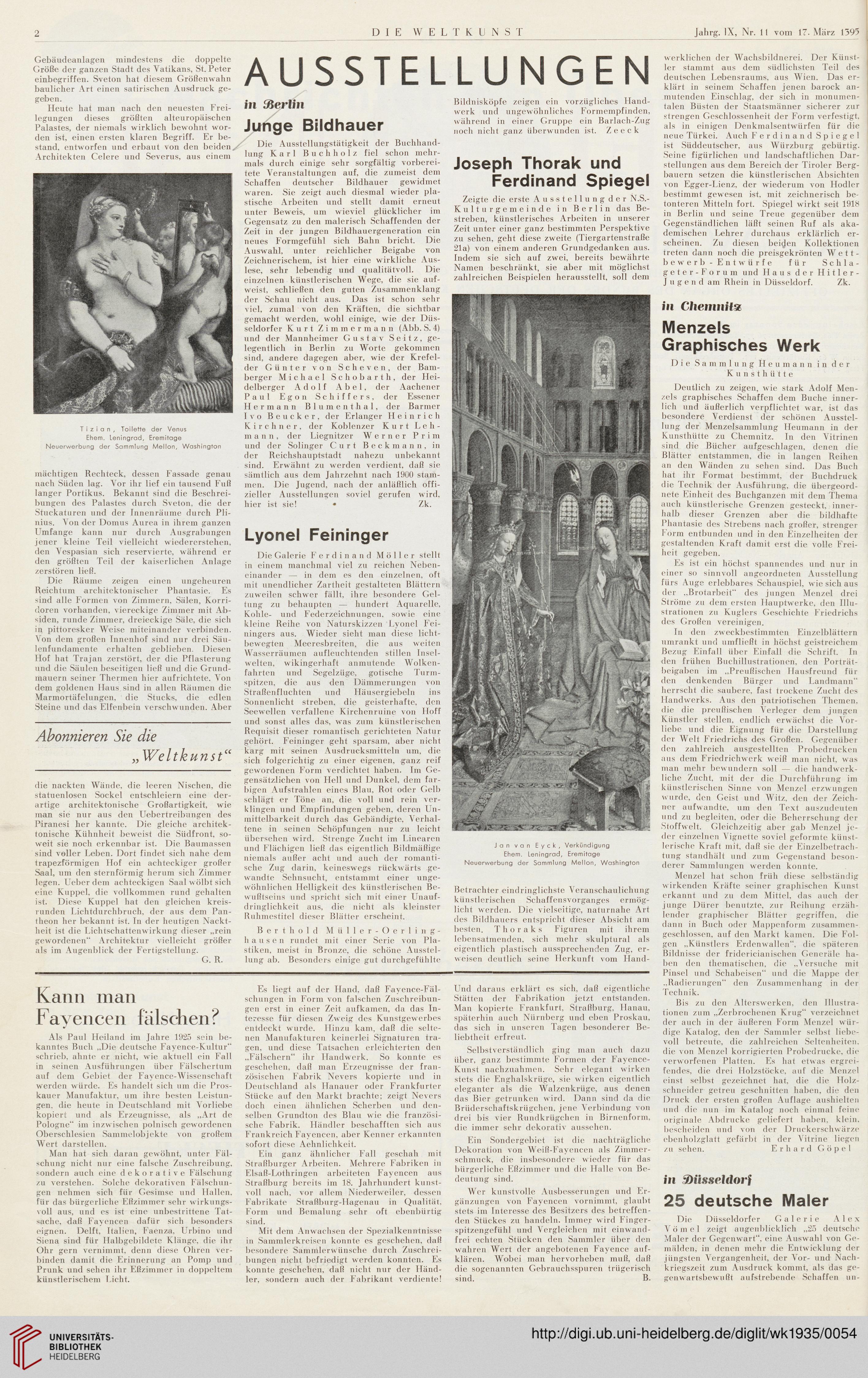2
DIE WELTKUNST
Jahrg. IX, Nr. II vom 17. März 1595
Gebäudeanlagen mindestens die doppelte
Größe der ganzen Stadt des Vatikans, St. Peter
einbegriffen. Sveton hat diesem Größenwahn
banlicher Art einen satirischen Ausdruck ge-
geben.
Heute hat man nach den neuesten Frei-
legungen dieses größten alteuropäischen
Palastes, der niemals wirklich bewohnt wor-
den ist, einen ersten klaren Begriff. Er be-
stand. entworfen und erbaut von den beiden
Architekten Celere und Severus, aus einem
Tizian, Toilette der Venus
Ehern. Leningrad, Eremitage
Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington
mächtigen Rechteck, dessen Fassade genau
nach Süden lag. Vor ihr lief ein tausend Fuß
langer Portikus. Bekannt sind die Beschrei-
bungen des Palastes durch Sveton, die der
Stuckaturen und der Innenräume durch Pli-
nius. Von der Domus Aurea in ihrem ganzen
Umfange kann nur durch Ausgrabungen
jener kleine Teil vielleicht wiedererstehen,
den Vespasian sich reservierte, während er
den größten Teil der kaiserlichen Anlage
zerstören ließ.
Die Räume zeigen einen ungeheuren
Reichtum architektonischer Phantasie. Es
sind alle Formen von Zimmern, Sälen, Korri-
doren vorhanden, viereckige Zimmer mit Ab-
siden, runde Zimmer, dreieckige Säle, die sich
in pittoresker Weise miteinander verbinden.
Von dem großen Innenhof sind nur drei Säu-
lenfundamente erhalten geblieben. Diesen
Hof hat Trajan zerstört, der die Pflasterung
und die Säulen beseitigen ließ und die Grund-
mauern seiner Thermen hier aufrichtete. Von
dem goldenen Haus sind in allen Räumen die
Marmortäfelungen, die Stucks, die edlen
Steine und das Elfenbein verschwunden. Aber
Abonnieren Sie die
„ Weltkunst“
die nackten Wände, die leeren Nischen, die
statuenlosen Sockel entschleiern eine der-
artige architektonische Großartigkeit, wie
man sie nur aus den Uebertreibungen des
Piranesi her kannte. Die gleiche architek-
tonische Kühnheit beweist die Südfront, so-
weit sie noch erkennbar ist. Die Baumassen
sind voller Leben. Dort findet sich nahe dem
trapezförmigen Hof ein achteckiger großer
Saal, um den sternförmig herum sich Zimmer
legen. Ueber dem achteckigen Saal wölbt sich
eine Kuppel, die vollkommen rund gehalten
ist. Diese Kuppel hat den gleichen kreis-
runden Lichtdurchbruch, der aus dem Pan-
theon her bekannt ist. In der heutigen Nackt-
heit ist die Lichtschattenwirkung dieser „rein
gewordenen“ Architektur vielleicht größer
als im Augenblick der Fertigstellung.
G. R.
AUSSTEL
in SJerlin
Junge Bildhauer
Die Ausstellungstätigkeit der Buchhand-
lung Karl Buchholz fiel schon mehr-
mals durch einige sehr sorgfältig vorberei-
tete Veranstaltungen auf. die zumeist dem
Schaffen deutscher Bildhauer gewidmet
waren. Sie zeigt auch diesmal wieder pla-
stische Arbeiten und stellt damit erneut
unter Beweis, um wieviel glücklicher im
Gegensatz zu den malerisch Schaffenden der
Zeit in der jungen Bildhauergeneration ein
neues Formgefühl sich Bahn bricht. Die
Auswahl, unter reichlicher Beigabe von
Zeichnerischem, ist hier eine wirkliche Aus-
lese, sehr lebendig und qualitätvoll. Die
einzelnen künstlerischen Wege, die sie auf-
weist, schließen den guten Zusammenklang
der Schau nicht aus. Das ist schon sehr
viel, zumal von den Kräften, die sichtbar
gemacht werden, wohl einige, wie der Düs-
seldorfer Kurt Zimmermann (Abb. S. 4)
und der Mannheimer Gustav Seitz, ge-
legentlich in Berlin zu Worte gekommen
sind, andere dagegen aber, wie der Krefel-
der Günter von Scheven, der Bam-
berger Michael Schob ar th, der Hei-
delberger Adolf Abel, der Aachener
Paul Egon Schiffers, der Essener
Hermann Blumenthal, der Barmer
Ivo Beucker, der Erlanger Heinrich
Kirchner, der Koblenzer Kurt Leh-
mann, der Liegnitzer Werner Prim
und der Solinger Curt Beckmann, in
der Reichshauptstadt nahezu unbekannt
sind. Erwähnt zu werden verdient, daß sie
sämtlich aus dem Jahrzehnt nach 1900 stam-
men. Die Jugend, nach der anläßlich offi-
zieller Ausstellungen soviel gerufen wird,
hier ist sie! • Zk.
Lyonei Feininger
Die Galerie Ferdinand Möller stellt
in einem manchmal viel zu reichen Neben-
einander — in dem es den einzelnen, oft
mit unendlicher Zartheit gestalteten Blättern
zuweilen schwer fällt, ihre besondere Gel-
tung zu behaupten — hundert Aquarelle,
Kohle- und Federzeichnungen, sowie eine
kleine Reihe von Naturskizzen Lyonei Fei-
ningers aus. Wieder sieht man diese licht-
bewegten Meeresbreiten, die aus weiten
Wasserräumen aufleuchtenden stillen Insel-
welten, wikingerhaft anmutende Wolken-
fahrten und Segelziige, gotische Turm-
spitzen, die aus den Dämmerungen von
Straßenfluchten und Häusergiebeln ins
Sonnenlicht streben, die geisterhafte, den
Seewellen verfallene Kirchenruine von Hoff
und sonst alles das, was zum künstlerischen
Requisit dieser romantisch gerichteten Natur
gehört. Feininger geht sparsam, aber nicht
karg mit seinen Ausdrucksmitteln um, die
sich folgerichtig zu einer eigenen, ganz reif
gewordenen Form verdichtet haben. Im Ge-
gensätzlichen von Hell und Dunkel, dem far-
bigen Aufstrahlen eines Blau, Rot oder Gelb
schlägt er Töne an, die voll und rein ver-
klingen und Empfindungen geben, deren Un-
mittelbarkeit durch das Gebändigte, Verhal-
tene in seinen Schöpfungen nur zu leicht
übersehen wird. Strenge Zucht im Linearen
und Flächigen ließ das eigentlich Bildmäßige
niemals außer acht und auch der romanti-
sche Zug darin, keineswegs rückwärts ge-
wandte Sehnsucht, entstammt einer unge-
wöhnlichen Helligkeit des künstlerischen Be-
wußtseins und spricht sich mit einer Unauf-
dringlichkeit aus, die nicht als kleinster
Ruhmestitel dieser Blätter erscheint.
Berthold Müller-Oerling-
h aus en rundet mit einer Serie von Pla-
stiken, meist in Bronze, die schöne Ausstel-
lung ab. Besonders einige gut durchgefühlte
LUNGEN
Bildnisköpfe zeigen ein vorzügliches Hand-
werk und ungewöhnliches Formempfinden,
während in einer Gruppe ein Barlach-Zug
noch nicht ganz überwunden ist. Z e e c k
Joseph Thorak und
Ferdinand Spiegel
Zeigte die erste Ausstellung der N.S.-
Kultur gemein de in Berlin das Be-
streben, künstlerisches Arbeiten in unserer
Zeit unter einer ganz bestimmten Perspektive
zu sehen, geht diese zweite (Tiergartenstraße
21a) von einem anderen Grundgedanken aus.
Indem sie sich auf zwei, bereits bewährte
Namen beschränkt, sie aber mit möglichst
zahlreichen Beispielen herausstellt, soll dem
Jan van Eyck, Verkündigung
Ehern. Leningrad, Eremitage
Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington
Betrachter eindringlichste Veranschaulichung
künstlerischen Schaffensvorganges ermög-
licht werden. Die vielseitige, naturnahe Art
des Bildhauers entspricht dieser Absicht am
besten. Thoraks Figuren mit ihrem
lebensatmenden, sich mehr skulptural als
eigentlich plastisch aussprechenden Zug, er-
weisen deutlich seine Herkunft vom Hand-
Kann man
Fayen een fälschen ?
Als Paul Heiland im Jahre 1925 sein be-
kanntes Buch „Die deutsche Fayence-Kultur“
schrieb, ahnte er nicht, wie aktuell ein Fall
in seinen Ausführungen über Fälschertum
auf dem Gebiet der Fayence-Wissenschaft
werden würde. Es handelt sich um die Pros-
kauer Manufaktur, um ihre besten Leistun-
gen. die heute in Deutschland mit Vorliebe
kopiert und als Erzeugnisse, als „Art de
Pologne“ im inzwischen polnisch gewordenen
Oberschlesien Sammelobjekte von großem
Wert darstellen.
Man hat sich daran gewöhnt, unter Fäl-
schung nicht nur eine falsche Zuschreibung,
sondern auch eine dekorative Fälschung
zu verstehen. Solche dekorativen Fälschun-
gen nehmen sich für Gesimse und Hallen,
für das bürgerliche Eßzimmer sehr wirkungs-
voll aus, und es ist eine unbestrittene Tat-
sache, daß Fayencen dafür sich besonders
eignen. Delft, Italien, Faenzia, Urbino und
Siena sind für Halbgebildete Klänge, die ihr
Ohr gern vernimmt, denn diese Ohren ver-
binden damit die Erinnerung an Pomp und
Prunk und sehen ihr Eßzimmer in doppeltem
künstlerischem Licht.
Es liegt auf der Hand, daß Fayence-Fäl-
schungen in Form von falschen Zuschreibun-
gen erst in einer Zeit aufkamen, da das In-
teresse für diesen Zweig des Kunstgewerbes
entdeckt wurde. Hinzu kam, daß die selte-
nen Manufakturen keinerlei Signaturen tra-
gen, und diese Tatsachen erleichterten den
„Fälschern“ ihr Handwerk. So konnte es
geschehen, daß man Erzeugnisse der fran-
zösischen Fabrik Nevers kopierte und in
Deutschland als Hanauer oder Frankfurter
Stücke auf den Markt brachte; zeigt Nevers
doch einen ähnlichen Scherben und den-
selben Grundton des Blau wie die französi-
sche Fabrik. Händler beschafften sich aus
Frankreich Fayencen, aber Kenner erkannten
sofort diese Aehnlichkeit.
Ein ganz ähnlicher Fall geschah mit
Straßburger Arbeiten. Mehrere Fabriken in
Elsaß-Lothringen arbeiteten Fayencen aus
Straßburg bereits im 18. Jahrhundert kunst-
voll nach, vor allem Niederweiler, dessen
Fabrikate Straßburg-Hagenau in Qualität,
Form und Bemalung sehr oft ebenbürtig
sind.
Mit dem Anwachsen der Spezialkenntnisse
in Sammlerkreisen konnte es geschehen, daß
besondere Sammlerwünsche durch Zuschrei-
bungen nicht befriedigt werden konnten. Es
konnte geschehen, daß nicht nur der Händ-
ler, sondern auch der Fabrikant verdiente!
Und daraus erklärt es sich, daß eigentliche
Stätten der Fabrikation jetzt entstanden.
Man kopierte Frankfurt, Straßburg, Hanau,
späterhin auch Nürnberg und eben Proskau,
das sich in unseren Tagen besonderer Be-
liebtheit erfreut.
Selbstverständlich ging man auch dazu
über, ganz bestimmte Formen der Fayence-
Kunst nachzuahmen. Sehr elegant wirken
stets die Enghalskrüge, sie wirken eigentlich
eleganter als die Walzenkrüge, aus denen
das Bier getrunken wird. Dann sind da die
Brüderschaftskrügchen, jene Verbindung von
drei bis vier Rundkrügchen in Birnenform,
die immer sehr dekorativ aussehen.
Ein Sondergebiet ist die nachträgliche
Dekoration von Weiß-Fayencen als Zimmer-
schmuck, die insbesondere wieder für das
bürgerliche Eßzimmer und die Halle von Be-
deutung sind.
Wer kunstvolle Ausbesserungen und Er-
gänzungen von Fayencen vornimmt, glaubt
stets im Interesse des Besitzers des betreffen-
den Stückes zu handeln. Immer wird Finger-
spitzengefühl und Vergleichen mit einwand-
frei echten Stücken den Sammler über den
wahren Wert der angebotenen Fayence auf-
klären. Wobei man hervorheben muß, daß
die sogenannten Gebrauchsspuren trügerisch
sind. B.
werklichen der Wachsbildnerei. Der Künst-
ler stammt aus dem südlichsten Teil des
deutschen Lebensraums, aus Wien. Das er-
klärt in seinem Schaffen jenen barock an-
mutenden Einschlag, der sich in monumen-
talen Büsten der Staatsmänner sicherer zur
strengen Geschlossenheit der Form verfestigt,
als in einigen Denkmalsentwürfen für die
neue Türkei. Auch FerdinandSpiegel
ist Süddeutscher, aus Würzburg gebürtig.
Seine figürlichen und landschaftlichen Dar-
stellungen aus dem Bereich der Tiroler Berg-
bauern setzen die künstlerischen Absichten
von Egger-Lienz, der wiederum von Hodler
bestimmt gewesen ist, mit zeichnerisch be-
tonteren Mitteln fort. Spiegel wirkt seit 1918
in Berlin und seine Treue gegenüber dem
Gegenständlichen läßt seinen Ruf als aka-
demischen Lehrer durchaus erklärlich er-
scheinen. Zu diesen beiden Kollektionen
treten dann noch die preisgekrönten Wett-
bewerb-Entwürfe für Schla-
geter-Forum und Haus der Hitler-
jugend am Rhein in Düsseldorf. Zk.
in Chemnitz
Menzels
Graphisches Werk
Die Sammlung Heu mann in der
Kunsthütte
Deutlich zu zeigen, wie stark Adolf Men-
zels graphisches Schaffen dem Buche inner-
lich und äußerlich verpflichtet war, ist das
besondere Verdienst der schönen Ausstel-
lung der Menzelsammlung Heumann in der
Kunsthütte zu Chemnitz. In den Vitrinen
sind die Bücher aufgeschlagen, denen die
Blätter entstammen, die in langen Reihen
an den Wänden zu sehen sind. Das Buch
hat ihr Format bestimmt, der Buchdruck
die Technik der Ausführung, die übergeord-
nete Einheit des Buchganzen mit dem Thema
auch künstlerische Grenzen gesteckt, inner-
halb dieser Grenzen aber die bildhafte
Phantasie des Strebens nach großer, strenger
l'orm entbunden und in den Einzelheiten der
gestaltenden Kraft damit erst die volle Frei-
heit gegeben.
Es ist ein höchst spannendes und nur in
einer so sinnvoll angeordneten Ausstellung
fürs Auge erlebbares Schauspiel, wie sich aus
der „Brotarbeit“ des jungen Menzel drei
Ströme zu dein ersten Hauptwerke, den Illu-
strationen zu Kuglers Geschichte Friedrichs
des Großen vereinigen.
In den zweckbestimmten Einzelblättern
umrankt und umfließt in höchst geistreichem
Bezug Einfall über Einfall die Schrift. In
den frühen Buchillustrationen, den Porträt-
beigaben im „Preußischen Hausfreund für
den denkenden Bürger und Landimann“
herrscht die saubere, fast trockene Zucht des
Handwerks. Aus den patriotischen Themen,
die die preußischen Verleger dem jungen
Künstler stellen, endlich erwächst die Vor-
liebe und die Eignung für die Darstellung
der Welt Friedrichs des Großen. Gegenüber
den zahlreich ausgestellten Probedrucken
aus dem Friedrichwerk weiß man nicht, was
man mehr bewundern soll — die handwerk-
liche Zucht, mit der die Durchführung im
künstlerischen Sinne von Menzel erzwungen
wurde, den Geist und Witz, den der Zeich-
ner aufwandte, um den Text auszudeuten
und zu begleiten, oder die Beherrschung der
Stoffwelt. Gleichzeitig aber gab Menzel je-
der einzelnen Vignette soviel geformte künst-
lerische Kraft mit, daß sie der Einzelbetrach-
tung standhält und zum Gegenstand beson-
derer Sammlungen werden konnte.
Menzel hat schon früh diese selbständig
wirkenden Kräfte seiner graphischen Kunst
erkannt und zu dem Mittel, das auch der
junge Dürer benutzte, zur Reihung erzäh-
lender graphischer Blätter gegriffen, die
dann in Buch oder Mappenform zusammen-
geschlossen, auf den Markt kamen. Die Fol-
gen „Künstlers Erdenwallen“, die späteren
Bildnisse der fridericianischen Generäle ha-
ben den thematischen, die „Versuche mit
Pinsel und Schabeisen“ und die Mappe der
„Radierungen“ den Zusammenhang in der
Technik.
Bis zu den Alterswerken, den Illustra-
tionen zum „Zerbrochenen Krug“ verzeichnet
der auch in der äußeren Form Menzel wür-
dige Katalog, den der Sammler selbst liebe-
voll betreute, die zahlreichen Seltenheiten,
die von Menzel korrigierten Probedrucke, die
verworfenen Platten. Es hat etwas ergrei-
fendes, die drei Holzstöcke, auf die Menzel
einst selbst gezeichnet hat, die die Holz-
schneider getreu geschnitten haben, die den
Druck der ersten großen Auflage aushielten
und die nun im Katalog noch einmal feine
originale Abdrucke geliefert haben, klein,
bescheiden und von der Druckerschwärze
ebenholzglatt gefärbt in der Vitrine liegen
zu sehen. Erhard Göpel
in ^Düsseldorf
25 deutsche Maler
Die Düsseldorfer Galerie Alex
V ö m e 1 zeigt augenblicklich „25 deutsche
Maler der Gegenwart“, eine Auswahl von Ge-
mälden, in denen mehr die Entwicklung der
jüngsten Vergangenheit, der Vor- und Nach-
kriegszeit zum Ausdruck kommt, als das ge-
genwartsbewußt aufstrebende Schaffen un-
DIE WELTKUNST
Jahrg. IX, Nr. II vom 17. März 1595
Gebäudeanlagen mindestens die doppelte
Größe der ganzen Stadt des Vatikans, St. Peter
einbegriffen. Sveton hat diesem Größenwahn
banlicher Art einen satirischen Ausdruck ge-
geben.
Heute hat man nach den neuesten Frei-
legungen dieses größten alteuropäischen
Palastes, der niemals wirklich bewohnt wor-
den ist, einen ersten klaren Begriff. Er be-
stand. entworfen und erbaut von den beiden
Architekten Celere und Severus, aus einem
Tizian, Toilette der Venus
Ehern. Leningrad, Eremitage
Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington
mächtigen Rechteck, dessen Fassade genau
nach Süden lag. Vor ihr lief ein tausend Fuß
langer Portikus. Bekannt sind die Beschrei-
bungen des Palastes durch Sveton, die der
Stuckaturen und der Innenräume durch Pli-
nius. Von der Domus Aurea in ihrem ganzen
Umfange kann nur durch Ausgrabungen
jener kleine Teil vielleicht wiedererstehen,
den Vespasian sich reservierte, während er
den größten Teil der kaiserlichen Anlage
zerstören ließ.
Die Räume zeigen einen ungeheuren
Reichtum architektonischer Phantasie. Es
sind alle Formen von Zimmern, Sälen, Korri-
doren vorhanden, viereckige Zimmer mit Ab-
siden, runde Zimmer, dreieckige Säle, die sich
in pittoresker Weise miteinander verbinden.
Von dem großen Innenhof sind nur drei Säu-
lenfundamente erhalten geblieben. Diesen
Hof hat Trajan zerstört, der die Pflasterung
und die Säulen beseitigen ließ und die Grund-
mauern seiner Thermen hier aufrichtete. Von
dem goldenen Haus sind in allen Räumen die
Marmortäfelungen, die Stucks, die edlen
Steine und das Elfenbein verschwunden. Aber
Abonnieren Sie die
„ Weltkunst“
die nackten Wände, die leeren Nischen, die
statuenlosen Sockel entschleiern eine der-
artige architektonische Großartigkeit, wie
man sie nur aus den Uebertreibungen des
Piranesi her kannte. Die gleiche architek-
tonische Kühnheit beweist die Südfront, so-
weit sie noch erkennbar ist. Die Baumassen
sind voller Leben. Dort findet sich nahe dem
trapezförmigen Hof ein achteckiger großer
Saal, um den sternförmig herum sich Zimmer
legen. Ueber dem achteckigen Saal wölbt sich
eine Kuppel, die vollkommen rund gehalten
ist. Diese Kuppel hat den gleichen kreis-
runden Lichtdurchbruch, der aus dem Pan-
theon her bekannt ist. In der heutigen Nackt-
heit ist die Lichtschattenwirkung dieser „rein
gewordenen“ Architektur vielleicht größer
als im Augenblick der Fertigstellung.
G. R.
AUSSTEL
in SJerlin
Junge Bildhauer
Die Ausstellungstätigkeit der Buchhand-
lung Karl Buchholz fiel schon mehr-
mals durch einige sehr sorgfältig vorberei-
tete Veranstaltungen auf. die zumeist dem
Schaffen deutscher Bildhauer gewidmet
waren. Sie zeigt auch diesmal wieder pla-
stische Arbeiten und stellt damit erneut
unter Beweis, um wieviel glücklicher im
Gegensatz zu den malerisch Schaffenden der
Zeit in der jungen Bildhauergeneration ein
neues Formgefühl sich Bahn bricht. Die
Auswahl, unter reichlicher Beigabe von
Zeichnerischem, ist hier eine wirkliche Aus-
lese, sehr lebendig und qualitätvoll. Die
einzelnen künstlerischen Wege, die sie auf-
weist, schließen den guten Zusammenklang
der Schau nicht aus. Das ist schon sehr
viel, zumal von den Kräften, die sichtbar
gemacht werden, wohl einige, wie der Düs-
seldorfer Kurt Zimmermann (Abb. S. 4)
und der Mannheimer Gustav Seitz, ge-
legentlich in Berlin zu Worte gekommen
sind, andere dagegen aber, wie der Krefel-
der Günter von Scheven, der Bam-
berger Michael Schob ar th, der Hei-
delberger Adolf Abel, der Aachener
Paul Egon Schiffers, der Essener
Hermann Blumenthal, der Barmer
Ivo Beucker, der Erlanger Heinrich
Kirchner, der Koblenzer Kurt Leh-
mann, der Liegnitzer Werner Prim
und der Solinger Curt Beckmann, in
der Reichshauptstadt nahezu unbekannt
sind. Erwähnt zu werden verdient, daß sie
sämtlich aus dem Jahrzehnt nach 1900 stam-
men. Die Jugend, nach der anläßlich offi-
zieller Ausstellungen soviel gerufen wird,
hier ist sie! • Zk.
Lyonei Feininger
Die Galerie Ferdinand Möller stellt
in einem manchmal viel zu reichen Neben-
einander — in dem es den einzelnen, oft
mit unendlicher Zartheit gestalteten Blättern
zuweilen schwer fällt, ihre besondere Gel-
tung zu behaupten — hundert Aquarelle,
Kohle- und Federzeichnungen, sowie eine
kleine Reihe von Naturskizzen Lyonei Fei-
ningers aus. Wieder sieht man diese licht-
bewegten Meeresbreiten, die aus weiten
Wasserräumen aufleuchtenden stillen Insel-
welten, wikingerhaft anmutende Wolken-
fahrten und Segelziige, gotische Turm-
spitzen, die aus den Dämmerungen von
Straßenfluchten und Häusergiebeln ins
Sonnenlicht streben, die geisterhafte, den
Seewellen verfallene Kirchenruine von Hoff
und sonst alles das, was zum künstlerischen
Requisit dieser romantisch gerichteten Natur
gehört. Feininger geht sparsam, aber nicht
karg mit seinen Ausdrucksmitteln um, die
sich folgerichtig zu einer eigenen, ganz reif
gewordenen Form verdichtet haben. Im Ge-
gensätzlichen von Hell und Dunkel, dem far-
bigen Aufstrahlen eines Blau, Rot oder Gelb
schlägt er Töne an, die voll und rein ver-
klingen und Empfindungen geben, deren Un-
mittelbarkeit durch das Gebändigte, Verhal-
tene in seinen Schöpfungen nur zu leicht
übersehen wird. Strenge Zucht im Linearen
und Flächigen ließ das eigentlich Bildmäßige
niemals außer acht und auch der romanti-
sche Zug darin, keineswegs rückwärts ge-
wandte Sehnsucht, entstammt einer unge-
wöhnlichen Helligkeit des künstlerischen Be-
wußtseins und spricht sich mit einer Unauf-
dringlichkeit aus, die nicht als kleinster
Ruhmestitel dieser Blätter erscheint.
Berthold Müller-Oerling-
h aus en rundet mit einer Serie von Pla-
stiken, meist in Bronze, die schöne Ausstel-
lung ab. Besonders einige gut durchgefühlte
LUNGEN
Bildnisköpfe zeigen ein vorzügliches Hand-
werk und ungewöhnliches Formempfinden,
während in einer Gruppe ein Barlach-Zug
noch nicht ganz überwunden ist. Z e e c k
Joseph Thorak und
Ferdinand Spiegel
Zeigte die erste Ausstellung der N.S.-
Kultur gemein de in Berlin das Be-
streben, künstlerisches Arbeiten in unserer
Zeit unter einer ganz bestimmten Perspektive
zu sehen, geht diese zweite (Tiergartenstraße
21a) von einem anderen Grundgedanken aus.
Indem sie sich auf zwei, bereits bewährte
Namen beschränkt, sie aber mit möglichst
zahlreichen Beispielen herausstellt, soll dem
Jan van Eyck, Verkündigung
Ehern. Leningrad, Eremitage
Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington
Betrachter eindringlichste Veranschaulichung
künstlerischen Schaffensvorganges ermög-
licht werden. Die vielseitige, naturnahe Art
des Bildhauers entspricht dieser Absicht am
besten. Thoraks Figuren mit ihrem
lebensatmenden, sich mehr skulptural als
eigentlich plastisch aussprechenden Zug, er-
weisen deutlich seine Herkunft vom Hand-
Kann man
Fayen een fälschen ?
Als Paul Heiland im Jahre 1925 sein be-
kanntes Buch „Die deutsche Fayence-Kultur“
schrieb, ahnte er nicht, wie aktuell ein Fall
in seinen Ausführungen über Fälschertum
auf dem Gebiet der Fayence-Wissenschaft
werden würde. Es handelt sich um die Pros-
kauer Manufaktur, um ihre besten Leistun-
gen. die heute in Deutschland mit Vorliebe
kopiert und als Erzeugnisse, als „Art de
Pologne“ im inzwischen polnisch gewordenen
Oberschlesien Sammelobjekte von großem
Wert darstellen.
Man hat sich daran gewöhnt, unter Fäl-
schung nicht nur eine falsche Zuschreibung,
sondern auch eine dekorative Fälschung
zu verstehen. Solche dekorativen Fälschun-
gen nehmen sich für Gesimse und Hallen,
für das bürgerliche Eßzimmer sehr wirkungs-
voll aus, und es ist eine unbestrittene Tat-
sache, daß Fayencen dafür sich besonders
eignen. Delft, Italien, Faenzia, Urbino und
Siena sind für Halbgebildete Klänge, die ihr
Ohr gern vernimmt, denn diese Ohren ver-
binden damit die Erinnerung an Pomp und
Prunk und sehen ihr Eßzimmer in doppeltem
künstlerischem Licht.
Es liegt auf der Hand, daß Fayence-Fäl-
schungen in Form von falschen Zuschreibun-
gen erst in einer Zeit aufkamen, da das In-
teresse für diesen Zweig des Kunstgewerbes
entdeckt wurde. Hinzu kam, daß die selte-
nen Manufakturen keinerlei Signaturen tra-
gen, und diese Tatsachen erleichterten den
„Fälschern“ ihr Handwerk. So konnte es
geschehen, daß man Erzeugnisse der fran-
zösischen Fabrik Nevers kopierte und in
Deutschland als Hanauer oder Frankfurter
Stücke auf den Markt brachte; zeigt Nevers
doch einen ähnlichen Scherben und den-
selben Grundton des Blau wie die französi-
sche Fabrik. Händler beschafften sich aus
Frankreich Fayencen, aber Kenner erkannten
sofort diese Aehnlichkeit.
Ein ganz ähnlicher Fall geschah mit
Straßburger Arbeiten. Mehrere Fabriken in
Elsaß-Lothringen arbeiteten Fayencen aus
Straßburg bereits im 18. Jahrhundert kunst-
voll nach, vor allem Niederweiler, dessen
Fabrikate Straßburg-Hagenau in Qualität,
Form und Bemalung sehr oft ebenbürtig
sind.
Mit dem Anwachsen der Spezialkenntnisse
in Sammlerkreisen konnte es geschehen, daß
besondere Sammlerwünsche durch Zuschrei-
bungen nicht befriedigt werden konnten. Es
konnte geschehen, daß nicht nur der Händ-
ler, sondern auch der Fabrikant verdiente!
Und daraus erklärt es sich, daß eigentliche
Stätten der Fabrikation jetzt entstanden.
Man kopierte Frankfurt, Straßburg, Hanau,
späterhin auch Nürnberg und eben Proskau,
das sich in unseren Tagen besonderer Be-
liebtheit erfreut.
Selbstverständlich ging man auch dazu
über, ganz bestimmte Formen der Fayence-
Kunst nachzuahmen. Sehr elegant wirken
stets die Enghalskrüge, sie wirken eigentlich
eleganter als die Walzenkrüge, aus denen
das Bier getrunken wird. Dann sind da die
Brüderschaftskrügchen, jene Verbindung von
drei bis vier Rundkrügchen in Birnenform,
die immer sehr dekorativ aussehen.
Ein Sondergebiet ist die nachträgliche
Dekoration von Weiß-Fayencen als Zimmer-
schmuck, die insbesondere wieder für das
bürgerliche Eßzimmer und die Halle von Be-
deutung sind.
Wer kunstvolle Ausbesserungen und Er-
gänzungen von Fayencen vornimmt, glaubt
stets im Interesse des Besitzers des betreffen-
den Stückes zu handeln. Immer wird Finger-
spitzengefühl und Vergleichen mit einwand-
frei echten Stücken den Sammler über den
wahren Wert der angebotenen Fayence auf-
klären. Wobei man hervorheben muß, daß
die sogenannten Gebrauchsspuren trügerisch
sind. B.
werklichen der Wachsbildnerei. Der Künst-
ler stammt aus dem südlichsten Teil des
deutschen Lebensraums, aus Wien. Das er-
klärt in seinem Schaffen jenen barock an-
mutenden Einschlag, der sich in monumen-
talen Büsten der Staatsmänner sicherer zur
strengen Geschlossenheit der Form verfestigt,
als in einigen Denkmalsentwürfen für die
neue Türkei. Auch FerdinandSpiegel
ist Süddeutscher, aus Würzburg gebürtig.
Seine figürlichen und landschaftlichen Dar-
stellungen aus dem Bereich der Tiroler Berg-
bauern setzen die künstlerischen Absichten
von Egger-Lienz, der wiederum von Hodler
bestimmt gewesen ist, mit zeichnerisch be-
tonteren Mitteln fort. Spiegel wirkt seit 1918
in Berlin und seine Treue gegenüber dem
Gegenständlichen läßt seinen Ruf als aka-
demischen Lehrer durchaus erklärlich er-
scheinen. Zu diesen beiden Kollektionen
treten dann noch die preisgekrönten Wett-
bewerb-Entwürfe für Schla-
geter-Forum und Haus der Hitler-
jugend am Rhein in Düsseldorf. Zk.
in Chemnitz
Menzels
Graphisches Werk
Die Sammlung Heu mann in der
Kunsthütte
Deutlich zu zeigen, wie stark Adolf Men-
zels graphisches Schaffen dem Buche inner-
lich und äußerlich verpflichtet war, ist das
besondere Verdienst der schönen Ausstel-
lung der Menzelsammlung Heumann in der
Kunsthütte zu Chemnitz. In den Vitrinen
sind die Bücher aufgeschlagen, denen die
Blätter entstammen, die in langen Reihen
an den Wänden zu sehen sind. Das Buch
hat ihr Format bestimmt, der Buchdruck
die Technik der Ausführung, die übergeord-
nete Einheit des Buchganzen mit dem Thema
auch künstlerische Grenzen gesteckt, inner-
halb dieser Grenzen aber die bildhafte
Phantasie des Strebens nach großer, strenger
l'orm entbunden und in den Einzelheiten der
gestaltenden Kraft damit erst die volle Frei-
heit gegeben.
Es ist ein höchst spannendes und nur in
einer so sinnvoll angeordneten Ausstellung
fürs Auge erlebbares Schauspiel, wie sich aus
der „Brotarbeit“ des jungen Menzel drei
Ströme zu dein ersten Hauptwerke, den Illu-
strationen zu Kuglers Geschichte Friedrichs
des Großen vereinigen.
In den zweckbestimmten Einzelblättern
umrankt und umfließt in höchst geistreichem
Bezug Einfall über Einfall die Schrift. In
den frühen Buchillustrationen, den Porträt-
beigaben im „Preußischen Hausfreund für
den denkenden Bürger und Landimann“
herrscht die saubere, fast trockene Zucht des
Handwerks. Aus den patriotischen Themen,
die die preußischen Verleger dem jungen
Künstler stellen, endlich erwächst die Vor-
liebe und die Eignung für die Darstellung
der Welt Friedrichs des Großen. Gegenüber
den zahlreich ausgestellten Probedrucken
aus dem Friedrichwerk weiß man nicht, was
man mehr bewundern soll — die handwerk-
liche Zucht, mit der die Durchführung im
künstlerischen Sinne von Menzel erzwungen
wurde, den Geist und Witz, den der Zeich-
ner aufwandte, um den Text auszudeuten
und zu begleiten, oder die Beherrschung der
Stoffwelt. Gleichzeitig aber gab Menzel je-
der einzelnen Vignette soviel geformte künst-
lerische Kraft mit, daß sie der Einzelbetrach-
tung standhält und zum Gegenstand beson-
derer Sammlungen werden konnte.
Menzel hat schon früh diese selbständig
wirkenden Kräfte seiner graphischen Kunst
erkannt und zu dem Mittel, das auch der
junge Dürer benutzte, zur Reihung erzäh-
lender graphischer Blätter gegriffen, die
dann in Buch oder Mappenform zusammen-
geschlossen, auf den Markt kamen. Die Fol-
gen „Künstlers Erdenwallen“, die späteren
Bildnisse der fridericianischen Generäle ha-
ben den thematischen, die „Versuche mit
Pinsel und Schabeisen“ und die Mappe der
„Radierungen“ den Zusammenhang in der
Technik.
Bis zu den Alterswerken, den Illustra-
tionen zum „Zerbrochenen Krug“ verzeichnet
der auch in der äußeren Form Menzel wür-
dige Katalog, den der Sammler selbst liebe-
voll betreute, die zahlreichen Seltenheiten,
die von Menzel korrigierten Probedrucke, die
verworfenen Platten. Es hat etwas ergrei-
fendes, die drei Holzstöcke, auf die Menzel
einst selbst gezeichnet hat, die die Holz-
schneider getreu geschnitten haben, die den
Druck der ersten großen Auflage aushielten
und die nun im Katalog noch einmal feine
originale Abdrucke geliefert haben, klein,
bescheiden und von der Druckerschwärze
ebenholzglatt gefärbt in der Vitrine liegen
zu sehen. Erhard Göpel
in ^Düsseldorf
25 deutsche Maler
Die Düsseldorfer Galerie Alex
V ö m e 1 zeigt augenblicklich „25 deutsche
Maler der Gegenwart“, eine Auswahl von Ge-
mälden, in denen mehr die Entwicklung der
jüngsten Vergangenheit, der Vor- und Nach-
kriegszeit zum Ausdruck kommt, als das ge-
genwartsbewußt aufstrebende Schaffen un-