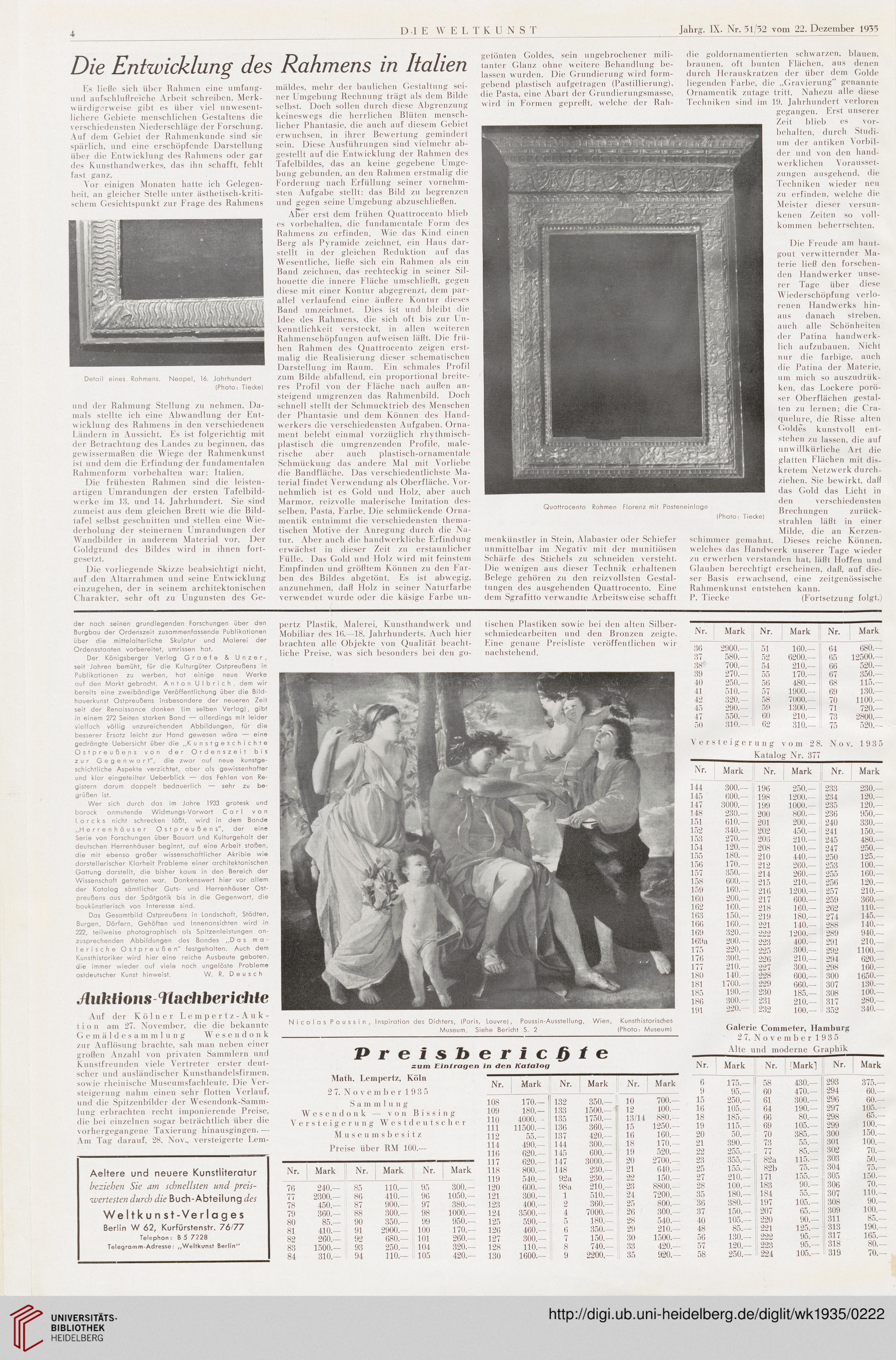4
DIE WELT KUNST
Jahrg. IX. Nr. 51/52 vom 22. Dezember 1935
Die Entwicklung des Rahmens in Italien
Es ließe sich über Rahmen eine umfang-
und aufschlußreiche Arbeit schreiben. Merk-
würdigerweise gibt es über viel unwesent-
lichere Gebiete menschlichen Gestaltens die
verschiedensten Niederschläge der Forschung.
Auf dem Gebiet der Rahmenkunde sind sie
spärlich, und eine erschöpfende Darstellung
über die Entwicklung des Rahmens oder gar
des Kunsthandwerkes, das ihn schafft, fehlt
fast ganz.
Vor einigen Monaten hatte ich Gelegen-
heit, an gleicher Stelle unter ästhetisch-kriti-
schem Gesichtspunkt zur Frage des Rahmens
Detail eines Rahmens. Neapel, 16. Jahrhundert
(Photo: Tiecke)
und der Rahmung Stellung zu nehmen. Da-
mals stellte ich eine Abwandlung der Ent-
wicklung des Rahmens in den verschiedenen
Ländern in Aussicht. Es ist folgerichtig mit
der Betrachtung des Landes zu beginnen, das
gewissermaßen die Wiege der Rahmenkunst
ist und dem die Erfindung der fundamentalen
Rahmenform Vorbehalten war: Italien.
Die frühesten Rahmen sind die leisten-
artigen Umrandungen der ersten Tafelbild-
werke im 13. und 14. Jahrhundert. Sie sind
zumeist aus dem gleichen Brett wie die Bild-
tafel selbst geschnitten und stellen eine Wie-
derholung der steinernen Umrandungen der
Wandbilder in anderem Material vor. Der
Goldgrund des Bildes wird in ihnen fort-
gesetzt.
Die vorliegende Skizze beabsichtigt nicht,
auf den Altarrahmen und seine Entwicklung
einzugehen, der in seinem architektonischen
Charakter, sehr oft zu Ungunsten des Ge-
mäldes, mehr der baulichen Gestaltung sei-
ner Umgebung Rechnung trägt als dem Bilde
selbst. Doch sollen durch diese Abgrenzung
keineswegs die herrlichen Blüten mensch-
licher Phantasie, die auch auf diesem Gebiet
erwuchsen, in ihrer Bewertung gemindert
sein. Diese Ausführungen sind vielmehr ab-
gestellt auf die Entwicklung der Rahmen des
Tafelbildes, das an keine gegebene Umge-
bung gebunden, an den Rahmen erstmalig die
Forderung nach Erfüllung seiner vornehm-
sten Aufgabe stellt: das Bild zu begrenzen
und gegen seine Umgebung abzuschließen.
Aber erst dem frühen Quattrocento blieb
es vorbehalten, die fundamentale Form des
Rahmens zu erfinden. Wiie das Kind einen
Berg als Pyramide zeichnet, ein Haus dar-
stellt in der gleichen Reduktion auf das
Wesentliche, ließe sich ein Rahmen als ein
Band zeichnen, das rechteckig in seiner Sil-
houette die innere Fläche umschließt, gegen
diese mit einer Kontur abgegrenzt, dem par-
allel verlaufend eine äußere Kontur dieses
Band umzeichnet. Dies ist und bleibt die
Idee des Rahmens, die sich oft bis zur Un-
kenntlichkeit versteckt, in allen weiteren
Rahmenschöpfungen aufweisen läßt. Die frü-
hen Rahmen des Quattrocento zeigen erst-
malig die Realisierung dieser schematischen
Darstellung im Raum. Ein schmales Profil
zum Bilde abfallend, ein proportional breite-
res Profil von der Fläche nach außen an-
steigend umgrenzen das Rahmenbild. Doch
schnell stellt der Schmucktrieb des Menschen
der Phantasie und dem Können des Hand-
werkers die verschiedensten Aufgaben. Orna-
ment belebt einmal vorzüglich rhythmisch-
plastisch die umgrenzenden Profile, male-
rische aber auch plastisch-ornamentale
Schmückung das andere Mal mit Vorliebe
die Bandfläche. Das verschiedentlichste Ma-
terial findet Verwendung als Oberfläche. Vor-
nehmlich ist es Gold und Holz, aber auch
Marmor, reizvolle malerische Imitation des-
selben, Pastä, Farbe. Die schmückende Orna-
mentik entnimmt die verschiedensten thema-
tischen Motive der Anregung durch die Na-
tur. Aber auch die handwerkliche Erfindung
erwächst in dieser Zeit zu erstaunlicher
Fülle. Das Gold und Holz wird mit feinstem
Empfinden und größtem Können zu den Far-
ben des Bildes abgetönt. Es ist abwegig,
anzunehmen, daß Holz in seiner Naturfarbe
verwendet wurde oder die käsige Farbe un-
getönten Goldes, sein ungebrochener mili-
tanter Glanz ohne weitere Behandlung be-
lassen wurden. Die Grundierung wird form-
gebend plastisch auf getragen (Pastiliierung),
die Pasta, eine Abart der Grundierungsmasse,
wird, in Formen gepreßt, welche der Rah¬
menkünstler in Stein, Alabaster oder Schiefer
unmittelbar im Negativ mit der munitiösen
Schärfe des Stichels zu schneiden versteht.
Die wenigen aus dieser Technik erhaltenen
Belege gehören zu den reizvollsten Gestal-
tungen des ausgehenden Quattrocento. Eine
dem Sgrafitto verwandte Arbeitsweise schafft
die goldornamentierten schwarzen, blauen,
braunen, oft bunten Flächen, aus denen
durch Herauskratzen der über dem Gokle
liegenden Farbe, die „Gravierung“ genannte
Ornamentik zutage tritt. Nahezu alle diese
Techniken sind im 19. Jahrhundert verloren
gegangen. Erst unserer
Zeit blieb es Vor-
behalten, durch Studi-
um der antiken Vorbil-
der und von den hand-
werklichen Vorausset-
zungen ausgehend, die
Techniken wieder neu
zu erfinden, welche die
Meister dieser versun-
kenen Zeiten so voll-
kommen beherrschten.
Die Freude am haut-
verwitternder Ma-
terie ließ den forschen-
den Handwerker unse-
rer Tage über diese
Wiederschöpfung verlo-
renen Handwerks hin-
aus danach streben,
auch alle Schönheiten
der Patina handwerk-
lich aufzubauen. Nicht
nur die farbige, auch
die Patina der Materie,
um mich so auszudrük-
ken, das Lockere porö-
ser Oberflächen gestal-
ten zu lernen; die Cra-
quelure, die Risse alten
Goldes kunstvoll ent-
stehen zu lassen, die auf
unwillkürliche Art die
glatten Flächen mit dis-
kretem Netzwerk durch-
ziehen. Sie bewirkt, daß
das Gold das Licht in
den verschiedensten
Brechungen zurück-
strahlen läßt in einer
Milde, die an Kerzen-
schimmer gemahnt. Dieses reiche Können,
welches das Handwerk unserer Tage wieder
zu erwerben verstanden hat, läßt Hoffen und
Glauben berechtigt erscheinen, daß, auf die-
ser Basis erwachsend, eine zeitgenössische
Rahmenkunst entstehen kann.
P. Tiecke (Fortsetzung folgt.)
Quattrocento Rahmen Florenz mit Pasteneinlage
(Photo: Tiecke)
der nach seinen grundlegenden Forschungen über den
Burgbau der Ordenszeit zusammenfassende Publikationen
über die mittelalterliche Skulptur und Malerei der
Ordensstaaten vorbereitet, umrissen hat.
Der Königsberger Verlag Graefe & Unzer,
seit Jahren bemüht, für die Kulturgüter Ostpreußens in
Publikationen zu werben, hat einige neue Werke
auf den Markt gebracht. Anton Ulbrich, dem wir
bereits eine zweibändige Veröffentlichung über die Bild-
hauerkunst Ostpreußens insbesondere der neueren Zeit
seit der Renaissance danken (im selben Verlag), gibt
in einem 272 Seiten starken Band — allerdings mit leider
vielfach völlig unzureichenden Abbildungen, für die
besserer Ersatz leicht zur Hand gewesen wäre — eine
gedrängte Uebersicht über die „Kunstgeschichte
Ostpreußens von der Ordenszeit bis
zur Gegenwart", die zwar auf neue kunstge-
schichtliche Aspekte verzichtet, aber als gewissenhafter
und klar eingeteilter Ueberblick — das Fehlen von Re-
gistern darum doppelt bedauerlich — sehr zu be-
grüßen ist.
Wer sich durch das im Jahre 1933 grotesk und
barock anmutende Widmungs-Vorwort Carl v o n
Lorcks nicht schrecken läßt, wird in dem Bande
„Herrenhäuser Ostpreußen s", der eine
Serie von Forschungen über Bauart und Kulturgehalt der
deutschen Herrenhäuser beginnt, auf eine Arbeit stoßen,
die mit ebenso großer wissenschaftlicher Akribie wie
darstellerischer Klarheit Probleme einer architektonischen
Gattung darstellt, die bisher kaum in den Bereich der
Wissenschaft getreten war. Dankenswert hier vor allem
der Katalog sämtlicher Guts- und Herrenhäuser Ost-
preußens aus der Spätgotik bis in die Gegenwart, die
baukünstlerisch von Interesse sind.
Das Gesamtbild Ostpreußens in Landschaft, Städten,
Burgen, Dörfern, Gehöften und Innenansichten wird in
222, teilweise photographisch als Spitzenleistungen an-
zusprechenden Abbildungen des Bandes ,,D a s ma-
lerische Ostpreußen" festgehalten. Auch dem
Kunsthistoriker wird hier eine reiche Ausbeute geboten,
die immer wieder auf viele noch ungelöste Probleme
ostdeutscher Kunst hinweist. W. R. D e u s c h
Jhiktions ‘ftachberichte
Auf der Kölner Lempertz-Auk-
t i o n am 27. November, die die bekannte
Gemäldesammlung Wesendonk
zur Auflösung brachte, sah man neben einer
großen Anzahl von privaten Sammlern und
Kunstfreunden viele Vertreter erster deut-
scher und ausländischer Kunsthandelsfirmen,
sowie rheinische Museumsfachleute. Die Ver-
steigerung nahm einen sehr flotten Verlauf,
und die Spitzenbilder der Wesendonk-Samm-
lung erbrachten recht imponierende Preise,
die bei einzelnen sogar beträchtlich über die
vorhergegangene Taxierung hinausgingen. —
Am Tag darauf, 28. Nov., versteigerte Lem-
Aeltere und neuere Kunstliteratur
beziehen Sie am schnellsten und preis-
wertesten durch die Buch- Abteilung des
Weltkunst-Verlages
Berlin W 62, Kurfürstenstr. 76 77
Telephon: B 5 7228
Telegramm-Adresse: „Weltkirnst Berlin"
pertz Plastik, Malerei, Kunsthandwerk und
Mobiliar des, 16.—18. Jahrhunderts. Auch hier
brachten alle Objekte von Qualität beacht-
liche Preise, was sich besonders bei den go¬
tischen Plastiken sowie bei den alten Silber-
schmiedearbeiten und den Bronzen zeigte
Eine genaue Preisliste veröffentlichen wii
nachstehend.
Nicolas Poussin, Inspiration des Dichters, (Paris, Louvre), Poussin-Ausstellung, Wien, Kunsthistorisches
Museum. Siehe Bericht S. 2 (Photo: Museum)
P r eis b e r i c f)
zum Einträgen in den Katalog
Math. Lemnertz. Köln
1 Mark
Nr.
Mark
Nr. :
Mark
2 7.
November 193 5
Nr.
S a m n
1 u n g
108
170.—
132
350.—
10
700.—
Wesend
onk -
von Biss:
n g
109
180.—
133
1500.-
12
100.--
V
ersteigt
r u n g
Westdeuts
eher
110
4000. -
135
1750.-
13/14
880.--
111
11500.—
136
360.—
15
1250.—
M
u s e u m
s b e s i t z
112
55.—
137
420.—
16
160.
PrpisR iihor
RM 100.—
114
490.-
144
300.—
18
170.—
116
620.—
145
600.—
19
520.—
117
bzü.- —
14/
Nr.
Mark
Nr.
Mark Nr.
Mark
118
800.
148
230.—
21
640.-
1
119
540 -
92a
230 --
22
150 -
76
240.—
85
HO.— 95
300.—
120
600—
98a
210.-
28
8800.--
77
2300.—
86
410.— 96
1050.—
121
300.--
1
510.-
24
7200.—
78
450.—
87
900.— 97
380.-
123
400.—
2
360.-
25
800.—
79
360.—
88
300.— 98
1000.—
124
3500.—
4
7000. - ■
26
300.-
80
85.—
90
350.— 99
950.—
125
590.—
5
180.—
28
540.—
81
410.-
91
2900.— 100
170.—
126
460.—
6
350.—
29
210.—
82
260.—
92
680.— 101
260.—
127
300.--
7
150.-
30
1500—
83
1500.—
93
250.— 104
320.—
128
HO.—
8
740.—
33
420.- -
84
310.-
94
110.- II 105
420.—
130
1600.—
9
2200,—
I 35
920.—
Katalog Nr. 377
Nr.
Mark
Nr.
Mark
Nr.
Mark
36
2900.—
51
160—
64
680—
37
580.—
52
6200—
65
12500—
38'
700.—
54
210—
66
520—
39
270.—
55
170.—
67
350.—
40
250—
56
480—
68
115—
41
510.--
57
1900—
69
130—
42
320.—
58
7000—
70
1100—
45
290.—
59
1300—
71
720—
47
550.— .
60
210—
73
2800—
50
310. -
62
310—
75
520—
V e r
steiger
u n g
vom 28
Nov
. 1935
Nr.
Mark
Nr.
Mark
1
Nr.
Mark
1
144
300—
196
250—
233
230—
145
600—
198
1200.-
234
120—
147
3000,
199
1000—
235
120—
148
230—
200
800—
236
950—
151
610.—
201
200—
240
330—
152
340.—
202
450—
241
150—
153
270.—
206
210—
245
480—
154
120.—
208
100—
247
250—
155
180.—
210
440—
250
125.—
156
170.—
212
260—
253
100—
157
350.-
214
260—
255
160—
158
600.—
215
210.-
256
120—
159
160—
216
1200—
257
210—
160
200,--
217
600—
259
360.—
162
160.
218
160—
262
HO,
163
150.—
219
180—
274
145—
166
160—
221
140—
288
140—
169
320—
222
1200—
289
940—
169a
200.
223
400—
291
210—
175
220.—
225
300—
292
1100—
176
300—
226
210—
294
620—
177
210, -
227
300—
298
160—
180
140—
228
600—
300
1650—
181
1700. -
229
660—
307
130—
185
190—
230
185—
308
100—
186
300—
231
210—
317
280—
191
220—
232
100—
352
340—
Galerie Commeter, Hamburg
2 7. November 1935
Alte und moderne Graphik
Nr.
Mark
Nr.
i (Mark']
Nr.
Mark
6
175—
58
430—
293
375.—
9
95—
60
470—
294
60—
15
250—
61
300—
296
60—
16
105.—
64
190—
297
105.—
18
185—
66
80—
298
65.—
19
115—
69
105—
299
100—
20
50.-
70
385.—
300
150—
21
390.--
73
55.—
301
100, -
22
255.--
77
85—
302
70.—
23
355—
82a
115—
303
50—
25
155.—
82b
75.—
304
75.—
27
210.—
171
155.—
305
150.—
28
100.—
183
90—
306
70—
35
180—
184
55.—
307
HO—
36
380.-
197
105—
308
90—
37
150—
207
65.—
309
100.—
40
105—
220
90—
311
85—
48
85—
221
125—
313
190. -
56
130.-
222
95—
317
165—
57
120—
223
95—
318
80—
58
250—
224
105—
319
70—
DIE WELT KUNST
Jahrg. IX. Nr. 51/52 vom 22. Dezember 1935
Die Entwicklung des Rahmens in Italien
Es ließe sich über Rahmen eine umfang-
und aufschlußreiche Arbeit schreiben. Merk-
würdigerweise gibt es über viel unwesent-
lichere Gebiete menschlichen Gestaltens die
verschiedensten Niederschläge der Forschung.
Auf dem Gebiet der Rahmenkunde sind sie
spärlich, und eine erschöpfende Darstellung
über die Entwicklung des Rahmens oder gar
des Kunsthandwerkes, das ihn schafft, fehlt
fast ganz.
Vor einigen Monaten hatte ich Gelegen-
heit, an gleicher Stelle unter ästhetisch-kriti-
schem Gesichtspunkt zur Frage des Rahmens
Detail eines Rahmens. Neapel, 16. Jahrhundert
(Photo: Tiecke)
und der Rahmung Stellung zu nehmen. Da-
mals stellte ich eine Abwandlung der Ent-
wicklung des Rahmens in den verschiedenen
Ländern in Aussicht. Es ist folgerichtig mit
der Betrachtung des Landes zu beginnen, das
gewissermaßen die Wiege der Rahmenkunst
ist und dem die Erfindung der fundamentalen
Rahmenform Vorbehalten war: Italien.
Die frühesten Rahmen sind die leisten-
artigen Umrandungen der ersten Tafelbild-
werke im 13. und 14. Jahrhundert. Sie sind
zumeist aus dem gleichen Brett wie die Bild-
tafel selbst geschnitten und stellen eine Wie-
derholung der steinernen Umrandungen der
Wandbilder in anderem Material vor. Der
Goldgrund des Bildes wird in ihnen fort-
gesetzt.
Die vorliegende Skizze beabsichtigt nicht,
auf den Altarrahmen und seine Entwicklung
einzugehen, der in seinem architektonischen
Charakter, sehr oft zu Ungunsten des Ge-
mäldes, mehr der baulichen Gestaltung sei-
ner Umgebung Rechnung trägt als dem Bilde
selbst. Doch sollen durch diese Abgrenzung
keineswegs die herrlichen Blüten mensch-
licher Phantasie, die auch auf diesem Gebiet
erwuchsen, in ihrer Bewertung gemindert
sein. Diese Ausführungen sind vielmehr ab-
gestellt auf die Entwicklung der Rahmen des
Tafelbildes, das an keine gegebene Umge-
bung gebunden, an den Rahmen erstmalig die
Forderung nach Erfüllung seiner vornehm-
sten Aufgabe stellt: das Bild zu begrenzen
und gegen seine Umgebung abzuschließen.
Aber erst dem frühen Quattrocento blieb
es vorbehalten, die fundamentale Form des
Rahmens zu erfinden. Wiie das Kind einen
Berg als Pyramide zeichnet, ein Haus dar-
stellt in der gleichen Reduktion auf das
Wesentliche, ließe sich ein Rahmen als ein
Band zeichnen, das rechteckig in seiner Sil-
houette die innere Fläche umschließt, gegen
diese mit einer Kontur abgegrenzt, dem par-
allel verlaufend eine äußere Kontur dieses
Band umzeichnet. Dies ist und bleibt die
Idee des Rahmens, die sich oft bis zur Un-
kenntlichkeit versteckt, in allen weiteren
Rahmenschöpfungen aufweisen läßt. Die frü-
hen Rahmen des Quattrocento zeigen erst-
malig die Realisierung dieser schematischen
Darstellung im Raum. Ein schmales Profil
zum Bilde abfallend, ein proportional breite-
res Profil von der Fläche nach außen an-
steigend umgrenzen das Rahmenbild. Doch
schnell stellt der Schmucktrieb des Menschen
der Phantasie und dem Können des Hand-
werkers die verschiedensten Aufgaben. Orna-
ment belebt einmal vorzüglich rhythmisch-
plastisch die umgrenzenden Profile, male-
rische aber auch plastisch-ornamentale
Schmückung das andere Mal mit Vorliebe
die Bandfläche. Das verschiedentlichste Ma-
terial findet Verwendung als Oberfläche. Vor-
nehmlich ist es Gold und Holz, aber auch
Marmor, reizvolle malerische Imitation des-
selben, Pastä, Farbe. Die schmückende Orna-
mentik entnimmt die verschiedensten thema-
tischen Motive der Anregung durch die Na-
tur. Aber auch die handwerkliche Erfindung
erwächst in dieser Zeit zu erstaunlicher
Fülle. Das Gold und Holz wird mit feinstem
Empfinden und größtem Können zu den Far-
ben des Bildes abgetönt. Es ist abwegig,
anzunehmen, daß Holz in seiner Naturfarbe
verwendet wurde oder die käsige Farbe un-
getönten Goldes, sein ungebrochener mili-
tanter Glanz ohne weitere Behandlung be-
lassen wurden. Die Grundierung wird form-
gebend plastisch auf getragen (Pastiliierung),
die Pasta, eine Abart der Grundierungsmasse,
wird, in Formen gepreßt, welche der Rah¬
menkünstler in Stein, Alabaster oder Schiefer
unmittelbar im Negativ mit der munitiösen
Schärfe des Stichels zu schneiden versteht.
Die wenigen aus dieser Technik erhaltenen
Belege gehören zu den reizvollsten Gestal-
tungen des ausgehenden Quattrocento. Eine
dem Sgrafitto verwandte Arbeitsweise schafft
die goldornamentierten schwarzen, blauen,
braunen, oft bunten Flächen, aus denen
durch Herauskratzen der über dem Gokle
liegenden Farbe, die „Gravierung“ genannte
Ornamentik zutage tritt. Nahezu alle diese
Techniken sind im 19. Jahrhundert verloren
gegangen. Erst unserer
Zeit blieb es Vor-
behalten, durch Studi-
um der antiken Vorbil-
der und von den hand-
werklichen Vorausset-
zungen ausgehend, die
Techniken wieder neu
zu erfinden, welche die
Meister dieser versun-
kenen Zeiten so voll-
kommen beherrschten.
Die Freude am haut-
verwitternder Ma-
terie ließ den forschen-
den Handwerker unse-
rer Tage über diese
Wiederschöpfung verlo-
renen Handwerks hin-
aus danach streben,
auch alle Schönheiten
der Patina handwerk-
lich aufzubauen. Nicht
nur die farbige, auch
die Patina der Materie,
um mich so auszudrük-
ken, das Lockere porö-
ser Oberflächen gestal-
ten zu lernen; die Cra-
quelure, die Risse alten
Goldes kunstvoll ent-
stehen zu lassen, die auf
unwillkürliche Art die
glatten Flächen mit dis-
kretem Netzwerk durch-
ziehen. Sie bewirkt, daß
das Gold das Licht in
den verschiedensten
Brechungen zurück-
strahlen läßt in einer
Milde, die an Kerzen-
schimmer gemahnt. Dieses reiche Können,
welches das Handwerk unserer Tage wieder
zu erwerben verstanden hat, läßt Hoffen und
Glauben berechtigt erscheinen, daß, auf die-
ser Basis erwachsend, eine zeitgenössische
Rahmenkunst entstehen kann.
P. Tiecke (Fortsetzung folgt.)
Quattrocento Rahmen Florenz mit Pasteneinlage
(Photo: Tiecke)
der nach seinen grundlegenden Forschungen über den
Burgbau der Ordenszeit zusammenfassende Publikationen
über die mittelalterliche Skulptur und Malerei der
Ordensstaaten vorbereitet, umrissen hat.
Der Königsberger Verlag Graefe & Unzer,
seit Jahren bemüht, für die Kulturgüter Ostpreußens in
Publikationen zu werben, hat einige neue Werke
auf den Markt gebracht. Anton Ulbrich, dem wir
bereits eine zweibändige Veröffentlichung über die Bild-
hauerkunst Ostpreußens insbesondere der neueren Zeit
seit der Renaissance danken (im selben Verlag), gibt
in einem 272 Seiten starken Band — allerdings mit leider
vielfach völlig unzureichenden Abbildungen, für die
besserer Ersatz leicht zur Hand gewesen wäre — eine
gedrängte Uebersicht über die „Kunstgeschichte
Ostpreußens von der Ordenszeit bis
zur Gegenwart", die zwar auf neue kunstge-
schichtliche Aspekte verzichtet, aber als gewissenhafter
und klar eingeteilter Ueberblick — das Fehlen von Re-
gistern darum doppelt bedauerlich — sehr zu be-
grüßen ist.
Wer sich durch das im Jahre 1933 grotesk und
barock anmutende Widmungs-Vorwort Carl v o n
Lorcks nicht schrecken läßt, wird in dem Bande
„Herrenhäuser Ostpreußen s", der eine
Serie von Forschungen über Bauart und Kulturgehalt der
deutschen Herrenhäuser beginnt, auf eine Arbeit stoßen,
die mit ebenso großer wissenschaftlicher Akribie wie
darstellerischer Klarheit Probleme einer architektonischen
Gattung darstellt, die bisher kaum in den Bereich der
Wissenschaft getreten war. Dankenswert hier vor allem
der Katalog sämtlicher Guts- und Herrenhäuser Ost-
preußens aus der Spätgotik bis in die Gegenwart, die
baukünstlerisch von Interesse sind.
Das Gesamtbild Ostpreußens in Landschaft, Städten,
Burgen, Dörfern, Gehöften und Innenansichten wird in
222, teilweise photographisch als Spitzenleistungen an-
zusprechenden Abbildungen des Bandes ,,D a s ma-
lerische Ostpreußen" festgehalten. Auch dem
Kunsthistoriker wird hier eine reiche Ausbeute geboten,
die immer wieder auf viele noch ungelöste Probleme
ostdeutscher Kunst hinweist. W. R. D e u s c h
Jhiktions ‘ftachberichte
Auf der Kölner Lempertz-Auk-
t i o n am 27. November, die die bekannte
Gemäldesammlung Wesendonk
zur Auflösung brachte, sah man neben einer
großen Anzahl von privaten Sammlern und
Kunstfreunden viele Vertreter erster deut-
scher und ausländischer Kunsthandelsfirmen,
sowie rheinische Museumsfachleute. Die Ver-
steigerung nahm einen sehr flotten Verlauf,
und die Spitzenbilder der Wesendonk-Samm-
lung erbrachten recht imponierende Preise,
die bei einzelnen sogar beträchtlich über die
vorhergegangene Taxierung hinausgingen. —
Am Tag darauf, 28. Nov., versteigerte Lem-
Aeltere und neuere Kunstliteratur
beziehen Sie am schnellsten und preis-
wertesten durch die Buch- Abteilung des
Weltkunst-Verlages
Berlin W 62, Kurfürstenstr. 76 77
Telephon: B 5 7228
Telegramm-Adresse: „Weltkirnst Berlin"
pertz Plastik, Malerei, Kunsthandwerk und
Mobiliar des, 16.—18. Jahrhunderts. Auch hier
brachten alle Objekte von Qualität beacht-
liche Preise, was sich besonders bei den go¬
tischen Plastiken sowie bei den alten Silber-
schmiedearbeiten und den Bronzen zeigte
Eine genaue Preisliste veröffentlichen wii
nachstehend.
Nicolas Poussin, Inspiration des Dichters, (Paris, Louvre), Poussin-Ausstellung, Wien, Kunsthistorisches
Museum. Siehe Bericht S. 2 (Photo: Museum)
P r eis b e r i c f)
zum Einträgen in den Katalog
Math. Lemnertz. Köln
1 Mark
Nr.
Mark
Nr. :
Mark
2 7.
November 193 5
Nr.
S a m n
1 u n g
108
170.—
132
350.—
10
700.—
Wesend
onk -
von Biss:
n g
109
180.—
133
1500.-
12
100.--
V
ersteigt
r u n g
Westdeuts
eher
110
4000. -
135
1750.-
13/14
880.--
111
11500.—
136
360.—
15
1250.—
M
u s e u m
s b e s i t z
112
55.—
137
420.—
16
160.
PrpisR iihor
RM 100.—
114
490.-
144
300.—
18
170.—
116
620.—
145
600.—
19
520.—
117
bzü.- —
14/
Nr.
Mark
Nr.
Mark Nr.
Mark
118
800.
148
230.—
21
640.-
1
119
540 -
92a
230 --
22
150 -
76
240.—
85
HO.— 95
300.—
120
600—
98a
210.-
28
8800.--
77
2300.—
86
410.— 96
1050.—
121
300.--
1
510.-
24
7200.—
78
450.—
87
900.— 97
380.-
123
400.—
2
360.-
25
800.—
79
360.—
88
300.— 98
1000.—
124
3500.—
4
7000. - ■
26
300.-
80
85.—
90
350.— 99
950.—
125
590.—
5
180.—
28
540.—
81
410.-
91
2900.— 100
170.—
126
460.—
6
350.—
29
210.—
82
260.—
92
680.— 101
260.—
127
300.--
7
150.-
30
1500—
83
1500.—
93
250.— 104
320.—
128
HO.—
8
740.—
33
420.- -
84
310.-
94
110.- II 105
420.—
130
1600.—
9
2200,—
I 35
920.—
Katalog Nr. 377
Nr.
Mark
Nr.
Mark
Nr.
Mark
36
2900.—
51
160—
64
680—
37
580.—
52
6200—
65
12500—
38'
700.—
54
210—
66
520—
39
270.—
55
170.—
67
350.—
40
250—
56
480—
68
115—
41
510.--
57
1900—
69
130—
42
320.—
58
7000—
70
1100—
45
290.—
59
1300—
71
720—
47
550.— .
60
210—
73
2800—
50
310. -
62
310—
75
520—
V e r
steiger
u n g
vom 28
Nov
. 1935
Nr.
Mark
Nr.
Mark
1
Nr.
Mark
1
144
300—
196
250—
233
230—
145
600—
198
1200.-
234
120—
147
3000,
199
1000—
235
120—
148
230—
200
800—
236
950—
151
610.—
201
200—
240
330—
152
340.—
202
450—
241
150—
153
270.—
206
210—
245
480—
154
120.—
208
100—
247
250—
155
180.—
210
440—
250
125.—
156
170.—
212
260—
253
100—
157
350.-
214
260—
255
160—
158
600.—
215
210.-
256
120—
159
160—
216
1200—
257
210—
160
200,--
217
600—
259
360.—
162
160.
218
160—
262
HO,
163
150.—
219
180—
274
145—
166
160—
221
140—
288
140—
169
320—
222
1200—
289
940—
169a
200.
223
400—
291
210—
175
220.—
225
300—
292
1100—
176
300—
226
210—
294
620—
177
210, -
227
300—
298
160—
180
140—
228
600—
300
1650—
181
1700. -
229
660—
307
130—
185
190—
230
185—
308
100—
186
300—
231
210—
317
280—
191
220—
232
100—
352
340—
Galerie Commeter, Hamburg
2 7. November 1935
Alte und moderne Graphik
Nr.
Mark
Nr.
i (Mark']
Nr.
Mark
6
175—
58
430—
293
375.—
9
95—
60
470—
294
60—
15
250—
61
300—
296
60—
16
105.—
64
190—
297
105.—
18
185—
66
80—
298
65.—
19
115—
69
105—
299
100—
20
50.-
70
385.—
300
150—
21
390.--
73
55.—
301
100, -
22
255.--
77
85—
302
70.—
23
355—
82a
115—
303
50—
25
155.—
82b
75.—
304
75.—
27
210.—
171
155.—
305
150.—
28
100.—
183
90—
306
70—
35
180—
184
55.—
307
HO—
36
380.-
197
105—
308
90—
37
150—
207
65.—
309
100.—
40
105—
220
90—
311
85—
48
85—
221
125—
313
190. -
56
130.-
222
95—
317
165—
57
120—
223
95—
318
80—
58
250—
224
105—
319
70—