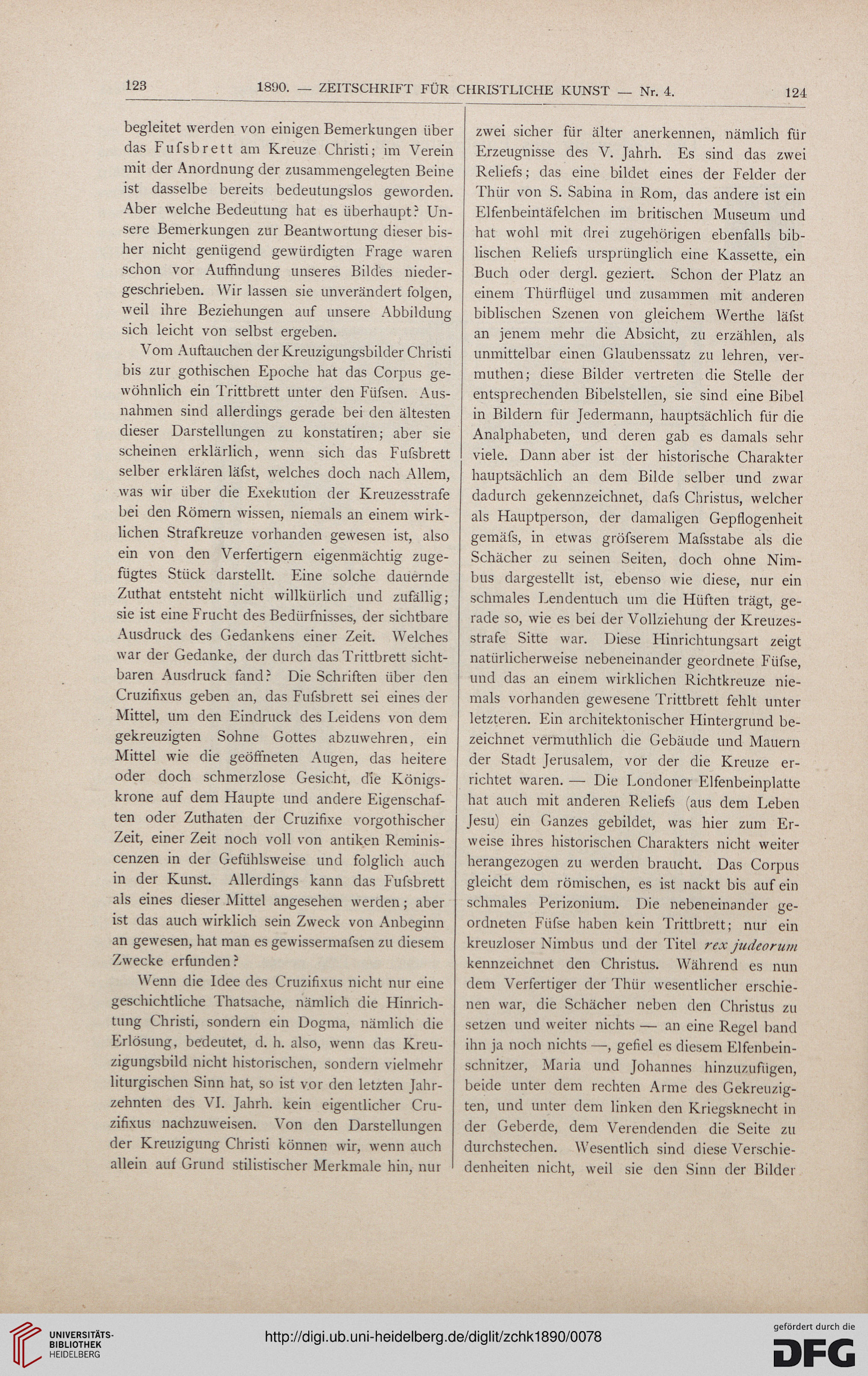123
1800.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 4.
124
begleitet werden von einigen Bemerkungen über
das Fufsbrett am Kreuze Christi; im Verein
mit der Anordnung der zusammengelegten Beine
ist dasselbe bereits bedeutungslos geworden.
Aber welche Bedeutung hat es überhaupt? Un-
sere Bemerkungen zur Beantwortung dieser bis-
her nicht genügend gewürdigten Frage waren
schon vor Auffindung unseres Bildes nieder-
geschrieben. Wir lassen sie unverändert folgen,
weil ihre Beziehungen auf unsere Abbildung
sich leicht von selbst ergeben.
Vom Auftauchen der Kreuzigungsbilder Christi
bis zur gothischen Epoche hat das Corpus ge-
wöhnlich ein Trittbrett unter den Füfsen. Aus-
nahmen sind allerdings gerade bei den ältesten
dieser Darstellungen zu konstatiren; aber sie
scheinen erklärlich, wenn sich das Fufsbrett
selber erklären läfst, welches doch nach Allem,
was wir über die Exekution der Kreuzesstrafe
bei den Römern wissen, niemals an einem wirk-
lichen Strafkreuze vorhanden gewesen ist, also
ein von den Verfertigern eigenmächtig zuge-
fügtes Stück darstellt. Eine solche dauernde
Zuthat entsteht nicht willkürlich und zufällig;
sie ist eine Frucht des Bedürfnisses, der sichtbare
Ausdruck des Gedankens einer Zeit. Welches
war der Gedanke, der durch das Trittbrett sicht-
baren Ausdruck fand? Die Schriften über den
Cruzifixus geben an, das Fufsbrett sei eines der
Mittel, um den Eindruck des Leidens von dem
gekreuzigten Sohne Gottes abzuwehren, ein
Mittel wie die geöffneten Augen, das heitere
oder doch schmerzlose Gesicht, die Königs-
krone auf dem Haupte und andere Eigenschaf-
ten oder Zuthaten der Cruzifixe vorgothischer
Zeit, einer Zeit noch voll von antiken Reminis-
cenzen in der Gefühlsweise und folglich auch
in der Kunst. Allerdings kann das Fufsbrett
als eines dieser Mittel angesehen werden; aber
ist das auch wirklich sein Zweck von Anbeginn
an gewesen, hat man es gewissermafsen zu diesem
Zwecke erfunden?
Wenn die Idee des Cruzifixus nicht nur eine
geschichtliche Thatsache, nämlich die Hinrich-
tung Christi, sondern ein Dogma, nämlich die
Erlösung, bedeutet, d. h. also, wenn das Kreu-
zigungsbild nicht historischen, sondern vielmehr
liturgischen Sinn hat, so ist vor den letzten Jahr-
zehnten des VI. Jahrh. kein eigentlicher Cru-
zifixus nachzuweisen. Von den Darstellungen
der Kreuzigung Christi können wir, wenn auch
allein auf Grund stilistischer Merkmale hin, nur
zwei sicher für älter anerkennen, nämlich für
Erzeugnisse des V. Jahrh. Es sind das zwei
Reliefs; das eine bildet eines der Felder der
Thür von S. Sabina in Rom, das andere ist ein
Elfenbeintäfelchen im britischen Museum und
hat wohl mit drei zugehörigen ebenfalls bib-
lischen Reliefs ursprünglich eine Kassette, ein
Buch oder dergl. geziert. Schon der Platz an
einem Thürflügel und zusammen mit anderen
biblischen Szenen von gleichem Werthe läfst
an jenem mehr die Absicht, zu erzählen, als
unmittelbar einen Glaubenssatz zu lehren, ver-
muthen; diese Bilder vertreten die Stelle der
entsprechenden Bibelstellen, sie sind eine Bibel
in Bildern für Jedermann, hauptsächlich für die
Analphabeten, und deren gab es damals sehr
viele. Dann aber ist der historische Charakter
hauptsächlich an dem Bilde selber und zwar
dadurch gekennzeichnet, dafs Christus, welcher
als Hauptperson, der damaligen Gepflogenheit
gemäfs, in etwas gröfserem Mafsstabe als die
Schacher zu seinen Seiten, doch ohne Nim-
bus dargestellt ist, ebenso wie diese, nur ein
schmales Lendentuch um die Hüften trägt, ge-
rade so, wie es bei der Vollziehung der Kreuzes-
strafe Sitte war. Diese Hinrichtungsart zeigt
natürlicherweise nebeneinander geordnete Füfse,
und das an einem wirklichen Richtkreuze nie-
mals vorhanden gewesene Trittbrett fehlt unter
letzteren. Ein architektonischer Hintergrund be-
zeichnet vermuthlich die Gebäude und Mauern
der Stadt Jerusalem, vor der die Kreuze er-
richtet waren. —■ Die Londoner Elfenbeinplatte
hat auch mit anderen Reliefs (aus dem Leben
Jesu) ein Ganzes gebildet, was hier zum Er-
weise ihres historischen Charakters nicht weiter
herangezogen zu werden braucht. Das Corpus
gleicht dem römischen, es ist nackt bis auf ein
schmales Perizonium. Die nebeneinander ge-
ordneten Füfse haben kein Trittbrett; nur ein
kreuzloser Nimbus und der Titel rex judeorum
kennzeichnet den Christus. Während es nun
dem Verfertiger der Thür wesentlicher erschie-
nen war, die Schacher neben den Christus zu
setzen und weiter nichts — an eine Regel band
ihn ja noch nichts —, gefiel es diesem Elfenbein-
schnitzer, Maria und Johannes hinzuzufügen,
beide unter dem rechten Arme des Gekreuzig-
ten, und unter dem linken den Kriegsknecht in
der Geberde, dem Verendenden die Seite zu
durchstechen. Wesentlich sind diese Verschie-
denheiten nicht, weil sie den Sinn der Bilder
1800.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 4.
124
begleitet werden von einigen Bemerkungen über
das Fufsbrett am Kreuze Christi; im Verein
mit der Anordnung der zusammengelegten Beine
ist dasselbe bereits bedeutungslos geworden.
Aber welche Bedeutung hat es überhaupt? Un-
sere Bemerkungen zur Beantwortung dieser bis-
her nicht genügend gewürdigten Frage waren
schon vor Auffindung unseres Bildes nieder-
geschrieben. Wir lassen sie unverändert folgen,
weil ihre Beziehungen auf unsere Abbildung
sich leicht von selbst ergeben.
Vom Auftauchen der Kreuzigungsbilder Christi
bis zur gothischen Epoche hat das Corpus ge-
wöhnlich ein Trittbrett unter den Füfsen. Aus-
nahmen sind allerdings gerade bei den ältesten
dieser Darstellungen zu konstatiren; aber sie
scheinen erklärlich, wenn sich das Fufsbrett
selber erklären läfst, welches doch nach Allem,
was wir über die Exekution der Kreuzesstrafe
bei den Römern wissen, niemals an einem wirk-
lichen Strafkreuze vorhanden gewesen ist, also
ein von den Verfertigern eigenmächtig zuge-
fügtes Stück darstellt. Eine solche dauernde
Zuthat entsteht nicht willkürlich und zufällig;
sie ist eine Frucht des Bedürfnisses, der sichtbare
Ausdruck des Gedankens einer Zeit. Welches
war der Gedanke, der durch das Trittbrett sicht-
baren Ausdruck fand? Die Schriften über den
Cruzifixus geben an, das Fufsbrett sei eines der
Mittel, um den Eindruck des Leidens von dem
gekreuzigten Sohne Gottes abzuwehren, ein
Mittel wie die geöffneten Augen, das heitere
oder doch schmerzlose Gesicht, die Königs-
krone auf dem Haupte und andere Eigenschaf-
ten oder Zuthaten der Cruzifixe vorgothischer
Zeit, einer Zeit noch voll von antiken Reminis-
cenzen in der Gefühlsweise und folglich auch
in der Kunst. Allerdings kann das Fufsbrett
als eines dieser Mittel angesehen werden; aber
ist das auch wirklich sein Zweck von Anbeginn
an gewesen, hat man es gewissermafsen zu diesem
Zwecke erfunden?
Wenn die Idee des Cruzifixus nicht nur eine
geschichtliche Thatsache, nämlich die Hinrich-
tung Christi, sondern ein Dogma, nämlich die
Erlösung, bedeutet, d. h. also, wenn das Kreu-
zigungsbild nicht historischen, sondern vielmehr
liturgischen Sinn hat, so ist vor den letzten Jahr-
zehnten des VI. Jahrh. kein eigentlicher Cru-
zifixus nachzuweisen. Von den Darstellungen
der Kreuzigung Christi können wir, wenn auch
allein auf Grund stilistischer Merkmale hin, nur
zwei sicher für älter anerkennen, nämlich für
Erzeugnisse des V. Jahrh. Es sind das zwei
Reliefs; das eine bildet eines der Felder der
Thür von S. Sabina in Rom, das andere ist ein
Elfenbeintäfelchen im britischen Museum und
hat wohl mit drei zugehörigen ebenfalls bib-
lischen Reliefs ursprünglich eine Kassette, ein
Buch oder dergl. geziert. Schon der Platz an
einem Thürflügel und zusammen mit anderen
biblischen Szenen von gleichem Werthe läfst
an jenem mehr die Absicht, zu erzählen, als
unmittelbar einen Glaubenssatz zu lehren, ver-
muthen; diese Bilder vertreten die Stelle der
entsprechenden Bibelstellen, sie sind eine Bibel
in Bildern für Jedermann, hauptsächlich für die
Analphabeten, und deren gab es damals sehr
viele. Dann aber ist der historische Charakter
hauptsächlich an dem Bilde selber und zwar
dadurch gekennzeichnet, dafs Christus, welcher
als Hauptperson, der damaligen Gepflogenheit
gemäfs, in etwas gröfserem Mafsstabe als die
Schacher zu seinen Seiten, doch ohne Nim-
bus dargestellt ist, ebenso wie diese, nur ein
schmales Lendentuch um die Hüften trägt, ge-
rade so, wie es bei der Vollziehung der Kreuzes-
strafe Sitte war. Diese Hinrichtungsart zeigt
natürlicherweise nebeneinander geordnete Füfse,
und das an einem wirklichen Richtkreuze nie-
mals vorhanden gewesene Trittbrett fehlt unter
letzteren. Ein architektonischer Hintergrund be-
zeichnet vermuthlich die Gebäude und Mauern
der Stadt Jerusalem, vor der die Kreuze er-
richtet waren. —■ Die Londoner Elfenbeinplatte
hat auch mit anderen Reliefs (aus dem Leben
Jesu) ein Ganzes gebildet, was hier zum Er-
weise ihres historischen Charakters nicht weiter
herangezogen zu werden braucht. Das Corpus
gleicht dem römischen, es ist nackt bis auf ein
schmales Perizonium. Die nebeneinander ge-
ordneten Füfse haben kein Trittbrett; nur ein
kreuzloser Nimbus und der Titel rex judeorum
kennzeichnet den Christus. Während es nun
dem Verfertiger der Thür wesentlicher erschie-
nen war, die Schacher neben den Christus zu
setzen und weiter nichts — an eine Regel band
ihn ja noch nichts —, gefiel es diesem Elfenbein-
schnitzer, Maria und Johannes hinzuzufügen,
beide unter dem rechten Arme des Gekreuzig-
ten, und unter dem linken den Kriegsknecht in
der Geberde, dem Verendenden die Seite zu
durchstechen. Wesentlich sind diese Verschie-
denheiten nicht, weil sie den Sinn der Bilder