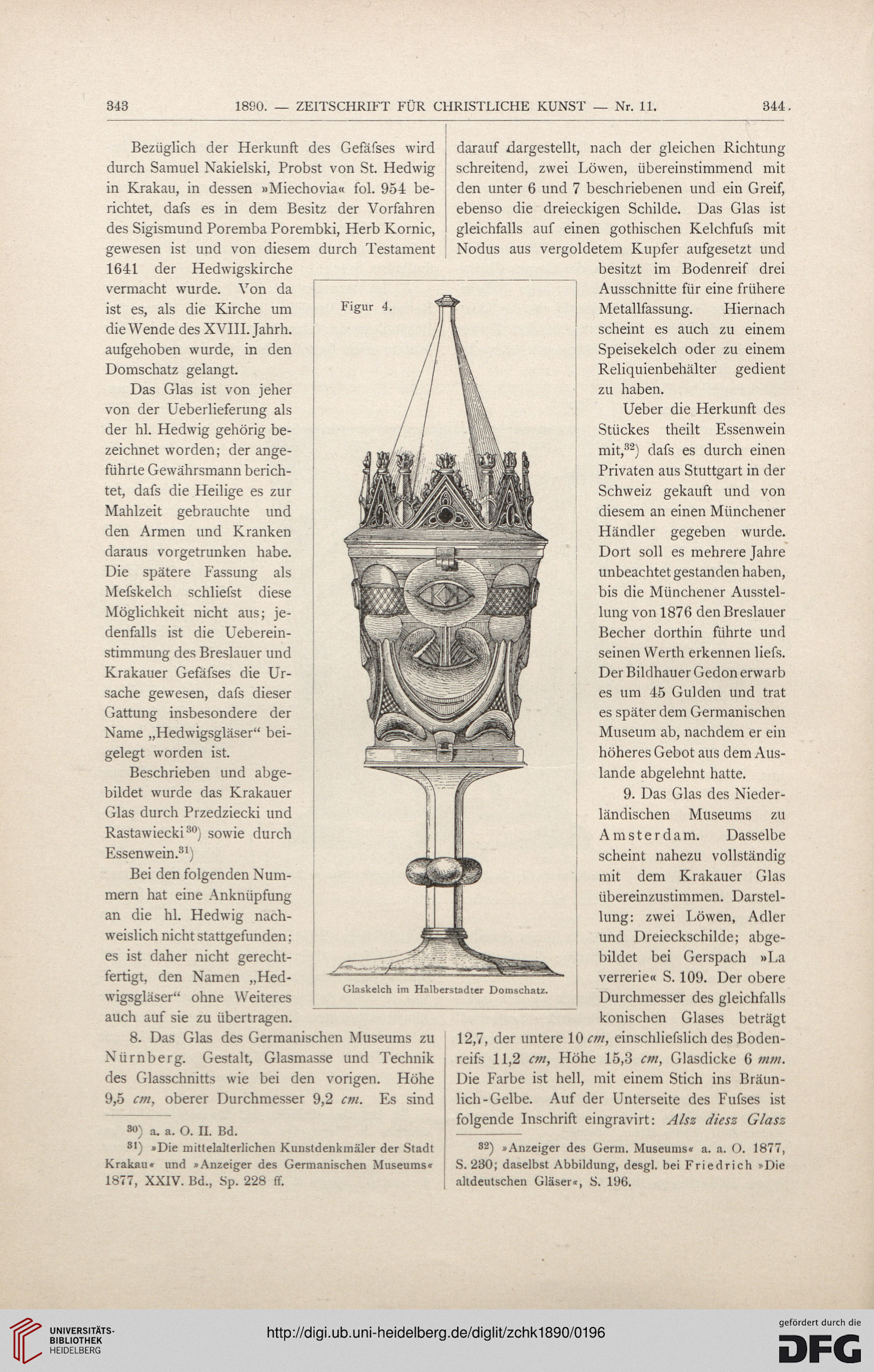343
1890.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
344.
Bezüglich der Herkunft des Gefäfses wird
durch Samuel Nakielski, Probst von St. Hedwig
in Krakau, in dessen »Miechovia« fol. 954 be-
richtet, dafs es in dem Besitz der Vorfahren
des Sigismund Poremba Porembki, Herb Kornic,
gewesen ist und von diesem durch Testament
1641 der Hedwigskirche
vermacht wurde. Von da
ist es, als die Kirche um
die Wende des XVIII. Jahrh.
aufgehoben wurde, in den
Domschatz gelangt.
Das Glas ist von jeher
von der Ueberlieferung als
der hl. Hedwig gehörig be-
zeichnet worden; der ange-
führte Gewährsmann berich-
tet, dafs die Heilige es zur
Mahlzeit gebrauchte und
den Armen und Kranken
daraus vorgetrunken habe.
Die spätere Fassung als
Mefskelch schliefst diese
Möglichkeit nicht aus; je-
denfalls ist die Ueberein-
stimmung des Breslauer und
Krakauer Gefäfses die Ur-
sache gewesen, dafs dieser
Gattung insbesondere der
Name „Hedwigsgläser" bei-
gelegt worden ist.
Beschrieben und abge-
bildet wurde das Krakauer
Glas durch Przedziecki und
Rastawiecki30) sowie durch
Essenwein.31)
Bei den folgenden Num-
mern hat eine Anknüpfung
an die hl. Hedwig nach-
weislich nicht stattgefunden;
es ist daher nicht gerecht-
fertigt, den Namen „Hed-
wigsgläser" ohne Weiteres
auch auf sie zu übertragen.
8. Das Glas des Germanischen Museums zu
Nürnberg. Gestalt, Glasmasse und Technik
des Glasschnitts wie bei den vorigen. Höhe
9,5 cm, oberer Durchmesser 9,2 cm. Es sind
30) a. a. O. II. Bd.
31) »Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler der Stadt
Krakau« und »Anzeiger des Germanischen Museums«
1877, XXIV. Bd., Sp. 228 ff.
darauf dargestellt, nach der gleichen Richtung
schreitend, zwei Löwen, übereinstimmend mit
den unter 6 und 7 beschriebenen und ein Greif,
ebenso die dreieckigen Schilde. Das Glas ist
gleichfalls auf einen gothischen Kelchfufs mit
Nodus aus vergoldetem Kupfer aufgesetzt und
besitzt im Bodenreif drei
Ausschnitte für eine frühere
Metallfassung. Hiernach
scheint es auch zu einem
Speisekelch oder zu einem
Reliquienbehälter gedient
zu haben.
Ueber die Herkunft des
Stückes theilt Essenwein
mit,32) dafs es durch einen
Privaten aus Stuttgart in der
Schweiz gekauft und von
diesem an einen Münchener
Händler gegeben wurde.
Dort soll es mehrere Jahre
unbeachtet gestanden haben,
bis die Münchener Ausstel-
lung von 1876 den Breslauer
Becher dorthin führte und
seinen Werth erkennen liefs.
Der Bildhauer Gedon erwarb
es um 45 Gulden und trat
es später dem Germanischen
Museum ab, nachdem er ein
höheres Gebot aus dem Aus-
lande abgelehnt hatte.
9. Das Glas des Nieder-
ländischen Museums zu
Amsterdam. Dasselbe
scheint nahezu vollständig
mit dem Krakauer Glas
übereinzustimmen. Darstel-
lung: zwei Löwen, Adler
und Dreieckschilde; abge-
bildet bei Gerspach »La
verrerie« S. 109. Der obere
Durchmesser des gleichfalls
konischen Glases beträgt
12,7, der untere 10 cm, einschliefslich des Boden-
reifs 11,2 cm, Höhe 15,3 cm, Glasdicke 6 mm.
Die Farbe ist hell, mit einem Stich ins Bräun-
lich-Gelbe. Auf der Unterseite des Fufses ist
folgende Inschrift eingravirt: Alsz diesz Glasz
92) »Anzeiger des Germ. Museums« a. a. O. 1877,
S. 230; daselbst Abbildung, desgl. bei Friedrich »Die
altdeutschen Gläser«, S. 196.
1890.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
344.
Bezüglich der Herkunft des Gefäfses wird
durch Samuel Nakielski, Probst von St. Hedwig
in Krakau, in dessen »Miechovia« fol. 954 be-
richtet, dafs es in dem Besitz der Vorfahren
des Sigismund Poremba Porembki, Herb Kornic,
gewesen ist und von diesem durch Testament
1641 der Hedwigskirche
vermacht wurde. Von da
ist es, als die Kirche um
die Wende des XVIII. Jahrh.
aufgehoben wurde, in den
Domschatz gelangt.
Das Glas ist von jeher
von der Ueberlieferung als
der hl. Hedwig gehörig be-
zeichnet worden; der ange-
führte Gewährsmann berich-
tet, dafs die Heilige es zur
Mahlzeit gebrauchte und
den Armen und Kranken
daraus vorgetrunken habe.
Die spätere Fassung als
Mefskelch schliefst diese
Möglichkeit nicht aus; je-
denfalls ist die Ueberein-
stimmung des Breslauer und
Krakauer Gefäfses die Ur-
sache gewesen, dafs dieser
Gattung insbesondere der
Name „Hedwigsgläser" bei-
gelegt worden ist.
Beschrieben und abge-
bildet wurde das Krakauer
Glas durch Przedziecki und
Rastawiecki30) sowie durch
Essenwein.31)
Bei den folgenden Num-
mern hat eine Anknüpfung
an die hl. Hedwig nach-
weislich nicht stattgefunden;
es ist daher nicht gerecht-
fertigt, den Namen „Hed-
wigsgläser" ohne Weiteres
auch auf sie zu übertragen.
8. Das Glas des Germanischen Museums zu
Nürnberg. Gestalt, Glasmasse und Technik
des Glasschnitts wie bei den vorigen. Höhe
9,5 cm, oberer Durchmesser 9,2 cm. Es sind
30) a. a. O. II. Bd.
31) »Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler der Stadt
Krakau« und »Anzeiger des Germanischen Museums«
1877, XXIV. Bd., Sp. 228 ff.
darauf dargestellt, nach der gleichen Richtung
schreitend, zwei Löwen, übereinstimmend mit
den unter 6 und 7 beschriebenen und ein Greif,
ebenso die dreieckigen Schilde. Das Glas ist
gleichfalls auf einen gothischen Kelchfufs mit
Nodus aus vergoldetem Kupfer aufgesetzt und
besitzt im Bodenreif drei
Ausschnitte für eine frühere
Metallfassung. Hiernach
scheint es auch zu einem
Speisekelch oder zu einem
Reliquienbehälter gedient
zu haben.
Ueber die Herkunft des
Stückes theilt Essenwein
mit,32) dafs es durch einen
Privaten aus Stuttgart in der
Schweiz gekauft und von
diesem an einen Münchener
Händler gegeben wurde.
Dort soll es mehrere Jahre
unbeachtet gestanden haben,
bis die Münchener Ausstel-
lung von 1876 den Breslauer
Becher dorthin führte und
seinen Werth erkennen liefs.
Der Bildhauer Gedon erwarb
es um 45 Gulden und trat
es später dem Germanischen
Museum ab, nachdem er ein
höheres Gebot aus dem Aus-
lande abgelehnt hatte.
9. Das Glas des Nieder-
ländischen Museums zu
Amsterdam. Dasselbe
scheint nahezu vollständig
mit dem Krakauer Glas
übereinzustimmen. Darstel-
lung: zwei Löwen, Adler
und Dreieckschilde; abge-
bildet bei Gerspach »La
verrerie« S. 109. Der obere
Durchmesser des gleichfalls
konischen Glases beträgt
12,7, der untere 10 cm, einschliefslich des Boden-
reifs 11,2 cm, Höhe 15,3 cm, Glasdicke 6 mm.
Die Farbe ist hell, mit einem Stich ins Bräun-
lich-Gelbe. Auf der Unterseite des Fufses ist
folgende Inschrift eingravirt: Alsz diesz Glasz
92) »Anzeiger des Germ. Museums« a. a. O. 1877,
S. 230; daselbst Abbildung, desgl. bei Friedrich »Die
altdeutschen Gläser«, S. 196.