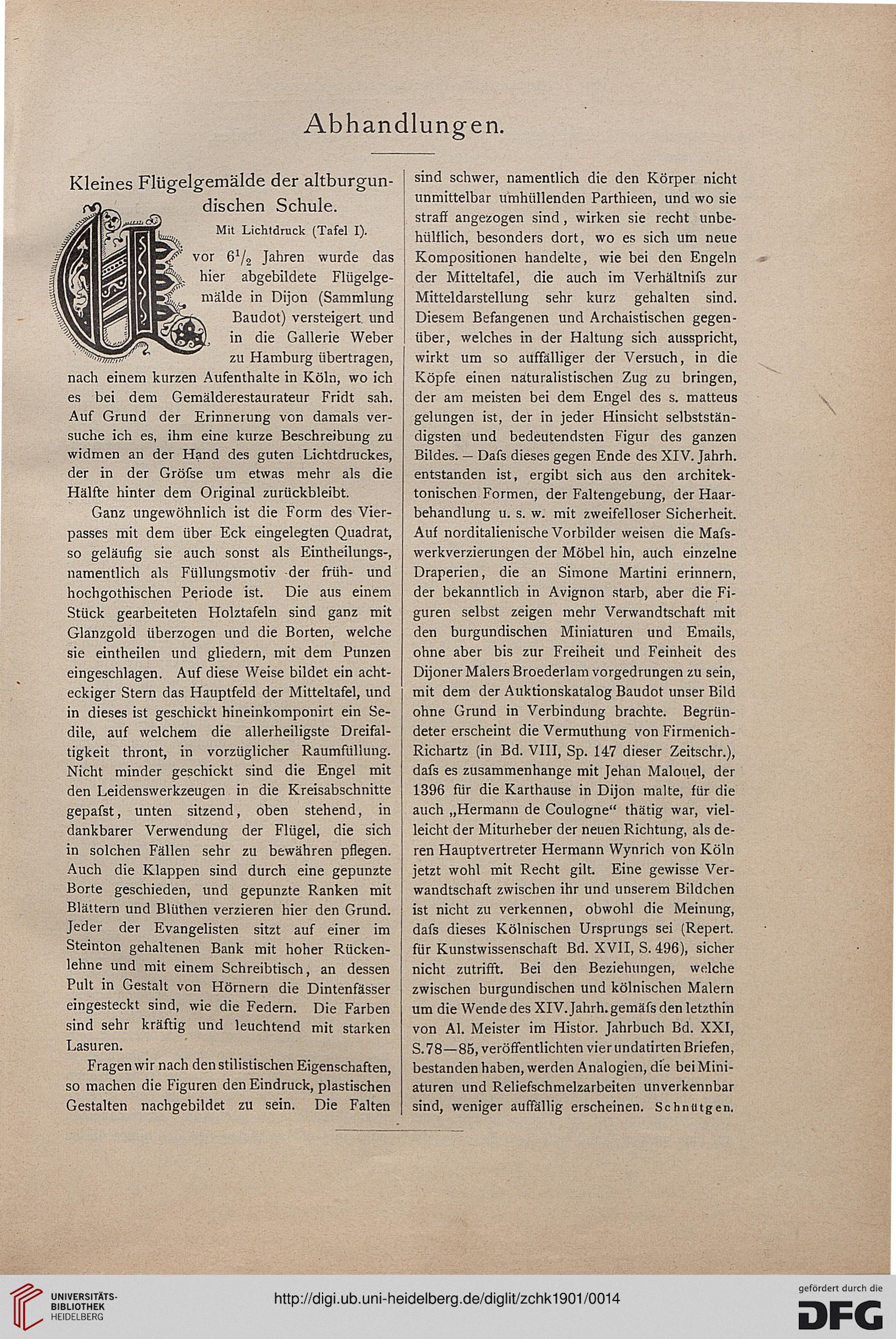Abhandlungen.
Kleines Flügelgemälde der altburgun-
dischen Schule.
Mit Lichtdruck (Tafel I).
vor 672 Jahren wurde das
hier abgebildete Flügelge-
mälde in Dijon (Sammlung
Baudot) versteigert und
in die Gallerie Weber
zu Hamburg übertragen,
nach einem kurzen Aufenthalte in Köln, wo ich
es bei dem Gemälderestaurateur Fridt sah.
Auf Grund der Erinnerung von damals ver-
suche ich es, ihm eine kurze Beschreibung zu
widmen an der Hand des guten Lichtdruckes,
der in der Gröfse um etwas mehr als die
Hälfte hinter dem Original zurückbleibt.
Ganz ungewöhnlich ist die Form des Vier-
passes mit dem über Eck eingelegten Quadrat,
so geläufig sie auch sonst als Eintheilungs-,
namentlich als Füllungsmotiv der früh- und
hochgothischen Periode ist. Die aus einem
Stück gearbeiteten Holztafeln sind ganz mit
Glanzgold überzogen und die Borten, welche
sie eintheilen und gliedern, mit dem Punzen
eingeschlagen. Auf diese Weise bildet ein acht-
eckiger Stern das Hauptfeld der Mitteltafel, und
in dieses ist geschickt hineinkomponirt ein Se-
dile, auf welchem die allerheiligste Dreifal-
tigkeit thront, in vorzüglicher Raumfüllung.
Nicht minder geschickt sind die Engel mit
den Leidenswerkzeugen in die Kreisabschnitte
gepafst, unten sitzend, oben stehend, in
dankbarer Verwendung der Flügel, die sich
in solchen Fällen sehr zu bewähren pflegen.
Auch die Klappen sind durch eine gepunzte
Borte geschieden, und gepunzte Ranken mit
Blättern und Blüthen verzieren hier den Grund.
Jeder der Evangelisten sitzt auf einer im
Steinton gehaltenen Bank mit hoher Rücken-
lehne und mit einem Schreibtisch, an dessen
Pult in Gestalt von Hörnern die Dintenfässer
eingesteckt sind, wie die Federn. Die Farben
sind sehr kräftig und leuchtend mit starken
Lasuren.
Fragen wir nach den stilistischen Eigenschaften,
so machen die Figuren den Eindruck, plastischen
Gestalten nachgebildet zu sein. Die Falten
sind schwer, namentlich die den Körper nicht
unmittelbar umhüllenden Parthieen, und wo sie
straff angezogen sind, wirken sie recht unbe-
hülflich, besonders dort, wo es sich um neue
Kompositionen handelte, wie bei den Engeln
der Mitteltafel, die auch im Verhältnifs zur
Mitteldarstellung sehr kurz gehalten sind.
Diesem Befangenen und Archaistischen gegen-
über, welches in der Haltung sich ausspricht,
wirkt um so auffälliger der Versuch, in die
Köpfe einen naturalistischen Zug zu bringen,
der am meisten bei dem Engel des s. matteus
gelungen ist, der in jeder Hinsicht selbststän-
digsten und bedeutendsten Figur des ganzen
Bildes. — Dafs dieses gegen Ende des XIV. Jahrh.
entstanden ist, ergibt sich aus den architek-
tonischen Formen, der Faltengebung, der Haar-
behandlung u. s. w. mit zweifelloser Sicherheit.
Auf norditalienische Vorbilder weisen die Mafs-
werkverzierungen der Möbel hin, auch einzelne
Draperien, die an Simone Martini erinnern,
der bekanntlich in Avignon starb, aber die Fi-
guren selbst zeigen mehr Verwandtschaft mit
den burgundischen Miniaturen und Emails,
ohne aber bis zur Freiheit und Feinheit des
Dijoner Malers Broederlam vorgedrungen zu sein,
mit dem der Auktionskatalog Baudot unser Bild
ohne Grund in Verbindung brachte. Begrün-
deter erscheint die Vermuthung von Firmenich-
Richartz (in Bd. VIII, Sp. 147 dieser Zeitschr.),
dafs es zusammenhange mit Jehan Malouel, der
1396 für die Karthause in Dijon malte, für die
auch „Hermann de Coulogne" thätig war, viel-
leicht der Miturheber der neuen Richtung, als de-
ren Hauptvertreter Hermann Wynrich von Köln
jetzt wohl mit Recht gilt. Eine gewisse Ver-
wandtschaft zwischen ihr und unserem Bildchen
ist nicht zu verkennen, obwohl die Meinung,
dafs dieses Kölnischen Ursprungs sei (Repert.
für Kunstwissenschaft Bd. XVII, S. 496), sicher
nicht zutrifft. Bei den Beziehungen, welche
zwischen burgundischen und kölnischen Malern
um die Wende des XIV. Jahrh. gemäfs den letzthin
von AI. Meister im Histor. Jahrbuch Bd. XXI,
S.78—85, veröffentlichten vier undatirten Briefen,
bestanden haben, werden Analogien, die bei Mini-
aturen und Reliefschmelzarbeiten unverkennbar
sind, weniger auffällig erscheinen. Schnütgen.
Kleines Flügelgemälde der altburgun-
dischen Schule.
Mit Lichtdruck (Tafel I).
vor 672 Jahren wurde das
hier abgebildete Flügelge-
mälde in Dijon (Sammlung
Baudot) versteigert und
in die Gallerie Weber
zu Hamburg übertragen,
nach einem kurzen Aufenthalte in Köln, wo ich
es bei dem Gemälderestaurateur Fridt sah.
Auf Grund der Erinnerung von damals ver-
suche ich es, ihm eine kurze Beschreibung zu
widmen an der Hand des guten Lichtdruckes,
der in der Gröfse um etwas mehr als die
Hälfte hinter dem Original zurückbleibt.
Ganz ungewöhnlich ist die Form des Vier-
passes mit dem über Eck eingelegten Quadrat,
so geläufig sie auch sonst als Eintheilungs-,
namentlich als Füllungsmotiv der früh- und
hochgothischen Periode ist. Die aus einem
Stück gearbeiteten Holztafeln sind ganz mit
Glanzgold überzogen und die Borten, welche
sie eintheilen und gliedern, mit dem Punzen
eingeschlagen. Auf diese Weise bildet ein acht-
eckiger Stern das Hauptfeld der Mitteltafel, und
in dieses ist geschickt hineinkomponirt ein Se-
dile, auf welchem die allerheiligste Dreifal-
tigkeit thront, in vorzüglicher Raumfüllung.
Nicht minder geschickt sind die Engel mit
den Leidenswerkzeugen in die Kreisabschnitte
gepafst, unten sitzend, oben stehend, in
dankbarer Verwendung der Flügel, die sich
in solchen Fällen sehr zu bewähren pflegen.
Auch die Klappen sind durch eine gepunzte
Borte geschieden, und gepunzte Ranken mit
Blättern und Blüthen verzieren hier den Grund.
Jeder der Evangelisten sitzt auf einer im
Steinton gehaltenen Bank mit hoher Rücken-
lehne und mit einem Schreibtisch, an dessen
Pult in Gestalt von Hörnern die Dintenfässer
eingesteckt sind, wie die Federn. Die Farben
sind sehr kräftig und leuchtend mit starken
Lasuren.
Fragen wir nach den stilistischen Eigenschaften,
so machen die Figuren den Eindruck, plastischen
Gestalten nachgebildet zu sein. Die Falten
sind schwer, namentlich die den Körper nicht
unmittelbar umhüllenden Parthieen, und wo sie
straff angezogen sind, wirken sie recht unbe-
hülflich, besonders dort, wo es sich um neue
Kompositionen handelte, wie bei den Engeln
der Mitteltafel, die auch im Verhältnifs zur
Mitteldarstellung sehr kurz gehalten sind.
Diesem Befangenen und Archaistischen gegen-
über, welches in der Haltung sich ausspricht,
wirkt um so auffälliger der Versuch, in die
Köpfe einen naturalistischen Zug zu bringen,
der am meisten bei dem Engel des s. matteus
gelungen ist, der in jeder Hinsicht selbststän-
digsten und bedeutendsten Figur des ganzen
Bildes. — Dafs dieses gegen Ende des XIV. Jahrh.
entstanden ist, ergibt sich aus den architek-
tonischen Formen, der Faltengebung, der Haar-
behandlung u. s. w. mit zweifelloser Sicherheit.
Auf norditalienische Vorbilder weisen die Mafs-
werkverzierungen der Möbel hin, auch einzelne
Draperien, die an Simone Martini erinnern,
der bekanntlich in Avignon starb, aber die Fi-
guren selbst zeigen mehr Verwandtschaft mit
den burgundischen Miniaturen und Emails,
ohne aber bis zur Freiheit und Feinheit des
Dijoner Malers Broederlam vorgedrungen zu sein,
mit dem der Auktionskatalog Baudot unser Bild
ohne Grund in Verbindung brachte. Begrün-
deter erscheint die Vermuthung von Firmenich-
Richartz (in Bd. VIII, Sp. 147 dieser Zeitschr.),
dafs es zusammenhange mit Jehan Malouel, der
1396 für die Karthause in Dijon malte, für die
auch „Hermann de Coulogne" thätig war, viel-
leicht der Miturheber der neuen Richtung, als de-
ren Hauptvertreter Hermann Wynrich von Köln
jetzt wohl mit Recht gilt. Eine gewisse Ver-
wandtschaft zwischen ihr und unserem Bildchen
ist nicht zu verkennen, obwohl die Meinung,
dafs dieses Kölnischen Ursprungs sei (Repert.
für Kunstwissenschaft Bd. XVII, S. 496), sicher
nicht zutrifft. Bei den Beziehungen, welche
zwischen burgundischen und kölnischen Malern
um die Wende des XIV. Jahrh. gemäfs den letzthin
von AI. Meister im Histor. Jahrbuch Bd. XXI,
S.78—85, veröffentlichten vier undatirten Briefen,
bestanden haben, werden Analogien, die bei Mini-
aturen und Reliefschmelzarbeiten unverkennbar
sind, weniger auffällig erscheinen. Schnütgen.