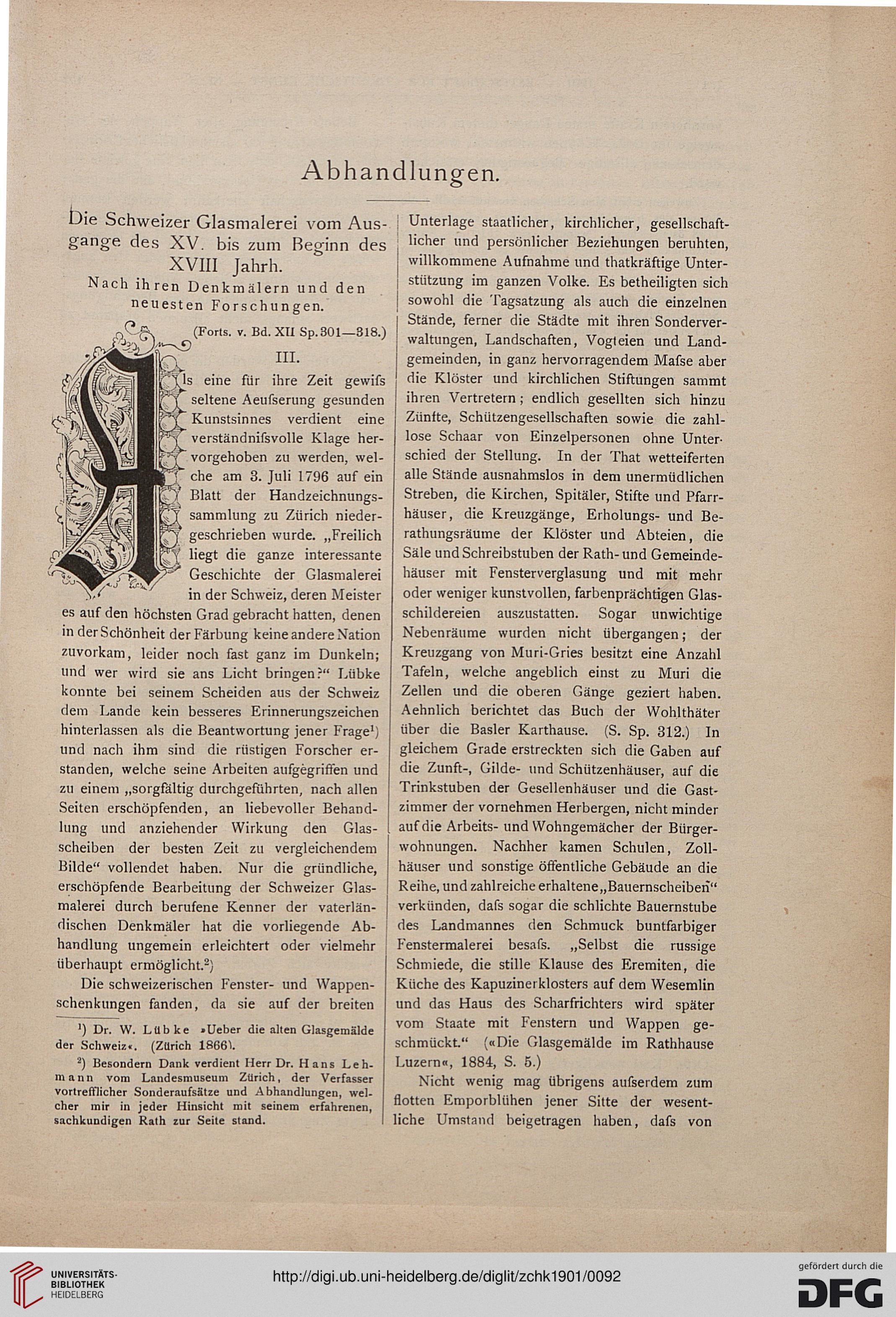Abhandlungen.
Die Schweizer Glasmalerei vom Aus-
gange des XV. bis zum Beginn des
XVIII Jahrh.
Nach ihren Denkmälern und den
neuesten Forschungen.
"^SS (Forts- v- Bd- XIX Sp. 301—318.)
-^n~ III.
ls eine für ihre Zeit gewifs
seltene Aeufserung gesunden
Kunstsinnes verdient eine
verständnifsvolle Klage her-
vorgehoben zu werden, wel-
che am 3. Juli 1796 auf ein
Blatt der Handzeichnungs-
sammlung zu Zürich nieder-
geschrieben wurde. „Freilich
liegt die ganze interessante
Geschichte der Glasmalerei
__________________l.in der Schweiz, deren Meister
es auf den höchsten Grad gebracht hatten, denen
in der Schönheit der Färbung keine andere Nation
zuvorkam, leider noch fast ganz im Dunkeln;
und wer wird sie ans Licht bringen?" Lübke
konnte bei seinem Scheiden aus der Schweiz
dem Lande kein besseres Erinnerungszeichen
hinterlassen als die Beantwortung jener Frage1)
und nach ihm sind die rüstigen Forscher er-
standen, welche seine Arbeiten aufgegriffen und
zu einem „sorgfältig durchgeführten, nach allen
Seiten erschöpfenden, an liebevoller Behand-
lung und anziehender Wirkung den Glas-
scheiben der besten Zeit zu vergleichendem
Bilde" vollendet haben. Nur die gründliche,
erschöpfende Bearbeitung der Schweizer Glas-
malerei durch berufene Kenner der vaterlän-
dischen Denkmäler hat die vorliegende Ab-
handlung ungemein erleichtert oder vielmehr
überhaupt ermöglicht.2}
Die schweizerischen Fenster- und Wappen-
schenkungen fanden, da sie auf der breiten
1) Dr. W. Lübke »lieber die alten Glasgemälde
der Schweiz«. (Zürich 1866V
2) Besondern Dank verdient Herr Dr. Hans Leh-
mann vom Landesmuseum Zürich, der Verfasser
vortrefflicher Sonderaufsätze und Abhandlungen, wel-
cher mir in jeder Hinsicht mit seinem erfahrenen,
sachkundigen Rath zur Seite stand.
; Unterlage staatlicher, kirchlicher, gesellschaft-
licher und persönlicher Beziehungen beruhten,
willkommene Aufnahme und thatkräftige Unter-
stützung im ganzen Volke. Es betheiligten sich
sowohl die Tagsatzung als auch die einzelnen
Stände, ferner die Städte mit ihren Sonderver-
waltungen, Landschaften, Vogleien und Land-
gemeinden, in ganz hervorragendem Mafse aber
die Klöster und kirchlichen Stiftungen sammt
ihren Vertretern; endlich gesellten sich hinzu
Zünfte, Schützengesellschaften sowie die zahl-
lose Schaar von Einzelpersonen ohne Unter-
schied der Stellung. In der That wetteiferten
alle Stände ausnahmslos in dem unermüdlichen
Streben, die Kirchen, Spitäler, Stifte und Pfarr-
häuser, die Kreuzgänge, Erholungs- und Be-
rathungsräume der Klöster und Abteien, die
Säle und Schreibstuben der Rath- und Gemeinde-
häuser mit Fensterverglasung und mit mehr
oder weniger kunstvollen, farbenprächtigen Glas-
schildereien auszustatten. Sogar unwichtige
Nebenräume wurden nicht übergangen; der
Kreuzgang von Muri-Gries besitzt eine Anzahl
Tafeln, welche angeblich einst zu Muri die
Zellen und die oberen Gänge geziert haben.
Aehnlich berichtet das Buch der Wohlthäter
über die Basler Karthause. (S. Sp. 312.) In
gleichem Grade erstreckten sich die Gaben auf
die Zunft-, Gilde- und Schützenhäuser, auf die
Trinkstuben der Gesellenhäuser und die Gast-
zimmer der vornehmen Herbergen, nicht minder
auf die Arbeits- und Wohngemächer der Bürger-
wohnungen. Nachher kamen Schulen, Zoll-
häuser und sonstige öffentliche Gebäude an die
Reihe, und zahlreiche erhaltene„Bauernscheiberi"
verkünden, dafs sogar die schlichte Bauernstube
des Landmannes den Schmuck buntfarbiger
Fenstermalerei besafs. „Selbst die russige
Schmiede, die stille Klause des Eremiten, die
Küche des Kapuzinei klosters auf dem Wesemlin
und das Haus des Scharfrichters wird später
vom Staate mit Fenstern und Wappen ge-
schmückt." («Die Glasgemälde im Rathhause
Luzerne, 1884, S. 5.)
Nicht wenig mag übrigens aufserdem zum
flotten Emporblühen jener Sitte der wesent-
liche Umstand beigetragen haben, dafs von
Die Schweizer Glasmalerei vom Aus-
gange des XV. bis zum Beginn des
XVIII Jahrh.
Nach ihren Denkmälern und den
neuesten Forschungen.
"^SS (Forts- v- Bd- XIX Sp. 301—318.)
-^n~ III.
ls eine für ihre Zeit gewifs
seltene Aeufserung gesunden
Kunstsinnes verdient eine
verständnifsvolle Klage her-
vorgehoben zu werden, wel-
che am 3. Juli 1796 auf ein
Blatt der Handzeichnungs-
sammlung zu Zürich nieder-
geschrieben wurde. „Freilich
liegt die ganze interessante
Geschichte der Glasmalerei
__________________l.in der Schweiz, deren Meister
es auf den höchsten Grad gebracht hatten, denen
in der Schönheit der Färbung keine andere Nation
zuvorkam, leider noch fast ganz im Dunkeln;
und wer wird sie ans Licht bringen?" Lübke
konnte bei seinem Scheiden aus der Schweiz
dem Lande kein besseres Erinnerungszeichen
hinterlassen als die Beantwortung jener Frage1)
und nach ihm sind die rüstigen Forscher er-
standen, welche seine Arbeiten aufgegriffen und
zu einem „sorgfältig durchgeführten, nach allen
Seiten erschöpfenden, an liebevoller Behand-
lung und anziehender Wirkung den Glas-
scheiben der besten Zeit zu vergleichendem
Bilde" vollendet haben. Nur die gründliche,
erschöpfende Bearbeitung der Schweizer Glas-
malerei durch berufene Kenner der vaterlän-
dischen Denkmäler hat die vorliegende Ab-
handlung ungemein erleichtert oder vielmehr
überhaupt ermöglicht.2}
Die schweizerischen Fenster- und Wappen-
schenkungen fanden, da sie auf der breiten
1) Dr. W. Lübke »lieber die alten Glasgemälde
der Schweiz«. (Zürich 1866V
2) Besondern Dank verdient Herr Dr. Hans Leh-
mann vom Landesmuseum Zürich, der Verfasser
vortrefflicher Sonderaufsätze und Abhandlungen, wel-
cher mir in jeder Hinsicht mit seinem erfahrenen,
sachkundigen Rath zur Seite stand.
; Unterlage staatlicher, kirchlicher, gesellschaft-
licher und persönlicher Beziehungen beruhten,
willkommene Aufnahme und thatkräftige Unter-
stützung im ganzen Volke. Es betheiligten sich
sowohl die Tagsatzung als auch die einzelnen
Stände, ferner die Städte mit ihren Sonderver-
waltungen, Landschaften, Vogleien und Land-
gemeinden, in ganz hervorragendem Mafse aber
die Klöster und kirchlichen Stiftungen sammt
ihren Vertretern; endlich gesellten sich hinzu
Zünfte, Schützengesellschaften sowie die zahl-
lose Schaar von Einzelpersonen ohne Unter-
schied der Stellung. In der That wetteiferten
alle Stände ausnahmslos in dem unermüdlichen
Streben, die Kirchen, Spitäler, Stifte und Pfarr-
häuser, die Kreuzgänge, Erholungs- und Be-
rathungsräume der Klöster und Abteien, die
Säle und Schreibstuben der Rath- und Gemeinde-
häuser mit Fensterverglasung und mit mehr
oder weniger kunstvollen, farbenprächtigen Glas-
schildereien auszustatten. Sogar unwichtige
Nebenräume wurden nicht übergangen; der
Kreuzgang von Muri-Gries besitzt eine Anzahl
Tafeln, welche angeblich einst zu Muri die
Zellen und die oberen Gänge geziert haben.
Aehnlich berichtet das Buch der Wohlthäter
über die Basler Karthause. (S. Sp. 312.) In
gleichem Grade erstreckten sich die Gaben auf
die Zunft-, Gilde- und Schützenhäuser, auf die
Trinkstuben der Gesellenhäuser und die Gast-
zimmer der vornehmen Herbergen, nicht minder
auf die Arbeits- und Wohngemächer der Bürger-
wohnungen. Nachher kamen Schulen, Zoll-
häuser und sonstige öffentliche Gebäude an die
Reihe, und zahlreiche erhaltene„Bauernscheiberi"
verkünden, dafs sogar die schlichte Bauernstube
des Landmannes den Schmuck buntfarbiger
Fenstermalerei besafs. „Selbst die russige
Schmiede, die stille Klause des Eremiten, die
Küche des Kapuzinei klosters auf dem Wesemlin
und das Haus des Scharfrichters wird später
vom Staate mit Fenstern und Wappen ge-
schmückt." («Die Glasgemälde im Rathhause
Luzerne, 1884, S. 5.)
Nicht wenig mag übrigens aufserdem zum
flotten Emporblühen jener Sitte der wesent-
liche Umstand beigetragen haben, dafs von