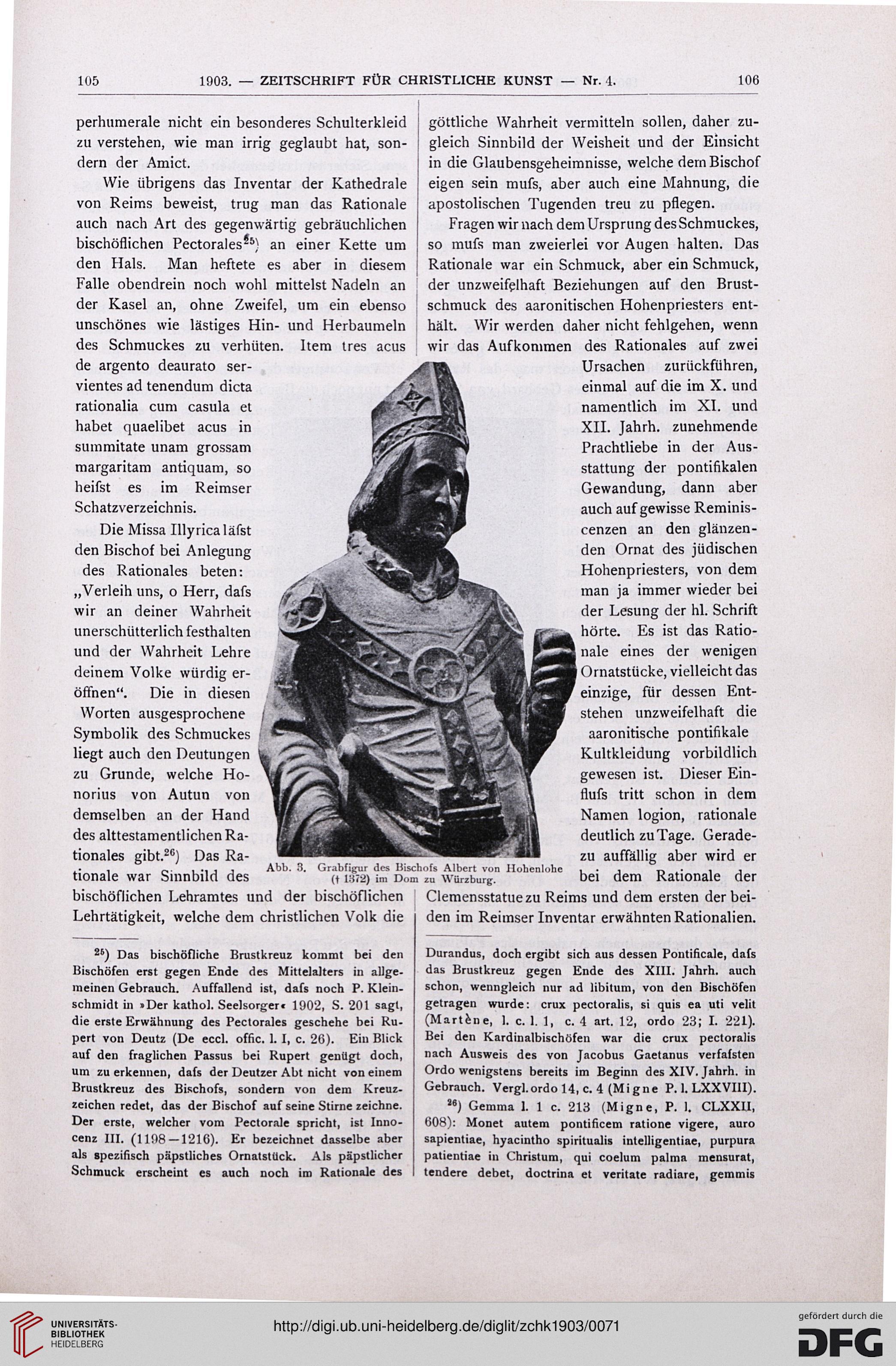105
1903. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
106
perhumerale nicht ein besonderes Schulterkleid
zu verstehen, wie man irrig geglaubt hat, son-
dern der Amict.
Wie übrigens das Inventar der Kathedrale
von Reims beweist, trug man das Rationale
auch nach Art des gegenwärtig gebräuchlichen
bischöflichen Pectorales*5) an einer Kette um
den Hals. Man heftete es aber in diesem
Falle obendrein noch wohl mittelst Nadeln an
der Kasel an, ohne Zweifel, um ein ebenso
unschönes wie lästiges Hin- und Herbaumeln
des Schmuckes zu verhüten. Item tres acus
de argento deaurato ser-
vientes ad tenendum dicta
rationalia cum casula et
habet quaelibet acus in
summitate unam grossam
margaritam antiquam, so
heifst es im Reimser
Schatzverzeichnis.
Die Missa Illyricaläfst
den Bischof bei Anlegung
des Rationales beten:
„Verleih uns, o Herr, dafs
wir an deiner Wahrheit
unerschütterlich festhalten
und der Wahrheit Lehre
deinem Volke würdig er-
öffnen". Die in diesen
Worten ausgesprochene
Symbolik des Schmuckes
liegt auch den Deutungen
zu Grunde, welche Ho-
norius von Autun von
demselben an der Hand
des alttestamentlichen Ra-
tionales gibt.20) Das Ra-
tionale war Sinnbild des
bischöflichen Lehramtes und der bischöflichen
Lehrtätigkeit, welche dem christlichen Volk die
göttliche Wahrheit vermitteln sollen, daher zu-
gleich Sinnbild der Weisheit und der Einsicht
in die Glaubensgeheimnisse, welche dem Bischof
eigen sein mufs, aber auch eine Mahnung, die
apostolischen Tugenden treu zu pflegen.
Fragen wir nach dem Ursprung des Schmuckes,
so mufs man zweierlei vor Augen halten. Das
Rationale war ein Schmuck, aber ein Schmuck,
der unzweifelhaft Beziehungen auf den Brust-
schmuck des aaronitischen Hohenpriesters ent-
hält. Wir werden daher nicht fehlgehen, wenn
wir das Aufkommen des Rationales auf zwei
Ursachen zurückführen,
einmal auf die im X. und
namentlich im XI. und
XII. Jahrh. zunehmende
Prachtliebe in der Aus-
stattung der pontifikalen
Gewandung, dann aber
auch auf gewisse Reminis-
cenzen an den glänzen-
den Ornat des jüdischen
Hohenpriesters, von dem
man ja immer wieder bei
der Lesung der hl. Schrift
hörte. Es ist das Ratio-
nale eines der wenigen
Ornatstücke, vielleicht das
einzige, für dessen Ent-
stehen unzweifelhaft die
aaronitische pontifikale
Kultkleidung vorbildlich
gewesen ist. Dieser Ein-
flufs tritt schon in dem
Namen logion, rationale
deutlich zu Tage. Gerade-
zu auffällig aber wird er
Abb. 3. Grabfigur des Bischofs Albert von Hohenlohe i • j r» *.' i j
(t 1372) im Dom zu Würzburg. bei dem Kationale der
Clemensstatue zu Reims und dem ersten der bei-
den im Reimser Inventar erwähnten Rationalien.
26) Das bischöfliche Brustkreuz kommt bei den
Bischöfen erst gegen Ende des Mittelalters in allge-
meinen Gebrauch. Auffallend ist, dafs noch P. Klein-
schmidt in »Der kathol. Seelsorgerc 1902, S. 201 sagt,
die erste Erwähnung des Pectorales geschehe bei Ru-
pert von Deutz (De eccl. offic. 1. I, c. 26). Ein Blick
auf den fraglichen Passus bei Rupert genügt doch,
um zu erkennen, dafs der Deutzer Abt nicht von einem
Brustkreuz des Bischofs, sondern von dem Kreuz-
zeichen redet, das der Bischof auf seine Stirne zeichne.
Der erste, welcher vom Pectorale spricht, ist Inno-
cenz III. (1198-1216). Er bezeichnet dasselbe aber
als spezifisch päpstliches Ornatstück. Als päpstlicher
Schmuck erscheint es auch noch im Rationale des
Durandus, doch ergibt sich aus dessen Pontificale, dafs
das Brustkreuz gegen Ende des XIII. Jahrh. auch
schon, wenngleich nur ad libitum, von den Bischöfen
getragen wurde: crux pectoralis, si quis ea uti velit
(Märten e, 1. c. 1. 1, c. 4 art. 12, ordo 23; I. 221).
Bei den Kardinalbischöfen war die crux pectoralis
nach Ausweis des von Jacobus Gaetanus verfalsten
Ordo wenigstens bereits im Beginn des XIV. Jahrh. in
Gebrauch. Vergl.ordo 14, c. 4 (Migne P. 1. LXXVIII).
J6) Gemma 1. 1 c. 213 (Migne, P. 1. CLXXII,
608): Monet autem pontincem ratione vigere, auro
sapientiae, hyacintho spiritualis intelligentiae, purpura
patientiae in Christum, qui coelum palma mensurat,
tendere debet, doctrina et veritate radiäre, gemmis
1903. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
106
perhumerale nicht ein besonderes Schulterkleid
zu verstehen, wie man irrig geglaubt hat, son-
dern der Amict.
Wie übrigens das Inventar der Kathedrale
von Reims beweist, trug man das Rationale
auch nach Art des gegenwärtig gebräuchlichen
bischöflichen Pectorales*5) an einer Kette um
den Hals. Man heftete es aber in diesem
Falle obendrein noch wohl mittelst Nadeln an
der Kasel an, ohne Zweifel, um ein ebenso
unschönes wie lästiges Hin- und Herbaumeln
des Schmuckes zu verhüten. Item tres acus
de argento deaurato ser-
vientes ad tenendum dicta
rationalia cum casula et
habet quaelibet acus in
summitate unam grossam
margaritam antiquam, so
heifst es im Reimser
Schatzverzeichnis.
Die Missa Illyricaläfst
den Bischof bei Anlegung
des Rationales beten:
„Verleih uns, o Herr, dafs
wir an deiner Wahrheit
unerschütterlich festhalten
und der Wahrheit Lehre
deinem Volke würdig er-
öffnen". Die in diesen
Worten ausgesprochene
Symbolik des Schmuckes
liegt auch den Deutungen
zu Grunde, welche Ho-
norius von Autun von
demselben an der Hand
des alttestamentlichen Ra-
tionales gibt.20) Das Ra-
tionale war Sinnbild des
bischöflichen Lehramtes und der bischöflichen
Lehrtätigkeit, welche dem christlichen Volk die
göttliche Wahrheit vermitteln sollen, daher zu-
gleich Sinnbild der Weisheit und der Einsicht
in die Glaubensgeheimnisse, welche dem Bischof
eigen sein mufs, aber auch eine Mahnung, die
apostolischen Tugenden treu zu pflegen.
Fragen wir nach dem Ursprung des Schmuckes,
so mufs man zweierlei vor Augen halten. Das
Rationale war ein Schmuck, aber ein Schmuck,
der unzweifelhaft Beziehungen auf den Brust-
schmuck des aaronitischen Hohenpriesters ent-
hält. Wir werden daher nicht fehlgehen, wenn
wir das Aufkommen des Rationales auf zwei
Ursachen zurückführen,
einmal auf die im X. und
namentlich im XI. und
XII. Jahrh. zunehmende
Prachtliebe in der Aus-
stattung der pontifikalen
Gewandung, dann aber
auch auf gewisse Reminis-
cenzen an den glänzen-
den Ornat des jüdischen
Hohenpriesters, von dem
man ja immer wieder bei
der Lesung der hl. Schrift
hörte. Es ist das Ratio-
nale eines der wenigen
Ornatstücke, vielleicht das
einzige, für dessen Ent-
stehen unzweifelhaft die
aaronitische pontifikale
Kultkleidung vorbildlich
gewesen ist. Dieser Ein-
flufs tritt schon in dem
Namen logion, rationale
deutlich zu Tage. Gerade-
zu auffällig aber wird er
Abb. 3. Grabfigur des Bischofs Albert von Hohenlohe i • j r» *.' i j
(t 1372) im Dom zu Würzburg. bei dem Kationale der
Clemensstatue zu Reims und dem ersten der bei-
den im Reimser Inventar erwähnten Rationalien.
26) Das bischöfliche Brustkreuz kommt bei den
Bischöfen erst gegen Ende des Mittelalters in allge-
meinen Gebrauch. Auffallend ist, dafs noch P. Klein-
schmidt in »Der kathol. Seelsorgerc 1902, S. 201 sagt,
die erste Erwähnung des Pectorales geschehe bei Ru-
pert von Deutz (De eccl. offic. 1. I, c. 26). Ein Blick
auf den fraglichen Passus bei Rupert genügt doch,
um zu erkennen, dafs der Deutzer Abt nicht von einem
Brustkreuz des Bischofs, sondern von dem Kreuz-
zeichen redet, das der Bischof auf seine Stirne zeichne.
Der erste, welcher vom Pectorale spricht, ist Inno-
cenz III. (1198-1216). Er bezeichnet dasselbe aber
als spezifisch päpstliches Ornatstück. Als päpstlicher
Schmuck erscheint es auch noch im Rationale des
Durandus, doch ergibt sich aus dessen Pontificale, dafs
das Brustkreuz gegen Ende des XIII. Jahrh. auch
schon, wenngleich nur ad libitum, von den Bischöfen
getragen wurde: crux pectoralis, si quis ea uti velit
(Märten e, 1. c. 1. 1, c. 4 art. 12, ordo 23; I. 221).
Bei den Kardinalbischöfen war die crux pectoralis
nach Ausweis des von Jacobus Gaetanus verfalsten
Ordo wenigstens bereits im Beginn des XIV. Jahrh. in
Gebrauch. Vergl.ordo 14, c. 4 (Migne P. 1. LXXVIII).
J6) Gemma 1. 1 c. 213 (Migne, P. 1. CLXXII,
608): Monet autem pontincem ratione vigere, auro
sapientiae, hyacintho spiritualis intelligentiae, purpura
patientiae in Christum, qui coelum palma mensurat,
tendere debet, doctrina et veritate radiäre, gemmis