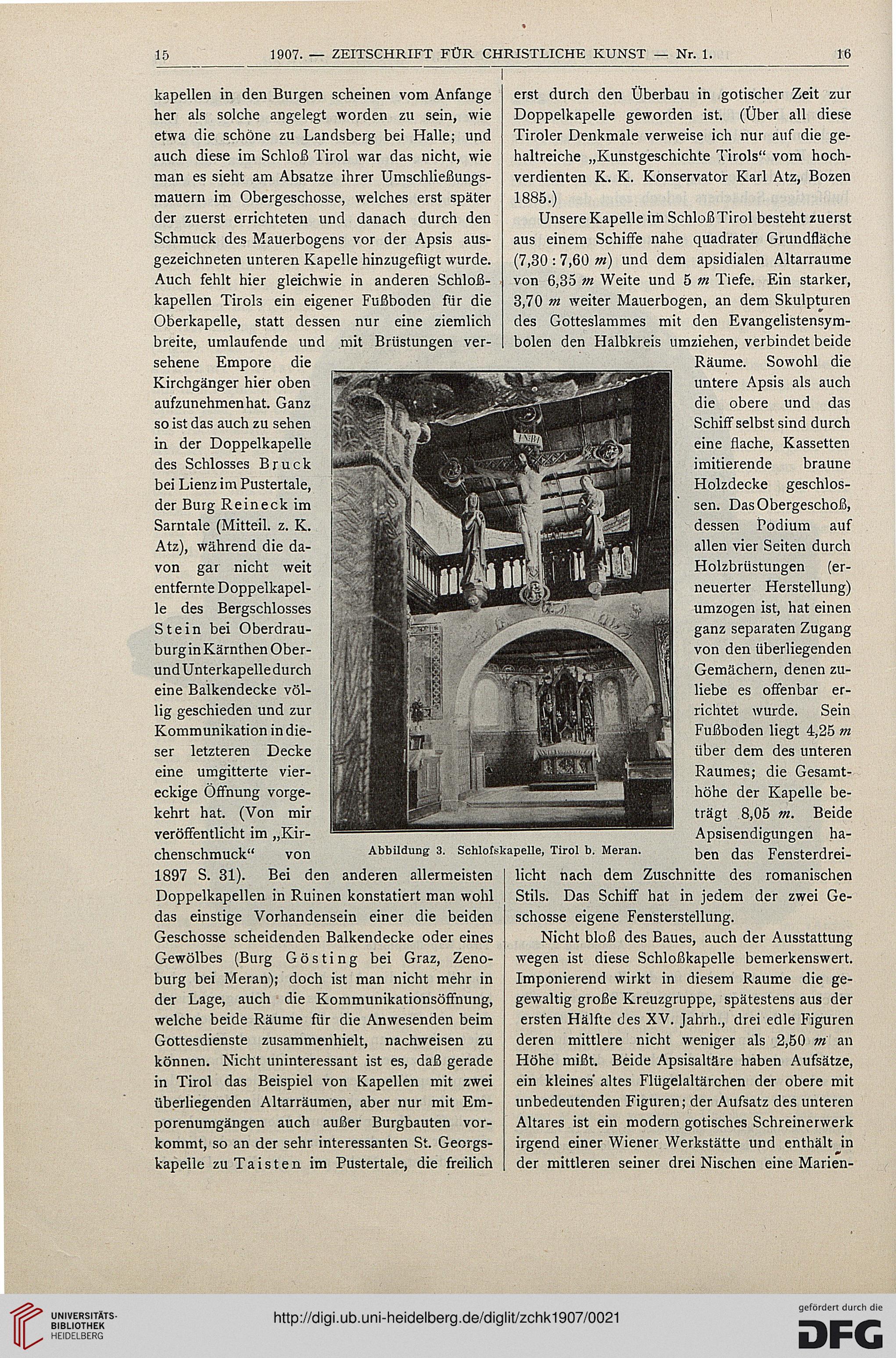15
1907.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
16
kapellen in den Burgen scheinen vom Anfange
her als solche angelegt worden zu sein, wie
etwa die schöne zu Landsberg bei Halle; und
auch diese im Schloß Tirol war das nicht, wie
man es sieht am Absätze ihrer Umschließungs-
mauern im Obergeschosse, welches erst später
der zuerst errichteten und danach durch den
Schmuck des Mauerbogens vor der Apsis aus-
gezeichneten unteren Kapelle hinzugefügt wurde.
Auch fehlt hier gleichwie in anderen Schloß-
kapellen Tirols ein eigener Fußboden für die
Oberkapelle, statt dessen nur eine ziemlich
breite, umlaufende und mit Brüstungen ver-
sehene Empore die
Kirchgänger hier oben
aufzunehmenhat. Ganz
so ist das auch zu sehen
in der Doppelkapelle
des Schlosses Brück
bei Lienz im Pustertale,
der Burg Reineck im
Sarntale (Mitteil. z. K.
Atz), während die da-
von gar nicht weit
entfernte Doppelkapel-
le des Bergschlosses
Stein bei Oberdrau-
burginKärnthenOber-
undUnterkapelledurch
eine Balkendecke völ-
lig geschieden und zur
Kommunikation in die-
ser letzteren Decke
eine umgitterte vier-
eckige Öffnung vorge-
kehrt hat. (Von mir
veröffentlicht im „Kir-
chenschmuck" von
1897 S. 31). Bei den
Abbildung 3.
anderen allermeisten
Doppelkapellen in Ruinen konstatiert man wohl
das einstige Vorhandensein einer die beiden
Geschosse scheidenden Balkendecke oder eines
Gewölbes (Burg Gösting bei Graz, Zeno-
burg bei Meran); doch ist man nicht mehr in
der Lage, auch die Kommunikationsöffnung,
welche beide Räume für die Anwesenden beim
Gottesdienste zusammenhielt, nachweisen zu
können. Nicht uninteressant ist es, daß gerade
in Tirol das Beispiel von Kapellen mit zwei
überliegenden Altarräumen, aber nur mit Em-
porenumgängen auch außer Burgbauten vor-
kommt, so an der sehr interessanten St. Georgs-
kapelle zuTaisten im Pustertale, die freilich
erst durch den Überbau in gotischer Zeit zur
Doppelkapelle geworden ist. (Über all diese
Tiroler Denkmale verweise ich nur auf die ge-
haltreiche „Kunstgeschichte Tirols" vom hoch-
verdienten K. K. Konservator Karl Atz, Bozen
1885.)
Unsere Kapelle im Schloß Tirol besteht zuerst
aus einem Schiffe nahe quadrater Grundfläche
(7,30 : 7,60 tn) und dem apsidialen Altarraume
von 6,35 m Weite und 5 m Tiefe. Ein starker,
3,70 m weiter Mauerbogen, an dem Skulpturen
des Gotteslammes mit den Evangelistensym-
bolen den Halbkreis umziehen, verbindet beide
Räume. Sowohl die
untere Apsis als auch
die obere und das
Schiff selbst sind durch
eine flache, Kassetten
imitierende braune
Holzdecke geschlos-
sen. Das Obergeschoß,
dessen Podium auf
allen vier Seiten durch
Holzbrüstungen (er-
neuerter Herstellung)
umzogen ist, hat einen
ganz separaten Zugang
von den überliegenden
Gemächern, denen zu-
liebe es offenbar er-
richtet wurde. Sein
Fußboden liegt 4,25 m
über dem des unteren
Raumes; die Gesamt-
höhe der Kapelle be-
trägt 8,05 m. Beide
Apsisendigungen ha-
Schlofskapelle, Tirol b. Meran. ben das pensterdrei-
licht nach dem Zuschnitte des romanischen
Stils. Das Schiff hat in jedem der zwei Ge-
schosse eigene Fensterstellung.
Nicht bloß des Baues, auch der Ausstattung
wegen ist diese Schloßkapelle bemerkenswert.
Imponierend wirkt in diesem Räume die ge-
gewaltig große Kreuzgruppe, spätestens aus der
ersten Hälfte des XV. Jahrh., drei edle Figuren
deren mittlere nicht weniger als 2,50 tri an
Höhe mißt. Beide Apsisaltäre haben Aufsätze,
ein kleines' altes Flügelaltärchen der obere mit
unbedeutenden Figuren; der Aufsatz des unteren
Altares ist ein modern gotisches Schreinerwerk
irgend einer Wiener Werkstätte und enthält in
der mittleren seiner drei Nischen eine Marien-
1907.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
16
kapellen in den Burgen scheinen vom Anfange
her als solche angelegt worden zu sein, wie
etwa die schöne zu Landsberg bei Halle; und
auch diese im Schloß Tirol war das nicht, wie
man es sieht am Absätze ihrer Umschließungs-
mauern im Obergeschosse, welches erst später
der zuerst errichteten und danach durch den
Schmuck des Mauerbogens vor der Apsis aus-
gezeichneten unteren Kapelle hinzugefügt wurde.
Auch fehlt hier gleichwie in anderen Schloß-
kapellen Tirols ein eigener Fußboden für die
Oberkapelle, statt dessen nur eine ziemlich
breite, umlaufende und mit Brüstungen ver-
sehene Empore die
Kirchgänger hier oben
aufzunehmenhat. Ganz
so ist das auch zu sehen
in der Doppelkapelle
des Schlosses Brück
bei Lienz im Pustertale,
der Burg Reineck im
Sarntale (Mitteil. z. K.
Atz), während die da-
von gar nicht weit
entfernte Doppelkapel-
le des Bergschlosses
Stein bei Oberdrau-
burginKärnthenOber-
undUnterkapelledurch
eine Balkendecke völ-
lig geschieden und zur
Kommunikation in die-
ser letzteren Decke
eine umgitterte vier-
eckige Öffnung vorge-
kehrt hat. (Von mir
veröffentlicht im „Kir-
chenschmuck" von
1897 S. 31). Bei den
Abbildung 3.
anderen allermeisten
Doppelkapellen in Ruinen konstatiert man wohl
das einstige Vorhandensein einer die beiden
Geschosse scheidenden Balkendecke oder eines
Gewölbes (Burg Gösting bei Graz, Zeno-
burg bei Meran); doch ist man nicht mehr in
der Lage, auch die Kommunikationsöffnung,
welche beide Räume für die Anwesenden beim
Gottesdienste zusammenhielt, nachweisen zu
können. Nicht uninteressant ist es, daß gerade
in Tirol das Beispiel von Kapellen mit zwei
überliegenden Altarräumen, aber nur mit Em-
porenumgängen auch außer Burgbauten vor-
kommt, so an der sehr interessanten St. Georgs-
kapelle zuTaisten im Pustertale, die freilich
erst durch den Überbau in gotischer Zeit zur
Doppelkapelle geworden ist. (Über all diese
Tiroler Denkmale verweise ich nur auf die ge-
haltreiche „Kunstgeschichte Tirols" vom hoch-
verdienten K. K. Konservator Karl Atz, Bozen
1885.)
Unsere Kapelle im Schloß Tirol besteht zuerst
aus einem Schiffe nahe quadrater Grundfläche
(7,30 : 7,60 tn) und dem apsidialen Altarraume
von 6,35 m Weite und 5 m Tiefe. Ein starker,
3,70 m weiter Mauerbogen, an dem Skulpturen
des Gotteslammes mit den Evangelistensym-
bolen den Halbkreis umziehen, verbindet beide
Räume. Sowohl die
untere Apsis als auch
die obere und das
Schiff selbst sind durch
eine flache, Kassetten
imitierende braune
Holzdecke geschlos-
sen. Das Obergeschoß,
dessen Podium auf
allen vier Seiten durch
Holzbrüstungen (er-
neuerter Herstellung)
umzogen ist, hat einen
ganz separaten Zugang
von den überliegenden
Gemächern, denen zu-
liebe es offenbar er-
richtet wurde. Sein
Fußboden liegt 4,25 m
über dem des unteren
Raumes; die Gesamt-
höhe der Kapelle be-
trägt 8,05 m. Beide
Apsisendigungen ha-
Schlofskapelle, Tirol b. Meran. ben das pensterdrei-
licht nach dem Zuschnitte des romanischen
Stils. Das Schiff hat in jedem der zwei Ge-
schosse eigene Fensterstellung.
Nicht bloß des Baues, auch der Ausstattung
wegen ist diese Schloßkapelle bemerkenswert.
Imponierend wirkt in diesem Räume die ge-
gewaltig große Kreuzgruppe, spätestens aus der
ersten Hälfte des XV. Jahrh., drei edle Figuren
deren mittlere nicht weniger als 2,50 tri an
Höhe mißt. Beide Apsisaltäre haben Aufsätze,
ein kleines' altes Flügelaltärchen der obere mit
unbedeutenden Figuren; der Aufsatz des unteren
Altares ist ein modern gotisches Schreinerwerk
irgend einer Wiener Werkstätte und enthält in
der mittleren seiner drei Nischen eine Marien-