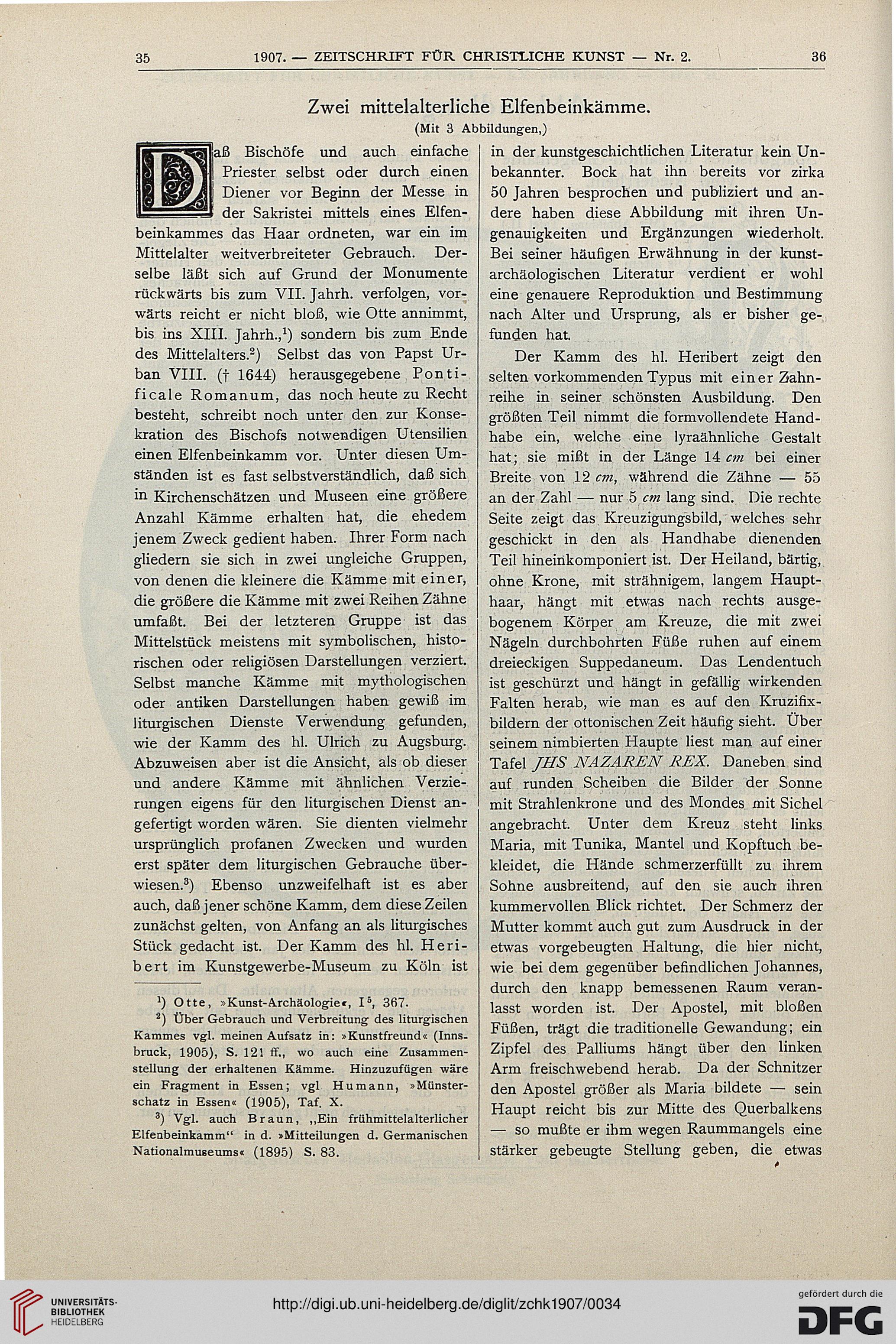35
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
36
Zwei mittelalterliche Elfenbeinkämme.
(Mit 3 Abbildungen,)
aß Bischöfe und auch einfache
Priester selbst oder durch einen
Diener vor Beginn der Messe in
der Sakristei mittels eines Elfen-
beinkammes das Haar ordneten, war ein im
Mittelalter weitverbreiteter Gebrauch. Der-
selbe läßt sich auf Grund der Monumente
rückwärts bis zum VII. Jahrh. verfolgen, vor-
wärts reicht er nicht bloß, wie Otte annimmt,
bis ins XIII. Jahrh.,1) sondern bis zum Ende
des Mittelalters.2) Selbst das von Papst Ur-
ban VIII. (f 1644) herausgegebene Ponti-
ficale Romanum, das noch heute zu Recht
besteht, schreibt noch unter den zur Konse-
kration des Bischofs notwendigen Utensilien
einen Elfenbeinkamm vor. Unter diesen Um-
ständen ist es fast selbstverständlich, daß sich
m Kirchenschätzen und Museen eine größere
Anzahl Kämme erhalten hat, die ehedem
jenem Zweck gedient haben. Ihrer Form nach
gliedern sie sich in zwei ungleiche Gruppen,
von denen die kleinere die Kämme mit einer,
die größere die Kämme mit zwei Reihen Zähne
umfaßt. Bei der letzteren Gruppe ist das
Mittelstück meistens mit symbolischen, histo-
rischen oder religiösen Darstellungen verziert.
Selbst manche Kämme mit mythologischen
oder antiken Darstellungen haben gewiß im
liturgischen Dienste Verwendung gefunden,
wie der Kamm des hl. Ulrich zu Augsburg.
Abzuweisen aber ist die Ansicht, als ob dieser
und andere Kämme mit ähnlichen Verzie-
rungen eigens für den liturgischen Dienst an-
gefertigt worden wären. Sie dienten vielmehr
ursprünglich profanen Zwecken und wurden
erst später dem liturgischen Gebrauche über-
wiesen.3) Ebenso unzweifelhaft ist es aber
auch, daß jener schöne Kamm, dem diese Zeilen
zunächst gelten, von Anfang an als liturgisches
Stück gedacht ist. Der Kamm des hl. Heri-
bert im Kunstgewerbe-Museum zu Köln ist
*) Otte, »Kunst-Archäologiec, I», 367.
2) Über Gebrauch und Verbreitung des liturgischen
Kammes vgl. meinen Aufsatz in: »Kunstfreund« (Inns-
bruck, 1905), S. 121 ff., wo auch eine Zusammen-
stellung der erhaltenen Kämme. Hinzuzufügen wäre
ein Fragment in Essen; vgl Humann, »Münster-
schatz in Essen« (1905), Taf. X.
3) Vgl. auch Braun, „Ein frühmittelalterlicher
Elfenbeinkamm" in d. »Mitteilungen d. Germanischen
Nationalmueeums« (1895) S. 83.
in der kunstgeschichtlichen Literatur kein Un-
bekannter. Bock hat ihn bereits vor zirka
50 Jahren besprochen und publiziert und an-
dere haben diese Abbildung mit ihren Un-
genauigkeiten und Ergänzungen wiederholt.
Bei seiner häufigen Erwähnung in der kunst-
archäologischen Literatur verdient er wohl
eine genauere Reproduktion und Bestimmung
nach Alter und Ursprung, als er bisher ge-
funden hat.
Der Kamm des hl. Heribert zeigt den
selten vorkommenden Typus mit einer Zahn-
reihe in seiner schönsten Ausbildung. Den
größten Teil nimmt die formvollendete Hand-
habe ein, welche eine lyraähnliche Gestalt
hat; sie mißt in der Länge 14 cm bei einer
Breite von 12 cm, während die Zähne — 55
an der Zahl — nur 5 cm lang sind. Die rechte
Seite zeigt das Kreuzigungsbild, welches sehr
geschickt in den als Handhabe dienenden
Teil hineinkomponiert ist. Der Heiland, bärtig,
ohne Krone, mit strähnigem, langem Haupt-
haar, hängt mit etwas nach rechts ausge-
bogenem Körper am Kreuze, die mit zwei
Nägeln durchbohrten Füße ruhen auf einem
dreieckigen Suppedaneum. Das Lendentuch
ist geschürzt und hängt in gefällig wirkenden
Falten herab, wie man es auf den Kruzifix-
bildern der ottonischen Zeit häufig sieht. Über
seinem nimbierten Haupte liest man auf einer
Tafel JHS NAZAREN REX. Daneben sind
auf runden Scheiben die Bilder der Sonne
mit Strahlenkrone und des Mondes mit Sichel
angebracht. Unter dem Kreuz steht links
Maria, mit Tunika, Mantel und Kopftuch be-
kleidet, die Hände schmerzerfüllt zu ihrem
Sohne ausbreitend, auf den sie auch ihren
kummervollen Blick richtet. Der Schmerz der
Mutter kommt auch gut zum Ausdruck in der
etwas vorgebeugten Haltung, die hier nicht,
wie bei dem gegenüber befindlichen Johannes,
durch den knapp bemessenen Raum veran-
lasst worden ist. Der Apostel, mit bloßen
Füßen, trägt die traditionelle Gewandung; ein
Zipfel des Palliums hängt über den linken
Arm freischwebend herab. Da der Schnitzer
den Apostel größer als Maria bildete — sein
Haupt reicht bis zur Mitte des Querbalkens
— so mußte er ihm wegen Raummangels eine
stärker gebeugte Stellung geben, die etwas
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
36
Zwei mittelalterliche Elfenbeinkämme.
(Mit 3 Abbildungen,)
aß Bischöfe und auch einfache
Priester selbst oder durch einen
Diener vor Beginn der Messe in
der Sakristei mittels eines Elfen-
beinkammes das Haar ordneten, war ein im
Mittelalter weitverbreiteter Gebrauch. Der-
selbe läßt sich auf Grund der Monumente
rückwärts bis zum VII. Jahrh. verfolgen, vor-
wärts reicht er nicht bloß, wie Otte annimmt,
bis ins XIII. Jahrh.,1) sondern bis zum Ende
des Mittelalters.2) Selbst das von Papst Ur-
ban VIII. (f 1644) herausgegebene Ponti-
ficale Romanum, das noch heute zu Recht
besteht, schreibt noch unter den zur Konse-
kration des Bischofs notwendigen Utensilien
einen Elfenbeinkamm vor. Unter diesen Um-
ständen ist es fast selbstverständlich, daß sich
m Kirchenschätzen und Museen eine größere
Anzahl Kämme erhalten hat, die ehedem
jenem Zweck gedient haben. Ihrer Form nach
gliedern sie sich in zwei ungleiche Gruppen,
von denen die kleinere die Kämme mit einer,
die größere die Kämme mit zwei Reihen Zähne
umfaßt. Bei der letzteren Gruppe ist das
Mittelstück meistens mit symbolischen, histo-
rischen oder religiösen Darstellungen verziert.
Selbst manche Kämme mit mythologischen
oder antiken Darstellungen haben gewiß im
liturgischen Dienste Verwendung gefunden,
wie der Kamm des hl. Ulrich zu Augsburg.
Abzuweisen aber ist die Ansicht, als ob dieser
und andere Kämme mit ähnlichen Verzie-
rungen eigens für den liturgischen Dienst an-
gefertigt worden wären. Sie dienten vielmehr
ursprünglich profanen Zwecken und wurden
erst später dem liturgischen Gebrauche über-
wiesen.3) Ebenso unzweifelhaft ist es aber
auch, daß jener schöne Kamm, dem diese Zeilen
zunächst gelten, von Anfang an als liturgisches
Stück gedacht ist. Der Kamm des hl. Heri-
bert im Kunstgewerbe-Museum zu Köln ist
*) Otte, »Kunst-Archäologiec, I», 367.
2) Über Gebrauch und Verbreitung des liturgischen
Kammes vgl. meinen Aufsatz in: »Kunstfreund« (Inns-
bruck, 1905), S. 121 ff., wo auch eine Zusammen-
stellung der erhaltenen Kämme. Hinzuzufügen wäre
ein Fragment in Essen; vgl Humann, »Münster-
schatz in Essen« (1905), Taf. X.
3) Vgl. auch Braun, „Ein frühmittelalterlicher
Elfenbeinkamm" in d. »Mitteilungen d. Germanischen
Nationalmueeums« (1895) S. 83.
in der kunstgeschichtlichen Literatur kein Un-
bekannter. Bock hat ihn bereits vor zirka
50 Jahren besprochen und publiziert und an-
dere haben diese Abbildung mit ihren Un-
genauigkeiten und Ergänzungen wiederholt.
Bei seiner häufigen Erwähnung in der kunst-
archäologischen Literatur verdient er wohl
eine genauere Reproduktion und Bestimmung
nach Alter und Ursprung, als er bisher ge-
funden hat.
Der Kamm des hl. Heribert zeigt den
selten vorkommenden Typus mit einer Zahn-
reihe in seiner schönsten Ausbildung. Den
größten Teil nimmt die formvollendete Hand-
habe ein, welche eine lyraähnliche Gestalt
hat; sie mißt in der Länge 14 cm bei einer
Breite von 12 cm, während die Zähne — 55
an der Zahl — nur 5 cm lang sind. Die rechte
Seite zeigt das Kreuzigungsbild, welches sehr
geschickt in den als Handhabe dienenden
Teil hineinkomponiert ist. Der Heiland, bärtig,
ohne Krone, mit strähnigem, langem Haupt-
haar, hängt mit etwas nach rechts ausge-
bogenem Körper am Kreuze, die mit zwei
Nägeln durchbohrten Füße ruhen auf einem
dreieckigen Suppedaneum. Das Lendentuch
ist geschürzt und hängt in gefällig wirkenden
Falten herab, wie man es auf den Kruzifix-
bildern der ottonischen Zeit häufig sieht. Über
seinem nimbierten Haupte liest man auf einer
Tafel JHS NAZAREN REX. Daneben sind
auf runden Scheiben die Bilder der Sonne
mit Strahlenkrone und des Mondes mit Sichel
angebracht. Unter dem Kreuz steht links
Maria, mit Tunika, Mantel und Kopftuch be-
kleidet, die Hände schmerzerfüllt zu ihrem
Sohne ausbreitend, auf den sie auch ihren
kummervollen Blick richtet. Der Schmerz der
Mutter kommt auch gut zum Ausdruck in der
etwas vorgebeugten Haltung, die hier nicht,
wie bei dem gegenüber befindlichen Johannes,
durch den knapp bemessenen Raum veran-
lasst worden ist. Der Apostel, mit bloßen
Füßen, trägt die traditionelle Gewandung; ein
Zipfel des Palliums hängt über den linken
Arm freischwebend herab. Da der Schnitzer
den Apostel größer als Maria bildete — sein
Haupt reicht bis zur Mitte des Querbalkens
— so mußte er ihm wegen Raummangels eine
stärker gebeugte Stellung geben, die etwas