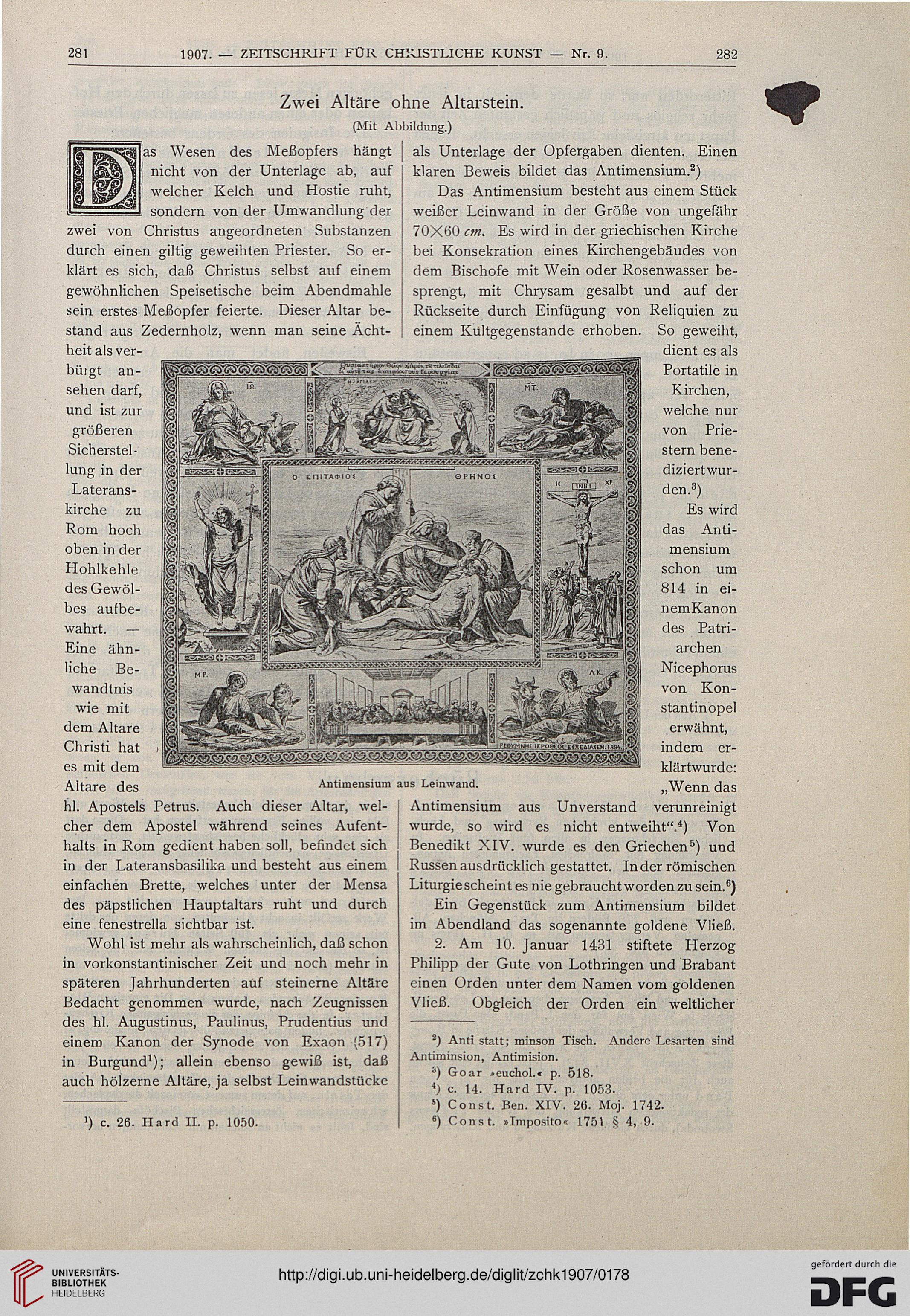281
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
282
Zwei Altäre ohne Altarstein.
(Mit Abbildung.)
mrns^&Wc&srcmt SCJEgfi
!as Wesen des Meßopfers hängt
nicht von der Unterlage ab, auf
welcher Kelch und Hostie ruht,
sondern von der Umwandlung der
zwei von Christus angeordneten Substanzen
durch einen giltig geweihten Priester. So er-
klärt es sich, daß Christus selbst auf einem
gewöhnlichen Speisetische beim Abendmahle
sein erstes Meßopfer feierte. Dieser Altar be-
stand aus Zedernholz, wenn man seine Ächt-
heit als ver-
beugt an-
sehen darf,
und ist zur
größeren
Sicherstel-
lung in der
Laterans-
kirche zu
Rom hoch
oben in der
Hohlkehle
des Gewöl-
bes aufbe-
wahrt. —
Eine ähn-
liche Be-
wandtnis
wie mit
dem Altare
Christi hat
es mit dem
Altare des
hl. Apostels Petrus. Auch dieser Altar, wel-
cher dem Apostel während seines Aufent-
halts in Rom gedient haben soll, befindet sich
in der Lateransbasilika und besteht aus einem
einfachen Brette, welches unter der Mensa
des päpstlichen Hauptaltars ruht und durch
eine fenestrella sichtbar ist.
Wohl ist mehr als wahrscheinlich, daß schon
in vorkonstantinischer Zeit und noch mehr in
späteren Jahrhunderten auf steinerne Altäre
Bedacht genommen wurde, nach Zeugnissen
des hl. Augustinus, Paulinus, Prudentius und
einem Kanon der Synode von Exaon (517)
in Burgund1); allein ebenso gewiß ist, daß
auch hölzerne Altäre, ja selbst Leinwandstücke
"^ m^^^^^^^/
Antiraensium aus Leinwand.
') c. 26. Hard II. p. 1050.
als Unterlage der Opfergaben dienten. Einen
klaren Beweis bildet das Antimensium.2)
Das Antimensium besteht aus einem Stück
weißer Leinwand in der Größe von ungefähr
70X60 cm. Es wird in der griechischen Kirche
bei Konsekration eines Kirchengebäudes von
dem Bischöfe mit Wein oder Rosenwasser be-
sprengt, mit Chrysam gesalbt und auf der
Rückseite durch Einfügung von Reliquien zu
einem Kültgegenstande erhoben. So geweiht,
dient es als
Portatile in
Kirchen,
welche nur
von Prie-
stern bene-
diziert wur-
den.3)
Es wird
das Anti-
mensium
schon um
814 in ei-
nemKanon
des Patri-
archen
Nicephorus
von Kon-
stantinopel
erwähnt,
indem er-
klärtwurde:
„Wenn das
verunreinigt
Von
Antimensium aus Unverstand
wurde, so wird es nicht entweiht".4)
Benedikt XIV. wurde es den Griechen5) und
Russen ausdrücklich gestattet. In der römischen
Liturgie scheint es nie gebraucht worden zu sein.6)
Ein Gegenstück zum Antimensium bildet
im Abendland das sogenannte goldene Vließ.
2. Am 10. Januar 1431 stiftete Herzog
Philipp der Gute von Lothringen und Brabant
einen Orden unter dem Namen vom goldenen
Vließ. Obgleich der Orden ein weltlicher
2) Anti statt; minson Tisch. Andere Lesarten sind
Antiminsion, Antimision.
5) Goar »euchol.« p. 518.
4) c. 14. Hard IV. p. 1053.
») Const. Ben. XIV. 26. Moj. 1742.
6) Const. »Imposito« 1751 § 4, 9.
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
282
Zwei Altäre ohne Altarstein.
(Mit Abbildung.)
mrns^&Wc&srcmt SCJEgfi
!as Wesen des Meßopfers hängt
nicht von der Unterlage ab, auf
welcher Kelch und Hostie ruht,
sondern von der Umwandlung der
zwei von Christus angeordneten Substanzen
durch einen giltig geweihten Priester. So er-
klärt es sich, daß Christus selbst auf einem
gewöhnlichen Speisetische beim Abendmahle
sein erstes Meßopfer feierte. Dieser Altar be-
stand aus Zedernholz, wenn man seine Ächt-
heit als ver-
beugt an-
sehen darf,
und ist zur
größeren
Sicherstel-
lung in der
Laterans-
kirche zu
Rom hoch
oben in der
Hohlkehle
des Gewöl-
bes aufbe-
wahrt. —
Eine ähn-
liche Be-
wandtnis
wie mit
dem Altare
Christi hat
es mit dem
Altare des
hl. Apostels Petrus. Auch dieser Altar, wel-
cher dem Apostel während seines Aufent-
halts in Rom gedient haben soll, befindet sich
in der Lateransbasilika und besteht aus einem
einfachen Brette, welches unter der Mensa
des päpstlichen Hauptaltars ruht und durch
eine fenestrella sichtbar ist.
Wohl ist mehr als wahrscheinlich, daß schon
in vorkonstantinischer Zeit und noch mehr in
späteren Jahrhunderten auf steinerne Altäre
Bedacht genommen wurde, nach Zeugnissen
des hl. Augustinus, Paulinus, Prudentius und
einem Kanon der Synode von Exaon (517)
in Burgund1); allein ebenso gewiß ist, daß
auch hölzerne Altäre, ja selbst Leinwandstücke
"^ m^^^^^^^/
Antiraensium aus Leinwand.
') c. 26. Hard II. p. 1050.
als Unterlage der Opfergaben dienten. Einen
klaren Beweis bildet das Antimensium.2)
Das Antimensium besteht aus einem Stück
weißer Leinwand in der Größe von ungefähr
70X60 cm. Es wird in der griechischen Kirche
bei Konsekration eines Kirchengebäudes von
dem Bischöfe mit Wein oder Rosenwasser be-
sprengt, mit Chrysam gesalbt und auf der
Rückseite durch Einfügung von Reliquien zu
einem Kültgegenstande erhoben. So geweiht,
dient es als
Portatile in
Kirchen,
welche nur
von Prie-
stern bene-
diziert wur-
den.3)
Es wird
das Anti-
mensium
schon um
814 in ei-
nemKanon
des Patri-
archen
Nicephorus
von Kon-
stantinopel
erwähnt,
indem er-
klärtwurde:
„Wenn das
verunreinigt
Von
Antimensium aus Unverstand
wurde, so wird es nicht entweiht".4)
Benedikt XIV. wurde es den Griechen5) und
Russen ausdrücklich gestattet. In der römischen
Liturgie scheint es nie gebraucht worden zu sein.6)
Ein Gegenstück zum Antimensium bildet
im Abendland das sogenannte goldene Vließ.
2. Am 10. Januar 1431 stiftete Herzog
Philipp der Gute von Lothringen und Brabant
einen Orden unter dem Namen vom goldenen
Vließ. Obgleich der Orden ein weltlicher
2) Anti statt; minson Tisch. Andere Lesarten sind
Antiminsion, Antimision.
5) Goar »euchol.« p. 518.
4) c. 14. Hard IV. p. 1053.
») Const. Ben. XIV. 26. Moj. 1742.
6) Const. »Imposito« 1751 § 4, 9.