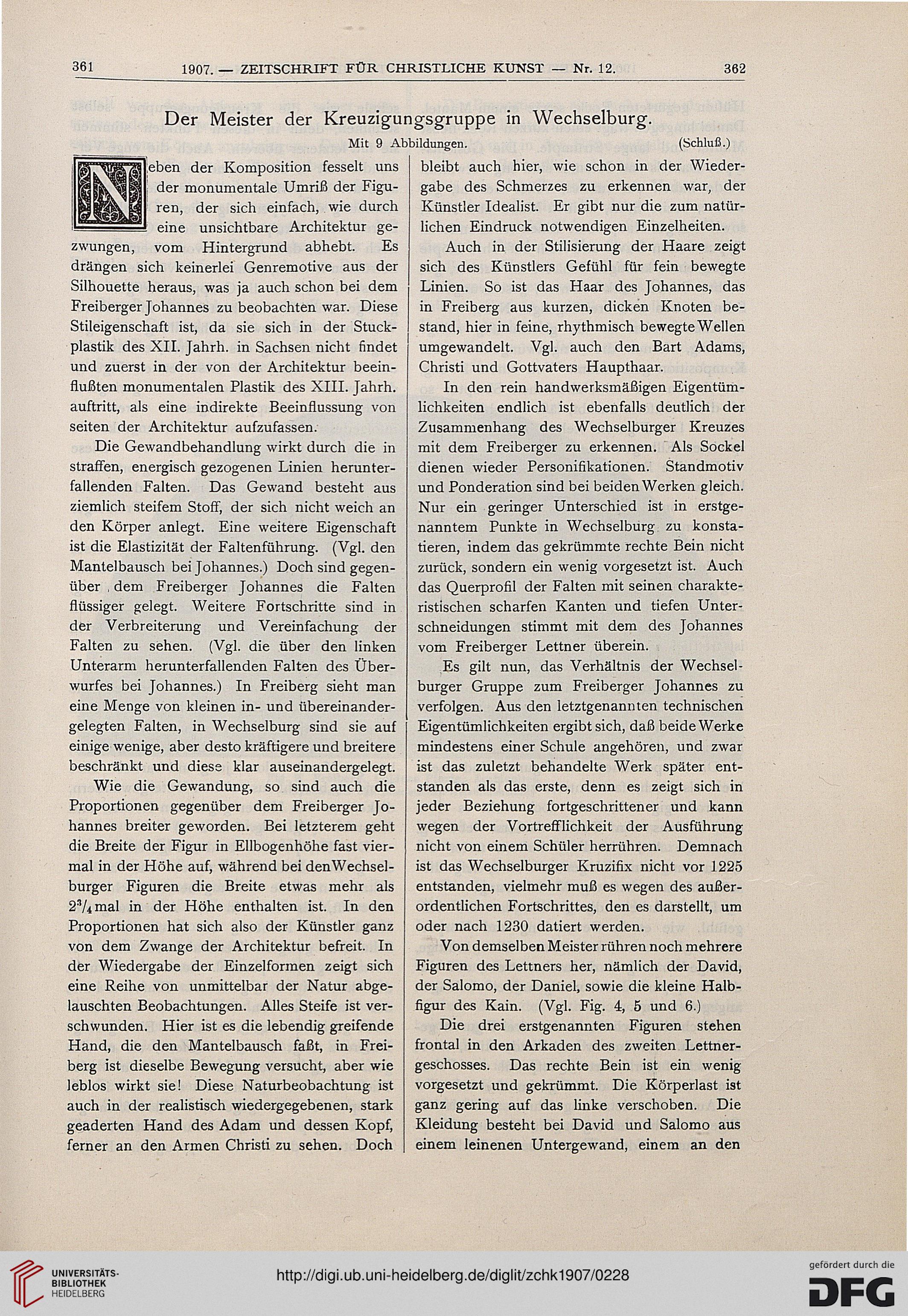361
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
362
Der Meister der Kreuzigungsgruppe in Wechselburg.
Mit 9 Abbildungen.
(Schluß.)
eben der Komposition fesselt uns
der monumentale Umriß der Figu-
ren, der sich einfach, wie durch
eine unsichtbare Architektur ge-
zwungen, vom Hintergrund abhebt. Es
drängen sich keinerlei Genremotive aus der
Silhouette heraus, was ja auch schon bei dem
Freiberger Johannes zu beobachten war. Diese
Stileigenschaft ist, da sie sich in der Stuck-
plastik des XII. Jahrh. in Sachsen nicht findet
und zuerst in der von der Architektur beein-
flußten monumentalen Plastik des XIII. Jahrh.
auftritt, als eine indirekte Beeinflussung von
Seiten der Architektur aufzufassen.
Die Gewandbehandlung wirkt durch die in
straffen, energisch gezogenen Linien herunter-
fallenden Falten. Das Gewand besteht aus
ziemlich steifem Stoff, der sich nicht weich an
den Körper anlegt. Eine weitere Eigenschaft
ist die Elastizität der Faltenführung. (Vgl. den
Mantelbausch bei Johannes.) Doch sind gegen-
über , dem Freiberger Johannes die Falten
flüssiger gelegt. Weitere Fortschritte sind in
der Verbreiterung und Vereinfachung der
Falten zu sehen. (Vgl. die über den linken
Unterarm herunterfallenden Falten des Über-
wurfes bei Johannes.) In Freiberg sieht man
eine Menge von kleinen in- und übereinander-
gelegten Falten, in Wechselburg sind sie auf
einige wenige, aber desto kräftigere und breitere
beschränkt und diese klar auseinandergelegt.
Wie die Gewandung, so sind auch die
Proportionen gegenüber dem Freiberger Jo-
hannes breiter geworden. Bei letzterem geht
die Breite der Figur in Ellbogenhöhe fast vier-
mal in der Höhe auf, während bei den Wechsel-
burger Figuren die Breite etwas mehr als
23/4mal in der Höhe enthalten ist. In den
Proportionen hat sich also der Künstler ganz
von dem Zwange der Architektur befreit. In
der Wiedergabe der Einzelformen zeigt sich
eine Reihe von unmittelbar der Natur abge-
lauschten Beobachtungen. Alles Steife ist ver-
schwunden. Hier ist es die lebendig greifende
Hand, die den Mantelbausch faßt, in Frei-
berg ist dieselbe Bewegung versucht, aber wie
leblos wirkt sie! Diese Naturbeobachtung ist
auch in der realistisch wiedergegebenen, stark
geäderten Hand des Adam und dessen Kopf,
ferner an den Armen Christi zu sehen. Doch
bleibt auch hier, wie schon in der Wieder-
gabe des Schmerzes zu erkennen war, der
Künstler Idealist. Er gibt nur die zum natür-
lichen Eindruck notwendigen Einzelheiten.
Auch in der Stilisierung der Haare zeigt
sich des Künstlers Gefühl für fein bewegte
Linien. So ist das Haar des Johannes, das
in Freiberg aus kurzen, dicken Knoten be-
stand, hier in feine, rhythmisch bewegte Wellen
umgewandelt. Vgl. auch den Bart Adams,
Christi und Gottvaters Haupthaar.
In den rein handwerksmäßigen Eigentüm-
lichkeiten endlich ist ebenfalls deutlich der
Zusammenhang des Wechselburger Kreuzes
mit dem Freiberger zu erkennen. Als Sockel
dienen wieder Personifikationen. Standmotiv
und Ponderation sind bei beiden Werken gleich.
Nur ein geringer Unterschied ist in erstge-
nanntem Punkte in Wechselburg zu konsta-
tieren, indem das gekrümmte rechte Bein nicht
zurück, sondern ein wenig vorgesetzt ist. Auch
das Querprofil der Falten mit seinen charakte-
ristischen scharfen Kanten und tiefen Unter-
schneidungen stimmt mit dem des Johannes
vom Freiberger Lettner überein.
Es gilt nun, das Verhältnis der Wechsel-
burger Gruppe zum Freiberger Johannes zu
verfolgen. Aus den letztgenannten technischen
Eigentümlichkeiten ergibt sich, daß beide Werke
mindestens einer Schule angehören, und zwar
ist das zuletzt behandelte Werk später ent-
standen als das erste, denn es zeigt sich in
jeder Beziehung fortgeschrittener und kann
wegen der Vortrefflichkeit der Ausführung
nicht von einem Schüler herrühren. Demnach
ist das Wechselburger Kruzifix nicht vor 1225
entstanden, vielmehr muß es wegen des außer-
ordentlichen Fortschrittes, den es darstellt, um
oder nach 1230 datiert werden.
Von demselben Meister rühren noch mehrere
Figuren des Lettners her, nämlich der David,
der Salomo, der Daniel, sowie die kleine Halb-
figur des Kain. (Vgl. Fig. 4, 5 und 6.)
Die drei erstgenannten Figuren stehen
frontal in den Arkaden des zweiten Lettner-
geschosses. Das rechte Bein ist ein wenig
vorgesetzt und gekrümmt. Die Körperlast ist
ganz gering auf das linke verschoben. Die
Kleidung besteht bei David und Salomo aus
einem leinenen Untergewand, einem an den
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
362
Der Meister der Kreuzigungsgruppe in Wechselburg.
Mit 9 Abbildungen.
(Schluß.)
eben der Komposition fesselt uns
der monumentale Umriß der Figu-
ren, der sich einfach, wie durch
eine unsichtbare Architektur ge-
zwungen, vom Hintergrund abhebt. Es
drängen sich keinerlei Genremotive aus der
Silhouette heraus, was ja auch schon bei dem
Freiberger Johannes zu beobachten war. Diese
Stileigenschaft ist, da sie sich in der Stuck-
plastik des XII. Jahrh. in Sachsen nicht findet
und zuerst in der von der Architektur beein-
flußten monumentalen Plastik des XIII. Jahrh.
auftritt, als eine indirekte Beeinflussung von
Seiten der Architektur aufzufassen.
Die Gewandbehandlung wirkt durch die in
straffen, energisch gezogenen Linien herunter-
fallenden Falten. Das Gewand besteht aus
ziemlich steifem Stoff, der sich nicht weich an
den Körper anlegt. Eine weitere Eigenschaft
ist die Elastizität der Faltenführung. (Vgl. den
Mantelbausch bei Johannes.) Doch sind gegen-
über , dem Freiberger Johannes die Falten
flüssiger gelegt. Weitere Fortschritte sind in
der Verbreiterung und Vereinfachung der
Falten zu sehen. (Vgl. die über den linken
Unterarm herunterfallenden Falten des Über-
wurfes bei Johannes.) In Freiberg sieht man
eine Menge von kleinen in- und übereinander-
gelegten Falten, in Wechselburg sind sie auf
einige wenige, aber desto kräftigere und breitere
beschränkt und diese klar auseinandergelegt.
Wie die Gewandung, so sind auch die
Proportionen gegenüber dem Freiberger Jo-
hannes breiter geworden. Bei letzterem geht
die Breite der Figur in Ellbogenhöhe fast vier-
mal in der Höhe auf, während bei den Wechsel-
burger Figuren die Breite etwas mehr als
23/4mal in der Höhe enthalten ist. In den
Proportionen hat sich also der Künstler ganz
von dem Zwange der Architektur befreit. In
der Wiedergabe der Einzelformen zeigt sich
eine Reihe von unmittelbar der Natur abge-
lauschten Beobachtungen. Alles Steife ist ver-
schwunden. Hier ist es die lebendig greifende
Hand, die den Mantelbausch faßt, in Frei-
berg ist dieselbe Bewegung versucht, aber wie
leblos wirkt sie! Diese Naturbeobachtung ist
auch in der realistisch wiedergegebenen, stark
geäderten Hand des Adam und dessen Kopf,
ferner an den Armen Christi zu sehen. Doch
bleibt auch hier, wie schon in der Wieder-
gabe des Schmerzes zu erkennen war, der
Künstler Idealist. Er gibt nur die zum natür-
lichen Eindruck notwendigen Einzelheiten.
Auch in der Stilisierung der Haare zeigt
sich des Künstlers Gefühl für fein bewegte
Linien. So ist das Haar des Johannes, das
in Freiberg aus kurzen, dicken Knoten be-
stand, hier in feine, rhythmisch bewegte Wellen
umgewandelt. Vgl. auch den Bart Adams,
Christi und Gottvaters Haupthaar.
In den rein handwerksmäßigen Eigentüm-
lichkeiten endlich ist ebenfalls deutlich der
Zusammenhang des Wechselburger Kreuzes
mit dem Freiberger zu erkennen. Als Sockel
dienen wieder Personifikationen. Standmotiv
und Ponderation sind bei beiden Werken gleich.
Nur ein geringer Unterschied ist in erstge-
nanntem Punkte in Wechselburg zu konsta-
tieren, indem das gekrümmte rechte Bein nicht
zurück, sondern ein wenig vorgesetzt ist. Auch
das Querprofil der Falten mit seinen charakte-
ristischen scharfen Kanten und tiefen Unter-
schneidungen stimmt mit dem des Johannes
vom Freiberger Lettner überein.
Es gilt nun, das Verhältnis der Wechsel-
burger Gruppe zum Freiberger Johannes zu
verfolgen. Aus den letztgenannten technischen
Eigentümlichkeiten ergibt sich, daß beide Werke
mindestens einer Schule angehören, und zwar
ist das zuletzt behandelte Werk später ent-
standen als das erste, denn es zeigt sich in
jeder Beziehung fortgeschrittener und kann
wegen der Vortrefflichkeit der Ausführung
nicht von einem Schüler herrühren. Demnach
ist das Wechselburger Kruzifix nicht vor 1225
entstanden, vielmehr muß es wegen des außer-
ordentlichen Fortschrittes, den es darstellt, um
oder nach 1230 datiert werden.
Von demselben Meister rühren noch mehrere
Figuren des Lettners her, nämlich der David,
der Salomo, der Daniel, sowie die kleine Halb-
figur des Kain. (Vgl. Fig. 4, 5 und 6.)
Die drei erstgenannten Figuren stehen
frontal in den Arkaden des zweiten Lettner-
geschosses. Das rechte Bein ist ein wenig
vorgesetzt und gekrümmt. Die Körperlast ist
ganz gering auf das linke verschoben. Die
Kleidung besteht bei David und Salomo aus
einem leinenen Untergewand, einem an den