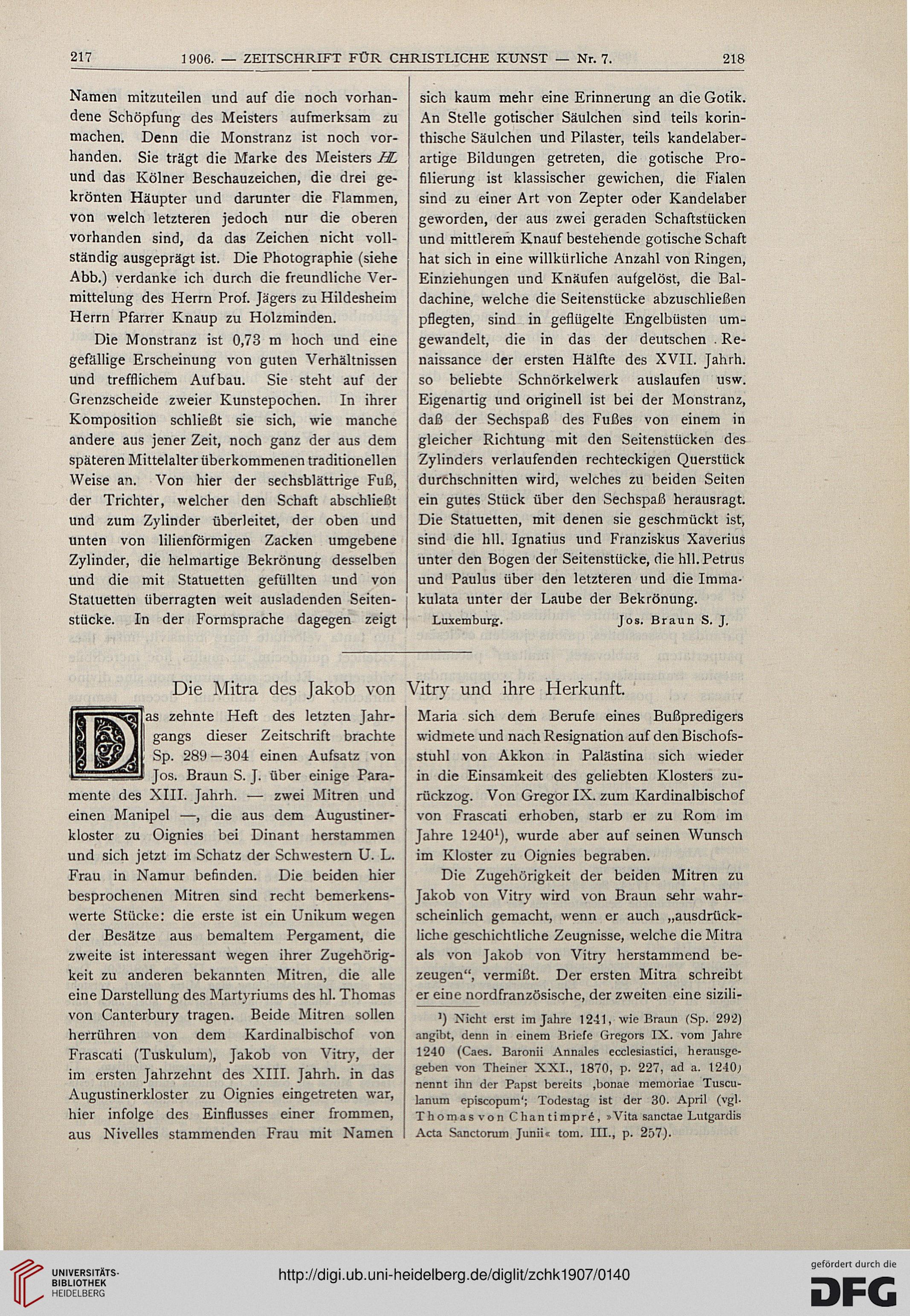217
1 906. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
218
Namen mitzuteilen und auf die noch vorhan-
dene Schöpfung des Meisters aufmerksam zu
machen. Denn die Monstranz ist noch vor-
handen. Sie trägt die Marke des Meisters HL
und das Kölner Beschauzeichen, die drei ge-
krönten Häupter und darunter die Flammen,
von welch letzteren jedoch nur die oberen
vorhanden sind, da das Zeichen nicht voll-
ständig ausgeprägt ist. Die Photographie (siehe
Abb.) verdanke ich durch die freundliche Ver-
mittelung des Herrn Prof. Jägers zu Hildesheim
Herrn Pfarrer Knaup zu Holzminden.
Die Monstranz ist 0,73 m hoch und eine
gefällige Erscheinung von guten Verhältnissen
und trefflichem Aufbau. Sie steht auf der
Grenzscheide zweier Kunstepochen. In ihrer
Komposition schließt sie sich, wie manche
andere aus jener Zeit, noch ganz der aus dem
späteren Mittelalter überkommenen traditionellen
Weise an. Von hier der sechsblättrige Fuß,
der Trichter, welcher den Schaft abschließt
und zum Zylinder überleitet, der oben und
unten von lilienförmigen Zacken umgebene
Zylinder, die helmartige Bekrönung desselben
und die mit Statuetten gefüllten und von
Statuetten überragten weit ausladenden Seiten-
stücke. In der Formsprache dagegen zeigt
sich kaum mehr eine Erinnerung an die Gotik.
An Stelle gotischer Säulchen sind teils korin-
thische Säulchen und Pilaster, teils kandelaber-
artige Bildungen getreten, die gotische Pro-
filierung ist klassischer gewichen, die Fialen
sind zu einer Art von Zepter oder Kandelaber
geworden, der aus zwei geraden Schaftstücken
und mittlerem Knauf bestehende gotische Schaft
hat sich in eine willkürliche Anzahl von Ringen,
Einziehungen und Knäufen aufgelöst, die Bal-
dachine, welche die Seitenstücke abzuschließen
pflegten, sind in geflügelte Engelbüsten um-
gewandelt, die in das der deutschen . Re-
naissance der ersten Hälfte des XVII. Jahrh.
so beliebte Schnörkelwerk auslaufen usw.
Eigenartig und originell ist bei der Monstranz,
daß der Sechspaß des Fußes von einem in
gleicher Richtung mit den Seitenstücken des
Zylinders verlaufenden rechteckigen Querstück
durchschnitten wird, welches zu beiden Seiten
ein gutes Stück über den Sechspaß herausragt.
Die Statuetten, mit denen sie geschmückt ist,
sind die hll. Ignatius und Franziskus Xaverius
unter den Bogen der Seitenstücke, die hll. Petrus
und Paulus über den letzteren und die Imma-
kulata unter der Laube der Bekrönung.
Luxemburg. Jos. Braun S. J.
Die Mitra des Jakob von
as zehnte Heft des letzten Jahr-
gangs dieser Zeitschrift brachte
Sp. 289—304 einen Aufsatz von
Jos. Braun S. J. über einige Para-
mente des XIII. Jahrh. •— zwei Mitren und
einen Manipel —, die aus dem Augustiner-
kloster zu Oignies bei Dinant herstammen
und sich jetzt im Schatz der Schwestern U. L.
Frau in Namur befinden. Die beiden hier
besprochenen Mitren sind recht bemerkens-
werte Stücke: die erste ist ein Unikum wegen
der Besätze aus bemaltem Pergament, die
zweite ist interessant wegen ihrer Zugehörig-
keit zu anderen bekannten Mitren, die alle
eine Darstellung des Martyriums des hl. Thomas
von Canterbury tragen. Beide Mitren sollen
herrühren von dem Kardinalbischof von
Frascati (Tuskulum), Jakob von Vitry, der
im ersten Jahrzehnt des XIII. Jahrh. in das
Augustinerkloster zu Oignies eingetreten war,
hier infolge des Einflusses einer frommen,
aus Nivelles stammenden Frau mit Namen
Vitry und ihre Herkunft.
Maria sich dem Berufe eines Bußpredigers
widmete und nach Resignation auf den Bischofs-
stuhl von Akkon in Palästina sich wieder
in die Einsamkeit des geliebten Klosters zu-
rückzog. Von Gregor IX. zum Kardinalbischof
von Frascati erhoben, starb er zu Rom im
Jahre 12401), wurde aber auf seinen Wunsch
im Kloster zu Oignies begraben.
Die Zugehörigkeit der beiden Mitren zu
Jakob von Vitry wird von Braun sehr wahr-
scheinlich gemacht, wenn er auch „ausdrück-
liche geschichtliche Zeugnisse, welche die Mitra
als von Jakob von Vitry herstammend be-
zeugen", vermißt. Der ersten Mitra schreibt
er eine nordfranzösische, der zweiten eine sizili-
') Nicht erst im Jahre 1241, wie Braun (Sp. 292)
angibt, denn in einem Briefe Gregors IX. vom Jahr«
1240 (Caes. Baronii Annales ecclesiastici, herausge-
geben von Theiner XXL, 1870, p. 227, ad a. 1240;
nennt ihn der Papst bereits ,bonae memoriae Tuscu-
lanum episcopum'; Todestag ist der 30. April (vgl.
Thomas von Chantimpre, »Vita sanctae Lutgardis
Acta Sanctorum Junii« tom. III., p. 257).
1 906. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
218
Namen mitzuteilen und auf die noch vorhan-
dene Schöpfung des Meisters aufmerksam zu
machen. Denn die Monstranz ist noch vor-
handen. Sie trägt die Marke des Meisters HL
und das Kölner Beschauzeichen, die drei ge-
krönten Häupter und darunter die Flammen,
von welch letzteren jedoch nur die oberen
vorhanden sind, da das Zeichen nicht voll-
ständig ausgeprägt ist. Die Photographie (siehe
Abb.) verdanke ich durch die freundliche Ver-
mittelung des Herrn Prof. Jägers zu Hildesheim
Herrn Pfarrer Knaup zu Holzminden.
Die Monstranz ist 0,73 m hoch und eine
gefällige Erscheinung von guten Verhältnissen
und trefflichem Aufbau. Sie steht auf der
Grenzscheide zweier Kunstepochen. In ihrer
Komposition schließt sie sich, wie manche
andere aus jener Zeit, noch ganz der aus dem
späteren Mittelalter überkommenen traditionellen
Weise an. Von hier der sechsblättrige Fuß,
der Trichter, welcher den Schaft abschließt
und zum Zylinder überleitet, der oben und
unten von lilienförmigen Zacken umgebene
Zylinder, die helmartige Bekrönung desselben
und die mit Statuetten gefüllten und von
Statuetten überragten weit ausladenden Seiten-
stücke. In der Formsprache dagegen zeigt
sich kaum mehr eine Erinnerung an die Gotik.
An Stelle gotischer Säulchen sind teils korin-
thische Säulchen und Pilaster, teils kandelaber-
artige Bildungen getreten, die gotische Pro-
filierung ist klassischer gewichen, die Fialen
sind zu einer Art von Zepter oder Kandelaber
geworden, der aus zwei geraden Schaftstücken
und mittlerem Knauf bestehende gotische Schaft
hat sich in eine willkürliche Anzahl von Ringen,
Einziehungen und Knäufen aufgelöst, die Bal-
dachine, welche die Seitenstücke abzuschließen
pflegten, sind in geflügelte Engelbüsten um-
gewandelt, die in das der deutschen . Re-
naissance der ersten Hälfte des XVII. Jahrh.
so beliebte Schnörkelwerk auslaufen usw.
Eigenartig und originell ist bei der Monstranz,
daß der Sechspaß des Fußes von einem in
gleicher Richtung mit den Seitenstücken des
Zylinders verlaufenden rechteckigen Querstück
durchschnitten wird, welches zu beiden Seiten
ein gutes Stück über den Sechspaß herausragt.
Die Statuetten, mit denen sie geschmückt ist,
sind die hll. Ignatius und Franziskus Xaverius
unter den Bogen der Seitenstücke, die hll. Petrus
und Paulus über den letzteren und die Imma-
kulata unter der Laube der Bekrönung.
Luxemburg. Jos. Braun S. J.
Die Mitra des Jakob von
as zehnte Heft des letzten Jahr-
gangs dieser Zeitschrift brachte
Sp. 289—304 einen Aufsatz von
Jos. Braun S. J. über einige Para-
mente des XIII. Jahrh. •— zwei Mitren und
einen Manipel —, die aus dem Augustiner-
kloster zu Oignies bei Dinant herstammen
und sich jetzt im Schatz der Schwestern U. L.
Frau in Namur befinden. Die beiden hier
besprochenen Mitren sind recht bemerkens-
werte Stücke: die erste ist ein Unikum wegen
der Besätze aus bemaltem Pergament, die
zweite ist interessant wegen ihrer Zugehörig-
keit zu anderen bekannten Mitren, die alle
eine Darstellung des Martyriums des hl. Thomas
von Canterbury tragen. Beide Mitren sollen
herrühren von dem Kardinalbischof von
Frascati (Tuskulum), Jakob von Vitry, der
im ersten Jahrzehnt des XIII. Jahrh. in das
Augustinerkloster zu Oignies eingetreten war,
hier infolge des Einflusses einer frommen,
aus Nivelles stammenden Frau mit Namen
Vitry und ihre Herkunft.
Maria sich dem Berufe eines Bußpredigers
widmete und nach Resignation auf den Bischofs-
stuhl von Akkon in Palästina sich wieder
in die Einsamkeit des geliebten Klosters zu-
rückzog. Von Gregor IX. zum Kardinalbischof
von Frascati erhoben, starb er zu Rom im
Jahre 12401), wurde aber auf seinen Wunsch
im Kloster zu Oignies begraben.
Die Zugehörigkeit der beiden Mitren zu
Jakob von Vitry wird von Braun sehr wahr-
scheinlich gemacht, wenn er auch „ausdrück-
liche geschichtliche Zeugnisse, welche die Mitra
als von Jakob von Vitry herstammend be-
zeugen", vermißt. Der ersten Mitra schreibt
er eine nordfranzösische, der zweiten eine sizili-
') Nicht erst im Jahre 1241, wie Braun (Sp. 292)
angibt, denn in einem Briefe Gregors IX. vom Jahr«
1240 (Caes. Baronii Annales ecclesiastici, herausge-
geben von Theiner XXL, 1870, p. 227, ad a. 1240;
nennt ihn der Papst bereits ,bonae memoriae Tuscu-
lanum episcopum'; Todestag ist der 30. April (vgl.
Thomas von Chantimpre, »Vita sanctae Lutgardis
Acta Sanctorum Junii« tom. III., p. 257).