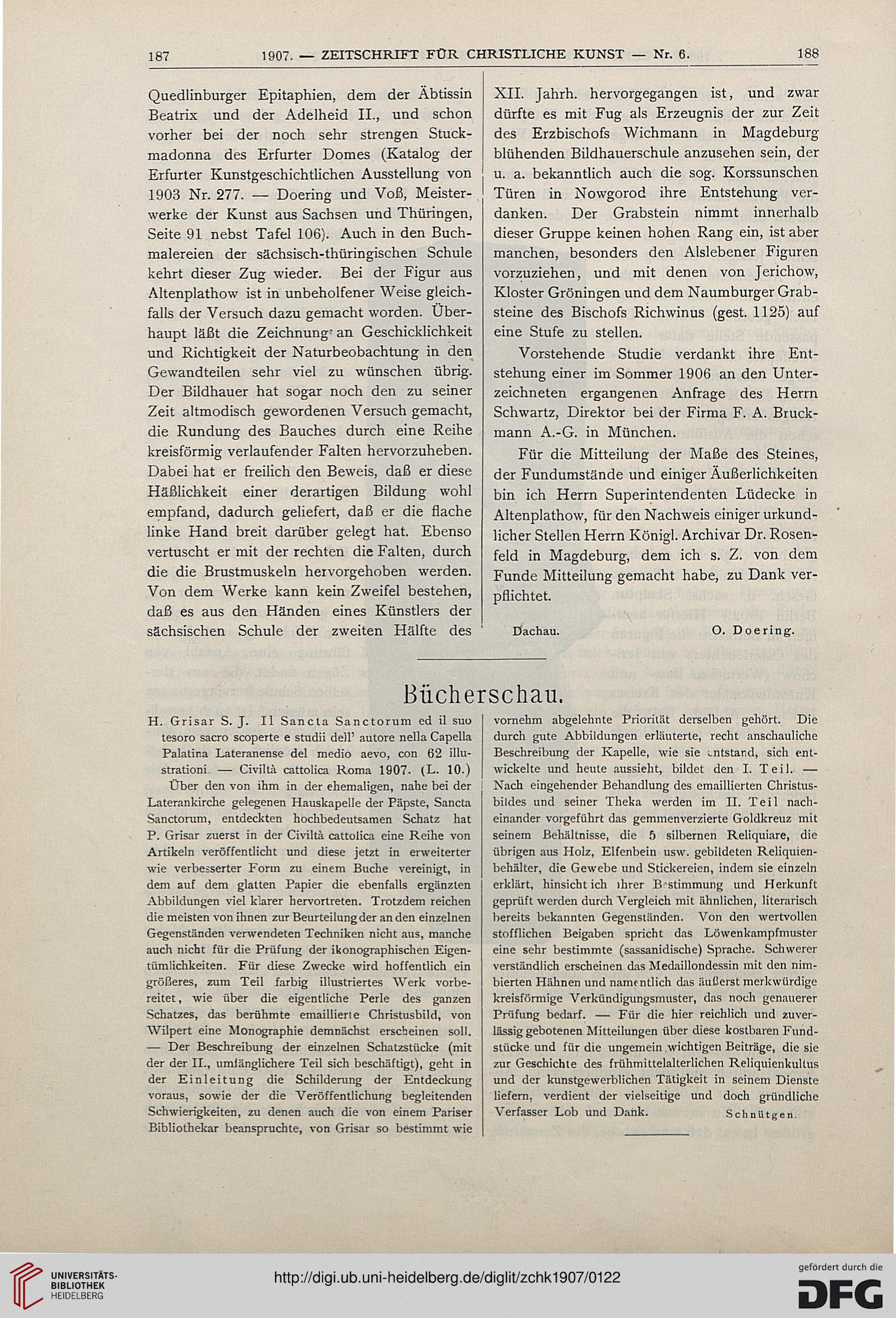187
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
188
Quedlinburger Epitaphien, dem der Äbtissin
Beatrix und der Adelheid II., und schon
vorher bei der noch sehr strengen Stuck-
madonna des Erfurter Domes (Katalog der
Erfurter Kunstgeschichtlichen Ausstellung von
1903 Nr. 277. — Doering und Voß, Meister-
werke der Kunst aus Sachsen und Thüringen,
Seite 91 nebst Tafel 106). Auch in den Buch-
malereien der sächsisch-thüringischen Schule
kehrt dieser Zug wieder. Bei der Figur aus
Altenplathow ist in unbeholfener Weise gleich-
falls der Versuch dazu gemacht worden. Über-
haupt läßt die Zeichnung-an Geschicklichkeit
und Richtigkeit der Naturbeobachtung in den
Gewandteilen sehr viel zu wünschen übrig.
Der Bildhauer hat sogar noch den zu seiner
Zeit altmodisch gewordenen Versuch gemacht,
die Rundung des Bauches durch eine Reihe
kreisförmig verlaufender Falten hervorzuheben.
Dabei hat er freilich den Beweis, daß er diese
Häßlichkeit einer derartigen Bildung wohl
empfand, dadurch geliefert, daß er die flache
linke Hand breit darüber gelegt hat. Ebenso
vertuscht er mit der rechten die Falten, durch
die die Brustmuskeln hervorgehoben werden.
Von dem Werke kann kein Zweifel bestehen,
daß es aus den Händen eines Künstlers der
sächsischen Schule der zweiten Hälfte des
XII. Jahrh. hervorgegangen ist, und zwar
dürfte es mit Fug als Erzeugnis der zur Zeit
des Erzbischofs Wichmann in Magdeburg
blühenden Bildhauerschule anzusehen sein, der
u. a. bekanntlich auch die sog. Korssunschen
Türen in Nowgorod ihre Entstehung ver-
danken. Der Grabstein nimmt innerhalb
dieser Gruppe keinen hohen Rang ein, ist aber
manchen, besonders den Alslebener Figuren
vorzuziehen, und mit denen von Jerichow,
Kloster Groningen und dem Naumburger Grab-
steine des Bischofs Richwinus (gest. 1125) auf
eine Stufe zu stellen.
Vorstehende Studie verdankt ihre Ent-
stehung einer im Sommer 1906 an den Unter-
zeichneten ergangenen Anfrage des Herrn
Schwartz, Direktor bei der Firma F. A. Bruck-
mann A.-G. in München.
Für die Mitteilung der Maße des Steines,
der Fundumstände und einiger Äußerlichkeiten
bin ich Herrn Superintendenten Lüdecke in
Altenplathow, für den Nachweis einiger urkund-
licher Stellen Herrn Königl. Archivar Dr. Rosen-
feld in Magdeburg, dem ich s. Z. von dem
Funde Mitteilung gemacht habe, zu Dank ver-
pflichtet.
Dachau.
O. Doering.
Bücherschau.
H. Grisar S. J. II Sancla Sanctorum ed ü suo
tesoro sacro scoperte e studii dell' autore nella Capella
Palatir.a Lateranense del medio aevo, con 62 illu-
strationi. — Civiltä cattolica Roma 1907. (L. 10.)
Über den von ihm in der ehemaligen, nahe bei der
Laterankirche gelegenen Hauskapelle der Päpste, Sancta
Sanctorum, entdeckten hochbedeutsamen Schatz hat
P. Grisar zuerst in der Civiltä cattolica eine Reihe von
Artikeln veröffentlicht und diese jetzt in erweiterter
wie verbesserter Form zu einem Buche vereinigt, in
dem auf dem glatten Papier die ebenfalls ergänzten
Abbildungen viel klarer hervortreten. Trotzdem reichen
die meisten von ihnen zur Beurteilung der an den einzelnen
Gegenständen verwendeten Techniken nicht aus, manche
auch nicht für die Prüfung der ikonographischen Eigen-
tümlichkeiten. Für diese Zwecke wird hoffentlich ein
größeres, zum Teil farbig illustriertes "Werk vorbe-
reitet , wie über die eigentliche Perle des ganzen
Schatzes, das berühmte emaillierte Christusbild, von
Wilpert eine Monographie demnächst erscheinen soll.
— Der Beschreibung der einzelnen Schatzstücke (mit
der der IL, umlänglichere Teil sich beschäftigt), geht in
der Einleitung die Schilderung der Entdeckung
voraus, sowie der die Veröffentlichung begleitenden
Schwierigkeiten, zu denen auch die von einem Pariser
Bibliothekar beanspruchte, von Grisar so bestimmt wie
vornehm abgelehnte Priorität derselben gehört. Die
durch gute Abbildungen erläuterte, recht anschauliche
Beschreibung der Kapelle, wie sie entstand, sich ent-
wickelte und heute aussieht, bildet den I. Teil. —
Nach eingehender Behandlung des emaillierten Christus-
bildes und seiner Theka werden im II. Teil nach-
einander vorgeführt das gemmenverzierte Goldkreuz mit
seinem Behältnisse, die fj silbernen Reliquiare, die
übrigen aus Holz, Elfenbein usw. gebildeten Reliquien-
behälter, die Gewebe und Stickereien, indem sie einzeln
erklärt, hinsieht ich ihrer Bestimmung und Herkunft
geprüft werden durch Vergleich mit ähnlichen, literarisch
bereits bekannten Gegenständen. Von den wertvollen
stofflichen Beigaben spricht das Löwenkampfmuster
eine sehr bestimmte (sassanidische) Sprache. Schwerer
verständlich erscheinen das Medaillondessin mit den nim-
bierten Hähnen und namentlich das äußerst merkwürdige
kreisförmige Verkündigungsmuster, das noch genauerer
Prüfung bedarf. — Für die hier reichlich und zuver-
lässiggebotenen Mitteilungen über diese kostbaren Fund-
stücke und für die ungemein wichtigen Beiträge, die sie
zur Geschichte des frühmittelalterlichen Reliquienkultus
und der kunstgewerblichen Tätigkeit in seinem Dienste
liefern, verdient der vielseitige und doch gründliche
Verfasser Lob und Dank. SchnUtgen.
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
188
Quedlinburger Epitaphien, dem der Äbtissin
Beatrix und der Adelheid II., und schon
vorher bei der noch sehr strengen Stuck-
madonna des Erfurter Domes (Katalog der
Erfurter Kunstgeschichtlichen Ausstellung von
1903 Nr. 277. — Doering und Voß, Meister-
werke der Kunst aus Sachsen und Thüringen,
Seite 91 nebst Tafel 106). Auch in den Buch-
malereien der sächsisch-thüringischen Schule
kehrt dieser Zug wieder. Bei der Figur aus
Altenplathow ist in unbeholfener Weise gleich-
falls der Versuch dazu gemacht worden. Über-
haupt läßt die Zeichnung-an Geschicklichkeit
und Richtigkeit der Naturbeobachtung in den
Gewandteilen sehr viel zu wünschen übrig.
Der Bildhauer hat sogar noch den zu seiner
Zeit altmodisch gewordenen Versuch gemacht,
die Rundung des Bauches durch eine Reihe
kreisförmig verlaufender Falten hervorzuheben.
Dabei hat er freilich den Beweis, daß er diese
Häßlichkeit einer derartigen Bildung wohl
empfand, dadurch geliefert, daß er die flache
linke Hand breit darüber gelegt hat. Ebenso
vertuscht er mit der rechten die Falten, durch
die die Brustmuskeln hervorgehoben werden.
Von dem Werke kann kein Zweifel bestehen,
daß es aus den Händen eines Künstlers der
sächsischen Schule der zweiten Hälfte des
XII. Jahrh. hervorgegangen ist, und zwar
dürfte es mit Fug als Erzeugnis der zur Zeit
des Erzbischofs Wichmann in Magdeburg
blühenden Bildhauerschule anzusehen sein, der
u. a. bekanntlich auch die sog. Korssunschen
Türen in Nowgorod ihre Entstehung ver-
danken. Der Grabstein nimmt innerhalb
dieser Gruppe keinen hohen Rang ein, ist aber
manchen, besonders den Alslebener Figuren
vorzuziehen, und mit denen von Jerichow,
Kloster Groningen und dem Naumburger Grab-
steine des Bischofs Richwinus (gest. 1125) auf
eine Stufe zu stellen.
Vorstehende Studie verdankt ihre Ent-
stehung einer im Sommer 1906 an den Unter-
zeichneten ergangenen Anfrage des Herrn
Schwartz, Direktor bei der Firma F. A. Bruck-
mann A.-G. in München.
Für die Mitteilung der Maße des Steines,
der Fundumstände und einiger Äußerlichkeiten
bin ich Herrn Superintendenten Lüdecke in
Altenplathow, für den Nachweis einiger urkund-
licher Stellen Herrn Königl. Archivar Dr. Rosen-
feld in Magdeburg, dem ich s. Z. von dem
Funde Mitteilung gemacht habe, zu Dank ver-
pflichtet.
Dachau.
O. Doering.
Bücherschau.
H. Grisar S. J. II Sancla Sanctorum ed ü suo
tesoro sacro scoperte e studii dell' autore nella Capella
Palatir.a Lateranense del medio aevo, con 62 illu-
strationi. — Civiltä cattolica Roma 1907. (L. 10.)
Über den von ihm in der ehemaligen, nahe bei der
Laterankirche gelegenen Hauskapelle der Päpste, Sancta
Sanctorum, entdeckten hochbedeutsamen Schatz hat
P. Grisar zuerst in der Civiltä cattolica eine Reihe von
Artikeln veröffentlicht und diese jetzt in erweiterter
wie verbesserter Form zu einem Buche vereinigt, in
dem auf dem glatten Papier die ebenfalls ergänzten
Abbildungen viel klarer hervortreten. Trotzdem reichen
die meisten von ihnen zur Beurteilung der an den einzelnen
Gegenständen verwendeten Techniken nicht aus, manche
auch nicht für die Prüfung der ikonographischen Eigen-
tümlichkeiten. Für diese Zwecke wird hoffentlich ein
größeres, zum Teil farbig illustriertes "Werk vorbe-
reitet , wie über die eigentliche Perle des ganzen
Schatzes, das berühmte emaillierte Christusbild, von
Wilpert eine Monographie demnächst erscheinen soll.
— Der Beschreibung der einzelnen Schatzstücke (mit
der der IL, umlänglichere Teil sich beschäftigt), geht in
der Einleitung die Schilderung der Entdeckung
voraus, sowie der die Veröffentlichung begleitenden
Schwierigkeiten, zu denen auch die von einem Pariser
Bibliothekar beanspruchte, von Grisar so bestimmt wie
vornehm abgelehnte Priorität derselben gehört. Die
durch gute Abbildungen erläuterte, recht anschauliche
Beschreibung der Kapelle, wie sie entstand, sich ent-
wickelte und heute aussieht, bildet den I. Teil. —
Nach eingehender Behandlung des emaillierten Christus-
bildes und seiner Theka werden im II. Teil nach-
einander vorgeführt das gemmenverzierte Goldkreuz mit
seinem Behältnisse, die fj silbernen Reliquiare, die
übrigen aus Holz, Elfenbein usw. gebildeten Reliquien-
behälter, die Gewebe und Stickereien, indem sie einzeln
erklärt, hinsieht ich ihrer Bestimmung und Herkunft
geprüft werden durch Vergleich mit ähnlichen, literarisch
bereits bekannten Gegenständen. Von den wertvollen
stofflichen Beigaben spricht das Löwenkampfmuster
eine sehr bestimmte (sassanidische) Sprache. Schwerer
verständlich erscheinen das Medaillondessin mit den nim-
bierten Hähnen und namentlich das äußerst merkwürdige
kreisförmige Verkündigungsmuster, das noch genauerer
Prüfung bedarf. — Für die hier reichlich und zuver-
lässiggebotenen Mitteilungen über diese kostbaren Fund-
stücke und für die ungemein wichtigen Beiträge, die sie
zur Geschichte des frühmittelalterlichen Reliquienkultus
und der kunstgewerblichen Tätigkeit in seinem Dienste
liefern, verdient der vielseitige und doch gründliche
Verfasser Lob und Dank. SchnUtgen.