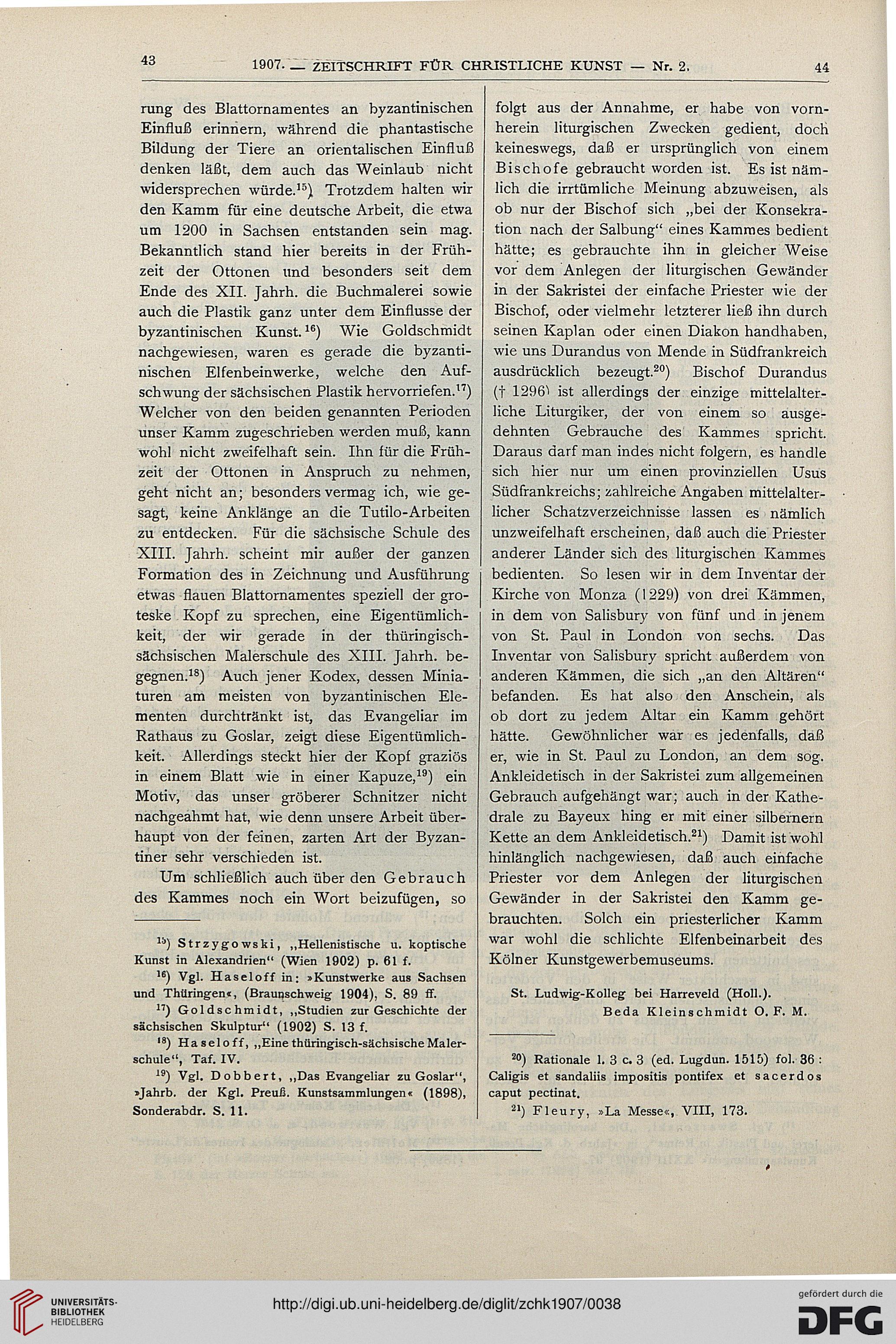43
1907. '__ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2,
44
rung des Blattornamentes an byzantinischen
Einfluß erinnern, während die phantastische
Bildung der Tiere an orientalischen Einfluß
denken läßt, dem auch das Weinlaub nicht
widersprechen würde.15) Trotzdem halten wir
den Kamm für eine deutsche Arbeit, die etwa
um 1200 in Sachsen entstanden sein mag.
Bekanntlich stand hier bereits in der Früh-
zeit der Ottonen und besonders seit dem
Ende des XII. Jahrh. die Buchmalerei sowie
auch die Plastik ganz unter dem Einflüsse der
byzantinischen Kunst.16) Wie Goldschmidt
nachgewiesen, waren es gerade die byzanti-
nischen Elfenbeinwerke, welche den Auf-
schwung der sächsischen Plastik hervorriefen.'7)
Welcher von den beiden genannten Perioden
unser Kamm zugeschrieben werden muß, kann
wohl nicht zweifelhaft sein. Ihn für die Früh-
zeit der Ottonen in Anspruch zu nehmen,
geht nicht an; besonders vermag ich, wie ge-
sagt, keine Anklänge an die Tutilo-Arbeiten
zu entdecken. Für die sächsische Schule des
XIII. Jahrh. scheint mir außer der ganzen
Formation des in Zeichnung und Ausführung
etwas flauen Blattornamentes speziell der gro-
teske Kopf zu sprechen, eine Eigentümlich-
keit, der wir gerade in der thüringisch-
sächsischen Malerschule des XIII. Jahrh. be-
gegnen.18) Auch jener Kodex, dessen Minia-
turen am meisten von byzantinischen Ele-
menten durchtränkt ist, das Evangeliar im
Rathaus zu Goslar, zeigt diese Eigentümlich-
keit. Allerdings steckt hier der Kopf graziös
in einem Blatt wie in einer Kapuze,19) ein
Motiv, das unser gröberer Schnitzer nicht
nachgeahmt hat, wie denn unsere Arbeit über-
haupt von der feinen, zarten Art der Byzan-
tiner sehr verschieden ist.
Um schließlich auch über den Gebrauch
des Kammes noch ein Wort beizufügen, so
u) Strzygowski, „Hellenistische u. koptische
Kunst in Alexandrien" (Wien 1902) p. 61 f.
16) Vgl. Haseloff in; »Kunstwerke aus Sachsen
und Thüringen«, (Braunschweig 1904), S. 89 ff.
n) Goldschmidt, „Studien zur Geschichte der
sächsischen Skulptur" (1902) S. 13 f.
18) Haseloff, „Eine thüringisch-sächsische Maler-
schule", Taf. IV.
19) Vgl. Dobbert, „Das Evangeliar zu Goslar",
»Jahrb. der Kgl. Preuß. Kunstsammlungen« (1898),
Sonderabdr. S. 11.
folgt aus der Annahme, er habe von vorn-
herein liturgischen Zwecken gedient, doch
keineswegs, daß er ursprünglich von einem
Bischöfe gebraucht worden ist. Es ist näm-
lich die irrtümliche Meinung abzuweisen, als
ob nur der Bischof sich „bei der Konsekra-
tion nach der Salbung" eines Kammes bedient
hätte; es gebrauchte ihn in gleicher Weise
vor dem Anlegen der liturgischen Gewänder
in der Sakristei der einfache Priester wie der
Bischof, oder vielmehr letzterer ließ ihn durch
seinen Kaplan oder einen Diakon handhaben,
wie uns Durandus von Mende in Südfrankreich
ausdrücklich bezeugt.20) Bischof Durandus
(t 1296^ ist allerdings der einzige mittelalter-
liche Liturgiker, der von einem so ausger
dehnten Gebrauche des Kammes spricht.
Daraus darf man indes nicht folgern, es handle
sich hier nur um einen provinziellen Usus
Südfrankreichs; zahlreiche Angaben mittelalter-
licher Schatzverzeichnisse lassen es nämlich
unzweifelhaft erscheinen, daß auch die Priester
anderer Länder sich des liturgischen Kammes
bedienten. So lesen wir in dem Inventar der
Kirche von Monza (1229) von drei Kämmen,
in dem von Salisbury von fünf und in jenem
von St. Paul in London von sechs. Das
Inventar von Salisbury spricht außerdem von
anderen Kämmen, die sich „an den Altären"
befanden. Es hat also den Anschein, als
ob dort zu jedem Altar ein Kamm gehört
hätte. Gewöhnlicher war es jedenfalls, daß
er, wie in St. Paul zu London, an dem sog.
Ankleidetisch in der Sakristei zum allgemeinen
Gebrauch aufgehängt war; auch in der Kathe-
drale zu Bayeux hing er mit einer silbernern
Kette an dem Ankleidetisch.21) Damit ist wohl
hinlänglich nachgewiesen, daß auch einfache
Priester vor dem Anlegen der liturgischen
Gewänder in der Sakristei den Kamm ge-
brauchten. Solch ein priesterlicher Kamm
war wohl die schlichte Elfenbeinarbeit des
Kölner Kunstgewerbemuseums.
St. Ludwig-Kolleg bei Harreveld (Holl.).
Beda Kleinschmidt O. F. M.
2<>) Rationale 1. 3 c. 3 (ed. Lugdun. 1515) fol. 36 :
Caligis et sandaliis impositis pontifex et sacerdos
caput pectinat.
21) Fleury, »La Messe«, VIII, 173.
1907. '__ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2,
44
rung des Blattornamentes an byzantinischen
Einfluß erinnern, während die phantastische
Bildung der Tiere an orientalischen Einfluß
denken läßt, dem auch das Weinlaub nicht
widersprechen würde.15) Trotzdem halten wir
den Kamm für eine deutsche Arbeit, die etwa
um 1200 in Sachsen entstanden sein mag.
Bekanntlich stand hier bereits in der Früh-
zeit der Ottonen und besonders seit dem
Ende des XII. Jahrh. die Buchmalerei sowie
auch die Plastik ganz unter dem Einflüsse der
byzantinischen Kunst.16) Wie Goldschmidt
nachgewiesen, waren es gerade die byzanti-
nischen Elfenbeinwerke, welche den Auf-
schwung der sächsischen Plastik hervorriefen.'7)
Welcher von den beiden genannten Perioden
unser Kamm zugeschrieben werden muß, kann
wohl nicht zweifelhaft sein. Ihn für die Früh-
zeit der Ottonen in Anspruch zu nehmen,
geht nicht an; besonders vermag ich, wie ge-
sagt, keine Anklänge an die Tutilo-Arbeiten
zu entdecken. Für die sächsische Schule des
XIII. Jahrh. scheint mir außer der ganzen
Formation des in Zeichnung und Ausführung
etwas flauen Blattornamentes speziell der gro-
teske Kopf zu sprechen, eine Eigentümlich-
keit, der wir gerade in der thüringisch-
sächsischen Malerschule des XIII. Jahrh. be-
gegnen.18) Auch jener Kodex, dessen Minia-
turen am meisten von byzantinischen Ele-
menten durchtränkt ist, das Evangeliar im
Rathaus zu Goslar, zeigt diese Eigentümlich-
keit. Allerdings steckt hier der Kopf graziös
in einem Blatt wie in einer Kapuze,19) ein
Motiv, das unser gröberer Schnitzer nicht
nachgeahmt hat, wie denn unsere Arbeit über-
haupt von der feinen, zarten Art der Byzan-
tiner sehr verschieden ist.
Um schließlich auch über den Gebrauch
des Kammes noch ein Wort beizufügen, so
u) Strzygowski, „Hellenistische u. koptische
Kunst in Alexandrien" (Wien 1902) p. 61 f.
16) Vgl. Haseloff in; »Kunstwerke aus Sachsen
und Thüringen«, (Braunschweig 1904), S. 89 ff.
n) Goldschmidt, „Studien zur Geschichte der
sächsischen Skulptur" (1902) S. 13 f.
18) Haseloff, „Eine thüringisch-sächsische Maler-
schule", Taf. IV.
19) Vgl. Dobbert, „Das Evangeliar zu Goslar",
»Jahrb. der Kgl. Preuß. Kunstsammlungen« (1898),
Sonderabdr. S. 11.
folgt aus der Annahme, er habe von vorn-
herein liturgischen Zwecken gedient, doch
keineswegs, daß er ursprünglich von einem
Bischöfe gebraucht worden ist. Es ist näm-
lich die irrtümliche Meinung abzuweisen, als
ob nur der Bischof sich „bei der Konsekra-
tion nach der Salbung" eines Kammes bedient
hätte; es gebrauchte ihn in gleicher Weise
vor dem Anlegen der liturgischen Gewänder
in der Sakristei der einfache Priester wie der
Bischof, oder vielmehr letzterer ließ ihn durch
seinen Kaplan oder einen Diakon handhaben,
wie uns Durandus von Mende in Südfrankreich
ausdrücklich bezeugt.20) Bischof Durandus
(t 1296^ ist allerdings der einzige mittelalter-
liche Liturgiker, der von einem so ausger
dehnten Gebrauche des Kammes spricht.
Daraus darf man indes nicht folgern, es handle
sich hier nur um einen provinziellen Usus
Südfrankreichs; zahlreiche Angaben mittelalter-
licher Schatzverzeichnisse lassen es nämlich
unzweifelhaft erscheinen, daß auch die Priester
anderer Länder sich des liturgischen Kammes
bedienten. So lesen wir in dem Inventar der
Kirche von Monza (1229) von drei Kämmen,
in dem von Salisbury von fünf und in jenem
von St. Paul in London von sechs. Das
Inventar von Salisbury spricht außerdem von
anderen Kämmen, die sich „an den Altären"
befanden. Es hat also den Anschein, als
ob dort zu jedem Altar ein Kamm gehört
hätte. Gewöhnlicher war es jedenfalls, daß
er, wie in St. Paul zu London, an dem sog.
Ankleidetisch in der Sakristei zum allgemeinen
Gebrauch aufgehängt war; auch in der Kathe-
drale zu Bayeux hing er mit einer silbernern
Kette an dem Ankleidetisch.21) Damit ist wohl
hinlänglich nachgewiesen, daß auch einfache
Priester vor dem Anlegen der liturgischen
Gewänder in der Sakristei den Kamm ge-
brauchten. Solch ein priesterlicher Kamm
war wohl die schlichte Elfenbeinarbeit des
Kölner Kunstgewerbemuseums.
St. Ludwig-Kolleg bei Harreveld (Holl.).
Beda Kleinschmidt O. F. M.
2<>) Rationale 1. 3 c. 3 (ed. Lugdun. 1515) fol. 36 :
Caligis et sandaliis impositis pontifex et sacerdos
caput pectinat.
21) Fleury, »La Messe«, VIII, 173.