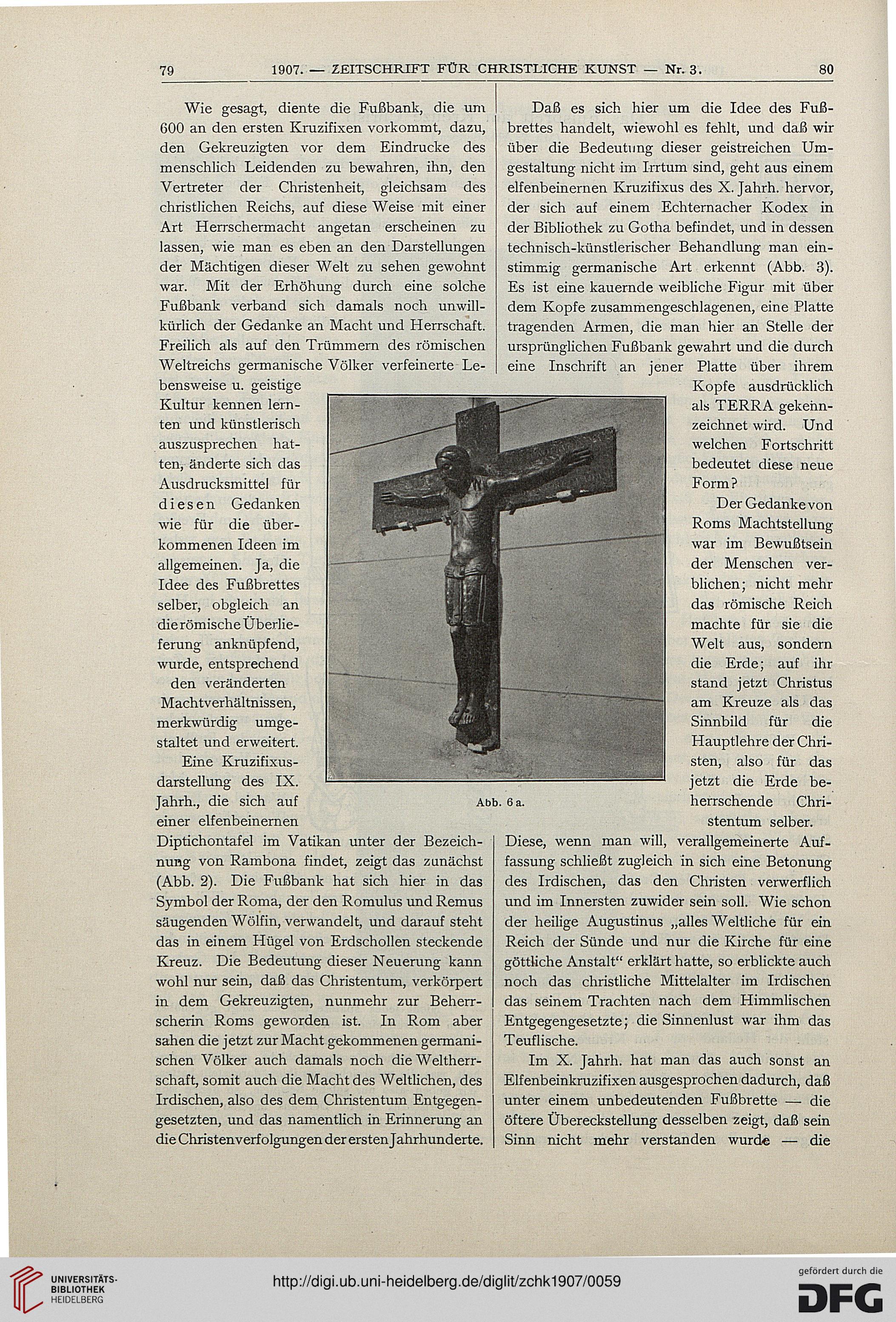79
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
80
Wie gesagt, diente die Fußbank, die um
600 an den ersten Kruzifixen vorkommt, dazu,
den Gekreuzigten vor dem Eindrucke des
menschlich Leidenden zu bewahren, ihn, den
Vertreter der Christenheit, gleichsam des
christlichen Reichs, auf diese Weise mit einer
Art Herrschermacht angetan erscheinen zu
lassen, wie man es eben an den Darstellungen
der Mächtigen dieser Welt zu sehen gewohnt
war. Mit der Erhöhung durch eine solche
Fußbank verband sich damals noch unwill-
kürlich der Gedanke an Macht und Herrschaft.
Freilich als auf den Trümmern des römischen
Weltreichs germanische Völker verfeinerte Le-
bensweise u. geistige
Kultur kennen lern-
ten und künstlerisch
auszusprechen hat-
ten, änderte sich das
Ausdrucksmittel für
diesen Gedanken
wie für die über-
kommenen Ideen im
allgemeinen. Ja, die
Idee des Fußbrettes
selber, obgleich an
die römische Überlie-
ferung anknüpfend,
wurde, entsprechend
den veränderten
Machtverhältnissen,
merkwürdig umge-
staltet und erweitert.
Eine Kruzifixus-
darstellung des IX.
Jahrh., die sich auf
einer elfenbeinernen
Diptichontafel im Vatikan unter der Bezeich-
nung von Rambona findet, zeigt das zunächst
(Abb. 2). Die Fußbank hat sich hier in das
Symbol der Roma, der den Romulus und Remus
säugenden Wölfin, verwandelt, und darauf steht
das in einem Hügel von Erdschollen steckende
Kreuz. Die Bedeutung dieser Neuerung kann
wohl nur sein, daß das Christentum, verkörpert
in dem Gekreuzigten, nunmehr zur Beherr-
scherin Roms geworden ist. In Rom aber
sahen die jetzt zur Macht gekommenen germani-
schen Völker auch damals noch die Weltherr-
schaft, somit auch die Macht des Weltlichen, des
Irdischen, also des dem Christentum Entgegen-
gesetzten, und das namentlich in Erinnerung an
die Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte.
Daß es sich hier um die Idee des Fuß-
brettes handelt, wiewohl es fehlt, und daß wir
über die Bedeutung dieser geistreichen Um-
gestaltung nicht im Irrtum sind, geht aus einem
elfenbeinernen Kruzifixus des X. Jahrh. hervor,
der sich auf einem Echternacher Kodex in
der Bibliothek zu Gotha befindet, und in dessen
technisch-künstlerischer Behandlung man ein-
stimmig germanische Art erkennt (Abb. 3).
Es ist eine kauernde weibliche Figur mit über
dem Kopfe zusammengeschlagenen, eine Platte
tragenden Armen, die man hier an Stelle der
ursprünglichen Fußbank gewahrt und die durch
eine Inschrift an jener Platte über ihrem
Kopfe ausdrücklich
als TERRA gekenn-
zeichnet wird. Und
welchen Fortschritt
bedeutet diese neue
Form?
Der Gedanke von
Roms Machtstellung
war im Bewußtsein
der Menschen ver-
blichen; nicht mehr
das römische Reich
machte für sie die
Welt aus, sondern
die Erde; auf ihr
stand jetzt Christus
am Kreuze als das
Sinnbild für die
Hauptlehre der Chri-
sten, also für das
jetzt die Erde be-
Abb. 6 a. herrschende Chri-
stentum selber.
Diese, wenn man will, verallgemeinerte Auf-
fassung schließt zugleich in sich eine Betonung
des Irdischen, das den Christen verwerflich
und im Innersten zuwider sein soll. Wie schon
der heilige Augustinus „alles Weltliche für ein
Reich der Sünde und nur die Kirche für eine
göttliche Anstalt" erklärt hatte, so erblickte auch
noch das christliche Mittelalter im Irdischen
das seinem Trachten nach dem Himmlischen
Entgegengesetzte; die Sinnenlust war ihm das
Teuflische.
Im X. Jahrh. hat man das auch sonst an
Elfenbeinkruzifixen ausgesprochen dadurch, daß
unter einem unbedeutenden Fußbrette — die
öftere Übereckstellung desselben zeigt, daß sein
Sinn nicht mehr verstanden wurde — die
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
80
Wie gesagt, diente die Fußbank, die um
600 an den ersten Kruzifixen vorkommt, dazu,
den Gekreuzigten vor dem Eindrucke des
menschlich Leidenden zu bewahren, ihn, den
Vertreter der Christenheit, gleichsam des
christlichen Reichs, auf diese Weise mit einer
Art Herrschermacht angetan erscheinen zu
lassen, wie man es eben an den Darstellungen
der Mächtigen dieser Welt zu sehen gewohnt
war. Mit der Erhöhung durch eine solche
Fußbank verband sich damals noch unwill-
kürlich der Gedanke an Macht und Herrschaft.
Freilich als auf den Trümmern des römischen
Weltreichs germanische Völker verfeinerte Le-
bensweise u. geistige
Kultur kennen lern-
ten und künstlerisch
auszusprechen hat-
ten, änderte sich das
Ausdrucksmittel für
diesen Gedanken
wie für die über-
kommenen Ideen im
allgemeinen. Ja, die
Idee des Fußbrettes
selber, obgleich an
die römische Überlie-
ferung anknüpfend,
wurde, entsprechend
den veränderten
Machtverhältnissen,
merkwürdig umge-
staltet und erweitert.
Eine Kruzifixus-
darstellung des IX.
Jahrh., die sich auf
einer elfenbeinernen
Diptichontafel im Vatikan unter der Bezeich-
nung von Rambona findet, zeigt das zunächst
(Abb. 2). Die Fußbank hat sich hier in das
Symbol der Roma, der den Romulus und Remus
säugenden Wölfin, verwandelt, und darauf steht
das in einem Hügel von Erdschollen steckende
Kreuz. Die Bedeutung dieser Neuerung kann
wohl nur sein, daß das Christentum, verkörpert
in dem Gekreuzigten, nunmehr zur Beherr-
scherin Roms geworden ist. In Rom aber
sahen die jetzt zur Macht gekommenen germani-
schen Völker auch damals noch die Weltherr-
schaft, somit auch die Macht des Weltlichen, des
Irdischen, also des dem Christentum Entgegen-
gesetzten, und das namentlich in Erinnerung an
die Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte.
Daß es sich hier um die Idee des Fuß-
brettes handelt, wiewohl es fehlt, und daß wir
über die Bedeutung dieser geistreichen Um-
gestaltung nicht im Irrtum sind, geht aus einem
elfenbeinernen Kruzifixus des X. Jahrh. hervor,
der sich auf einem Echternacher Kodex in
der Bibliothek zu Gotha befindet, und in dessen
technisch-künstlerischer Behandlung man ein-
stimmig germanische Art erkennt (Abb. 3).
Es ist eine kauernde weibliche Figur mit über
dem Kopfe zusammengeschlagenen, eine Platte
tragenden Armen, die man hier an Stelle der
ursprünglichen Fußbank gewahrt und die durch
eine Inschrift an jener Platte über ihrem
Kopfe ausdrücklich
als TERRA gekenn-
zeichnet wird. Und
welchen Fortschritt
bedeutet diese neue
Form?
Der Gedanke von
Roms Machtstellung
war im Bewußtsein
der Menschen ver-
blichen; nicht mehr
das römische Reich
machte für sie die
Welt aus, sondern
die Erde; auf ihr
stand jetzt Christus
am Kreuze als das
Sinnbild für die
Hauptlehre der Chri-
sten, also für das
jetzt die Erde be-
Abb. 6 a. herrschende Chri-
stentum selber.
Diese, wenn man will, verallgemeinerte Auf-
fassung schließt zugleich in sich eine Betonung
des Irdischen, das den Christen verwerflich
und im Innersten zuwider sein soll. Wie schon
der heilige Augustinus „alles Weltliche für ein
Reich der Sünde und nur die Kirche für eine
göttliche Anstalt" erklärt hatte, so erblickte auch
noch das christliche Mittelalter im Irdischen
das seinem Trachten nach dem Himmlischen
Entgegengesetzte; die Sinnenlust war ihm das
Teuflische.
Im X. Jahrh. hat man das auch sonst an
Elfenbeinkruzifixen ausgesprochen dadurch, daß
unter einem unbedeutenden Fußbrette — die
öftere Übereckstellung desselben zeigt, daß sein
Sinn nicht mehr verstanden wurde — die