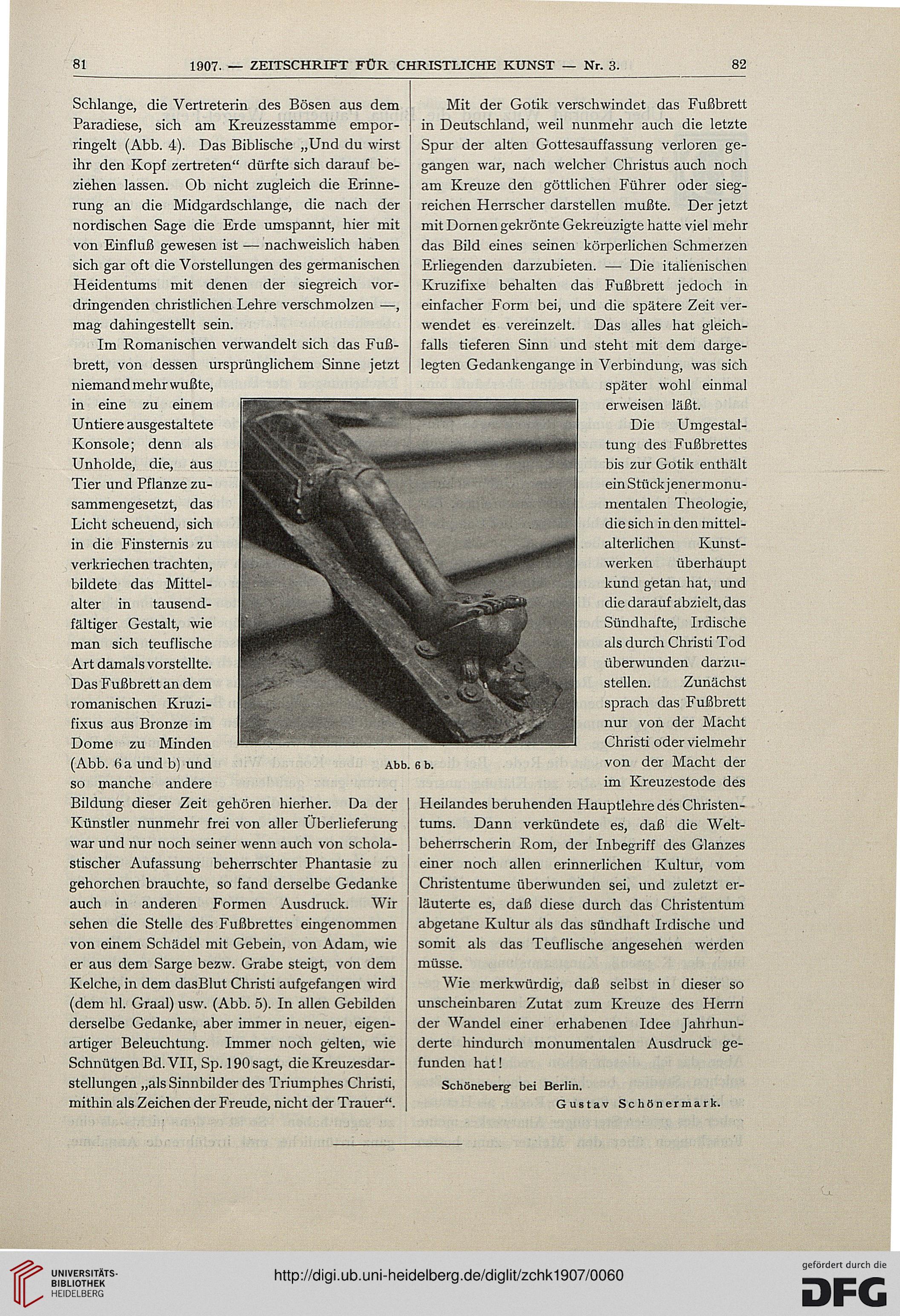81
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
Schlange, die Vertreterin des Bösen aus dem
Paradiese, sich am Kreuzesstamme empor-
ringelt (Abb. 4). Das Biblische „Und du wirst
ihr den Kopf zertreten" dürfte sich darauf be-
ziehen lassen. Ob nicht zugleich die Erinne-
rung an die Midgardschlange, die nach der
nordischen Sage die Erde umspannt, hier mit
von Einfluß gewesen ist ■— nachweislich haben
sich gar oft die Vorstellungen des germanischen
Heidentums mit denen der siegreich vor-
dringenden christlichen Lehre verschmolzen —,
mag dahingestellt sein.
Im Romanischen verwandelt sich das Fuß-
brett, von dessen ursprünglichem Sinne jetzt
niemand mehr wußte,
in eine zu einem
Untiere ausgestaltete
Konsole; denn als
Unholde, die, aus
Tier und Pflanze zu-
sammengesetzt, das
Licht scheuend, sich
in die Finsternis zu
verkriechen trachten,
bildete das Mittel-
alter in tausend-
fältiger Gestalt, wie
man sich teuflische
Art damals vorstellte.
Das Fußbrett an dem
romanischen Kruzi-
fixus aus Bronze im
Dome zu Minden
(Abb. 6 a und b) und Abb.
so manche andere
Bildung dieser Zeit gehören hierher. Da der
Künstler nunmehr frei von aller Überlieferung
war und nur noch seiner wenn auch von schola-
stischer Aufassung beherrschter Phantasie zu
gehorchen brauchte, so fand derselbe Gedanke
auch in anderen Formen Ausdruck. Wir
sehen die Stelle des Fußbrettes eingenommen
von einem Schädel mit Gebein, von Adam, wie
er aus dem Sarge bezw. Grabe steigt, von dem
Kelche, in dem dasBlut Christi aufgefangen wird
(dem hl. Graal) usw. (Abb. 5). In allen Gebilden
derselbe Gedanke, aber immer in neuer, eigen-
artiger Beleuchtung. Immer noch gelten, wie
SchnütgenBd.VII, Sp. 190 sagt, die Kreuzesdar-
stellungen „als Sinnbilder des Triumphes Christi,
mithin als Zeichen der Freude, nicht der Trauer".
Mit der Gotik verschwindet das Fußbrett
in Deutschland, weil nunmehr auch die letzte
Spur der alten Gottesauffassung verloren ge-
gangen war, nach welcher Christus auch noch
am Kreuze den göttlichen Führer oder sieg-
reichen Herrscher darstellen mußte. Der jetzt
mit Dornen gekrönte Gekreuzigte hatte viel mehr
das Bild eines seinen körperlichen Schmerzen
Erliegenden darzubieten. — Die italienischen
Kruzifixe behalten das Fußbrett jedoch in
einfacher Form bei, und die spätere Zeit ver-
wendet es vereinzelt. Das alles hat gleich-
falls tieferen Sinn und steht mit dem darge-
legten Gedankengange in Verbindung, was sich
später wohl einmal
erweisen läßt.
Die Umgestal-
tung des Fußbrettes
bis zur Gotik enthält
ein Stückjenermonu-
mentalen Theologie,
die sich in den mittel-
alterlichen Kunst-
werken überhaupt
kund getan hat, und
die darauf abzielt, das
Sündhafte, Irdische
als durch Christi Tod
überwunden darzu-
stellen. Zunächst
sprach das Fußbrett
nur von der Macht
Christi oder vielmehr
6 b. von der Macht der
im Kreuzestode des
Heilandes beruhenden Hauptlehre des Christen-
tums. Dann verkündete es, daß die Welt-
beherrscherin Rom, der Inbegriff des Glanzes
einer noch allen erinnerlichen Kultur, vom
Christentume überwunden sei, und zuletzt er-
läuterte es, daß diese durch das Christentum
abgetane Kultur als das sündhaft Irdische und
somit als das Teuflische angesehen werden
müsse.
Wie merkwürdig, daß selbst in dieser so
unscheinbaren Zutat zum Kreuze des Herrn
der Wandel einer erhabenen Idee Jahrhun-
derte hindurch monumentalen Ausdruck ge-
funden hat!
Schöneberg bei Berlin.
Gustav Schönermark.
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
Schlange, die Vertreterin des Bösen aus dem
Paradiese, sich am Kreuzesstamme empor-
ringelt (Abb. 4). Das Biblische „Und du wirst
ihr den Kopf zertreten" dürfte sich darauf be-
ziehen lassen. Ob nicht zugleich die Erinne-
rung an die Midgardschlange, die nach der
nordischen Sage die Erde umspannt, hier mit
von Einfluß gewesen ist ■— nachweislich haben
sich gar oft die Vorstellungen des germanischen
Heidentums mit denen der siegreich vor-
dringenden christlichen Lehre verschmolzen —,
mag dahingestellt sein.
Im Romanischen verwandelt sich das Fuß-
brett, von dessen ursprünglichem Sinne jetzt
niemand mehr wußte,
in eine zu einem
Untiere ausgestaltete
Konsole; denn als
Unholde, die, aus
Tier und Pflanze zu-
sammengesetzt, das
Licht scheuend, sich
in die Finsternis zu
verkriechen trachten,
bildete das Mittel-
alter in tausend-
fältiger Gestalt, wie
man sich teuflische
Art damals vorstellte.
Das Fußbrett an dem
romanischen Kruzi-
fixus aus Bronze im
Dome zu Minden
(Abb. 6 a und b) und Abb.
so manche andere
Bildung dieser Zeit gehören hierher. Da der
Künstler nunmehr frei von aller Überlieferung
war und nur noch seiner wenn auch von schola-
stischer Aufassung beherrschter Phantasie zu
gehorchen brauchte, so fand derselbe Gedanke
auch in anderen Formen Ausdruck. Wir
sehen die Stelle des Fußbrettes eingenommen
von einem Schädel mit Gebein, von Adam, wie
er aus dem Sarge bezw. Grabe steigt, von dem
Kelche, in dem dasBlut Christi aufgefangen wird
(dem hl. Graal) usw. (Abb. 5). In allen Gebilden
derselbe Gedanke, aber immer in neuer, eigen-
artiger Beleuchtung. Immer noch gelten, wie
SchnütgenBd.VII, Sp. 190 sagt, die Kreuzesdar-
stellungen „als Sinnbilder des Triumphes Christi,
mithin als Zeichen der Freude, nicht der Trauer".
Mit der Gotik verschwindet das Fußbrett
in Deutschland, weil nunmehr auch die letzte
Spur der alten Gottesauffassung verloren ge-
gangen war, nach welcher Christus auch noch
am Kreuze den göttlichen Führer oder sieg-
reichen Herrscher darstellen mußte. Der jetzt
mit Dornen gekrönte Gekreuzigte hatte viel mehr
das Bild eines seinen körperlichen Schmerzen
Erliegenden darzubieten. — Die italienischen
Kruzifixe behalten das Fußbrett jedoch in
einfacher Form bei, und die spätere Zeit ver-
wendet es vereinzelt. Das alles hat gleich-
falls tieferen Sinn und steht mit dem darge-
legten Gedankengange in Verbindung, was sich
später wohl einmal
erweisen läßt.
Die Umgestal-
tung des Fußbrettes
bis zur Gotik enthält
ein Stückjenermonu-
mentalen Theologie,
die sich in den mittel-
alterlichen Kunst-
werken überhaupt
kund getan hat, und
die darauf abzielt, das
Sündhafte, Irdische
als durch Christi Tod
überwunden darzu-
stellen. Zunächst
sprach das Fußbrett
nur von der Macht
Christi oder vielmehr
6 b. von der Macht der
im Kreuzestode des
Heilandes beruhenden Hauptlehre des Christen-
tums. Dann verkündete es, daß die Welt-
beherrscherin Rom, der Inbegriff des Glanzes
einer noch allen erinnerlichen Kultur, vom
Christentume überwunden sei, und zuletzt er-
läuterte es, daß diese durch das Christentum
abgetane Kultur als das sündhaft Irdische und
somit als das Teuflische angesehen werden
müsse.
Wie merkwürdig, daß selbst in dieser so
unscheinbaren Zutat zum Kreuze des Herrn
der Wandel einer erhabenen Idee Jahrhun-
derte hindurch monumentalen Ausdruck ge-
funden hat!
Schöneberg bei Berlin.
Gustav Schönermark.