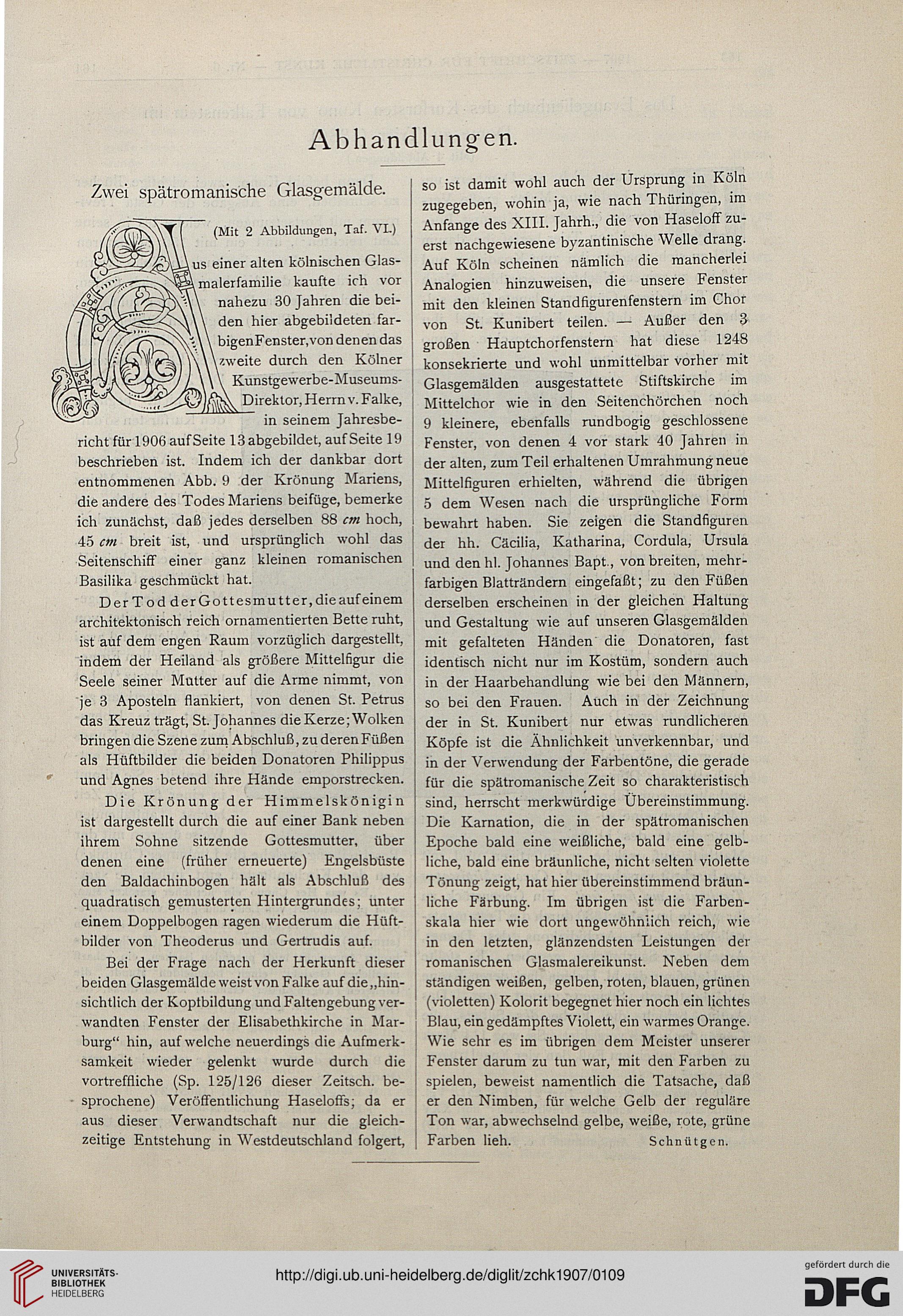Abhandlungen.
Zwei spätromanische Glasgemälde.
(Mit 2 Abbildungen, Taf. VI.)
us einer alten kölnischen Glas-
malerfamilie kaufte ich vor
nahezu 30 Jahren die bei-
den hier abgebildeten far-
bigenFenster.von denen das
/.weite durch den Kölner
Kunstgewerbe-Museums-
Direktor, Herrn v.Falke,
in seinem Jahresbe-
richt für 1906 auf Seite 13 abgebildet, auf Seite 19
beschrieben ist. Indem ich der dankbar dort
entnommenen Abb. 9 der Krönung Mariens,
die andere des Todes Mariens beifüge, bemerke
ich zunächst, daß jedes derselben 88 cm hoch,
45 cm breit ist, und ursprünglich wohl das
Seitenschiff einer ganz kleinen romanischen
Basilika geschmückt hat.
Der Tod der Gottesmutter, die auf einem
architektonisch reich ornamentierten Bette ruht,
ist auf dem engen Raum vorzüglich dargestellt,
indem der Heiland als größere Mittelfigur die
Seele seiner Mütter auf die Arme nimmt, von
je 3 Aposteln flankiert, von denen St. Petrus
das Kreuz trägt, St. Johannes die Kerze; Wolken
bringen die Szene zum Abschluß, zu derenFüßen
als Hüftbilder die beiden Donatoren Philippus
und Agnes betend ihre Hände emporstrecken.
Die Krönung der Himmelskönigin
ist dargestellt durch die auf einer Bank neben
ihrem Sohne sitzende Gottesmutter, über
denen eine (früher erneuerte) Engelsbüste
den Baldachinbogen hält als Abschluß des
quadratisch gemusterten Hintergrundes; unter
einem Doppelbogen ragen wiederum die Hüft-
bilder von Theoderus und Gertrudis auf.
Bei der Frage nach der Herkunft dieser
beiden Glasgemälde weist von Falke auf die „hin-
sichtlich der Koptbildung und Faltengebung ver-
wandten Fenster der Elisabethkirche in Mar-
burg" hin, aufweiche neuerdings die Aufmerk-
samkeit wieder gelenkt wurde durch die
vortreffliche (Sp. 125/126 dieser Zeitsch. be-
sprochene) Veröffentlichung Haseloffs; da er
aus dieser Verwandtschaft nur die gleich-
zeitige Entstehung in Westdeutschland folgert,
so ist damit wohl auch der Ursprung in Köln
zugegeben, wohin ja, wie nach Thüringen, im
Anfange des XIII. Jahrh., die von Haseloff zu-
erst nachgewiesene byzantinische Welle drang.
Auf Köln scheinen nämlich die mancherlei
Analogien hinzuweisen, die unsere Fenster
mit den kleinen Standfigurenfenstern im Ghor
von St. Kunibert teilen. — Außer den 3
großen Hauptchorfenstern hat diese 1248
konsekrierte und wohl unmittelbar vorher mit
Glasgemälden ausgestattete Stiftskirche im
Mittelchor wie in den Seitenchörchen noch
9 kleinere, ebenfalls rundbogig geschlossene
Fenster, von denen 4 vor stark 40 Jahren in
der alten, zum Teil erhaltenen Umrahmung neue
Mittelfiguren erhielten, während die übrigen
5 dem Wesen nach die ursprüngliche Form
bewahrt haben. Sie zeigen die Standfiguren
der hh. Cäcilia, Katharina, Cordula, Ursula
und den hl. Johannes Bapt, von breiten, mehr-
farbigen Blatträndern eingefaßt; zu den Füßen
derselben erscheinen in der gleichen Haltung
und Gestaltung wie auf unseren Glasgemälden
mit gefalteten Händen die Donatoren, fast
identisch nicht nur im Kostüm, sondern auch
in der Haarbehandlung wie bei den Männern,
so bei den Frauen. Auch in der Zeichnung
der in St. Kunibert nur etwas rundlicheren
Köpfe ist die Ähnlichkeit unverkennbar, und
in der Verwendung der Farbentöne, die gerade
für die spätromanische Zeit so charakteristisch
sind, herrscht merkwürdige Übereinstimmung.
Die Karnation, die in der spätromanischen
Epoche bald eine weißliche, bald eine gelb-
liche, bald eine bräunliche, nicht selten violette
Tönung zeigt, hat hier übereinstimmend bräun-
liche Färbung. Im übrigen ist die Farben-
skala hier wie dort ungewöhnlich reich, wie
in den letzten, glänzendsten Leistungen der
romanischen Glasmalereikunst. Neben dem
ständigen weißen, gelben, roten, blauen, grünen
(violetten) Kolorit begegnet hier noch ein lichtes
Blau, ein gedämpftes Violett, ein warmes Orange.
Wie sehr es im übrigen dem Meister unserer
Fenster darum zu tun war, mit den Farben zu
spielen, beweist namentlich die Tatsache, daß
er den Nimben, für welche Gelb der reguläre
Ton war, abwechselnd gelbe, weiße, rote, grüne
Farben lieh. Schnütgen.
Zwei spätromanische Glasgemälde.
(Mit 2 Abbildungen, Taf. VI.)
us einer alten kölnischen Glas-
malerfamilie kaufte ich vor
nahezu 30 Jahren die bei-
den hier abgebildeten far-
bigenFenster.von denen das
/.weite durch den Kölner
Kunstgewerbe-Museums-
Direktor, Herrn v.Falke,
in seinem Jahresbe-
richt für 1906 auf Seite 13 abgebildet, auf Seite 19
beschrieben ist. Indem ich der dankbar dort
entnommenen Abb. 9 der Krönung Mariens,
die andere des Todes Mariens beifüge, bemerke
ich zunächst, daß jedes derselben 88 cm hoch,
45 cm breit ist, und ursprünglich wohl das
Seitenschiff einer ganz kleinen romanischen
Basilika geschmückt hat.
Der Tod der Gottesmutter, die auf einem
architektonisch reich ornamentierten Bette ruht,
ist auf dem engen Raum vorzüglich dargestellt,
indem der Heiland als größere Mittelfigur die
Seele seiner Mütter auf die Arme nimmt, von
je 3 Aposteln flankiert, von denen St. Petrus
das Kreuz trägt, St. Johannes die Kerze; Wolken
bringen die Szene zum Abschluß, zu derenFüßen
als Hüftbilder die beiden Donatoren Philippus
und Agnes betend ihre Hände emporstrecken.
Die Krönung der Himmelskönigin
ist dargestellt durch die auf einer Bank neben
ihrem Sohne sitzende Gottesmutter, über
denen eine (früher erneuerte) Engelsbüste
den Baldachinbogen hält als Abschluß des
quadratisch gemusterten Hintergrundes; unter
einem Doppelbogen ragen wiederum die Hüft-
bilder von Theoderus und Gertrudis auf.
Bei der Frage nach der Herkunft dieser
beiden Glasgemälde weist von Falke auf die „hin-
sichtlich der Koptbildung und Faltengebung ver-
wandten Fenster der Elisabethkirche in Mar-
burg" hin, aufweiche neuerdings die Aufmerk-
samkeit wieder gelenkt wurde durch die
vortreffliche (Sp. 125/126 dieser Zeitsch. be-
sprochene) Veröffentlichung Haseloffs; da er
aus dieser Verwandtschaft nur die gleich-
zeitige Entstehung in Westdeutschland folgert,
so ist damit wohl auch der Ursprung in Köln
zugegeben, wohin ja, wie nach Thüringen, im
Anfange des XIII. Jahrh., die von Haseloff zu-
erst nachgewiesene byzantinische Welle drang.
Auf Köln scheinen nämlich die mancherlei
Analogien hinzuweisen, die unsere Fenster
mit den kleinen Standfigurenfenstern im Ghor
von St. Kunibert teilen. — Außer den 3
großen Hauptchorfenstern hat diese 1248
konsekrierte und wohl unmittelbar vorher mit
Glasgemälden ausgestattete Stiftskirche im
Mittelchor wie in den Seitenchörchen noch
9 kleinere, ebenfalls rundbogig geschlossene
Fenster, von denen 4 vor stark 40 Jahren in
der alten, zum Teil erhaltenen Umrahmung neue
Mittelfiguren erhielten, während die übrigen
5 dem Wesen nach die ursprüngliche Form
bewahrt haben. Sie zeigen die Standfiguren
der hh. Cäcilia, Katharina, Cordula, Ursula
und den hl. Johannes Bapt, von breiten, mehr-
farbigen Blatträndern eingefaßt; zu den Füßen
derselben erscheinen in der gleichen Haltung
und Gestaltung wie auf unseren Glasgemälden
mit gefalteten Händen die Donatoren, fast
identisch nicht nur im Kostüm, sondern auch
in der Haarbehandlung wie bei den Männern,
so bei den Frauen. Auch in der Zeichnung
der in St. Kunibert nur etwas rundlicheren
Köpfe ist die Ähnlichkeit unverkennbar, und
in der Verwendung der Farbentöne, die gerade
für die spätromanische Zeit so charakteristisch
sind, herrscht merkwürdige Übereinstimmung.
Die Karnation, die in der spätromanischen
Epoche bald eine weißliche, bald eine gelb-
liche, bald eine bräunliche, nicht selten violette
Tönung zeigt, hat hier übereinstimmend bräun-
liche Färbung. Im übrigen ist die Farben-
skala hier wie dort ungewöhnlich reich, wie
in den letzten, glänzendsten Leistungen der
romanischen Glasmalereikunst. Neben dem
ständigen weißen, gelben, roten, blauen, grünen
(violetten) Kolorit begegnet hier noch ein lichtes
Blau, ein gedämpftes Violett, ein warmes Orange.
Wie sehr es im übrigen dem Meister unserer
Fenster darum zu tun war, mit den Farben zu
spielen, beweist namentlich die Tatsache, daß
er den Nimben, für welche Gelb der reguläre
Ton war, abwechselnd gelbe, weiße, rote, grüne
Farben lieh. Schnütgen.