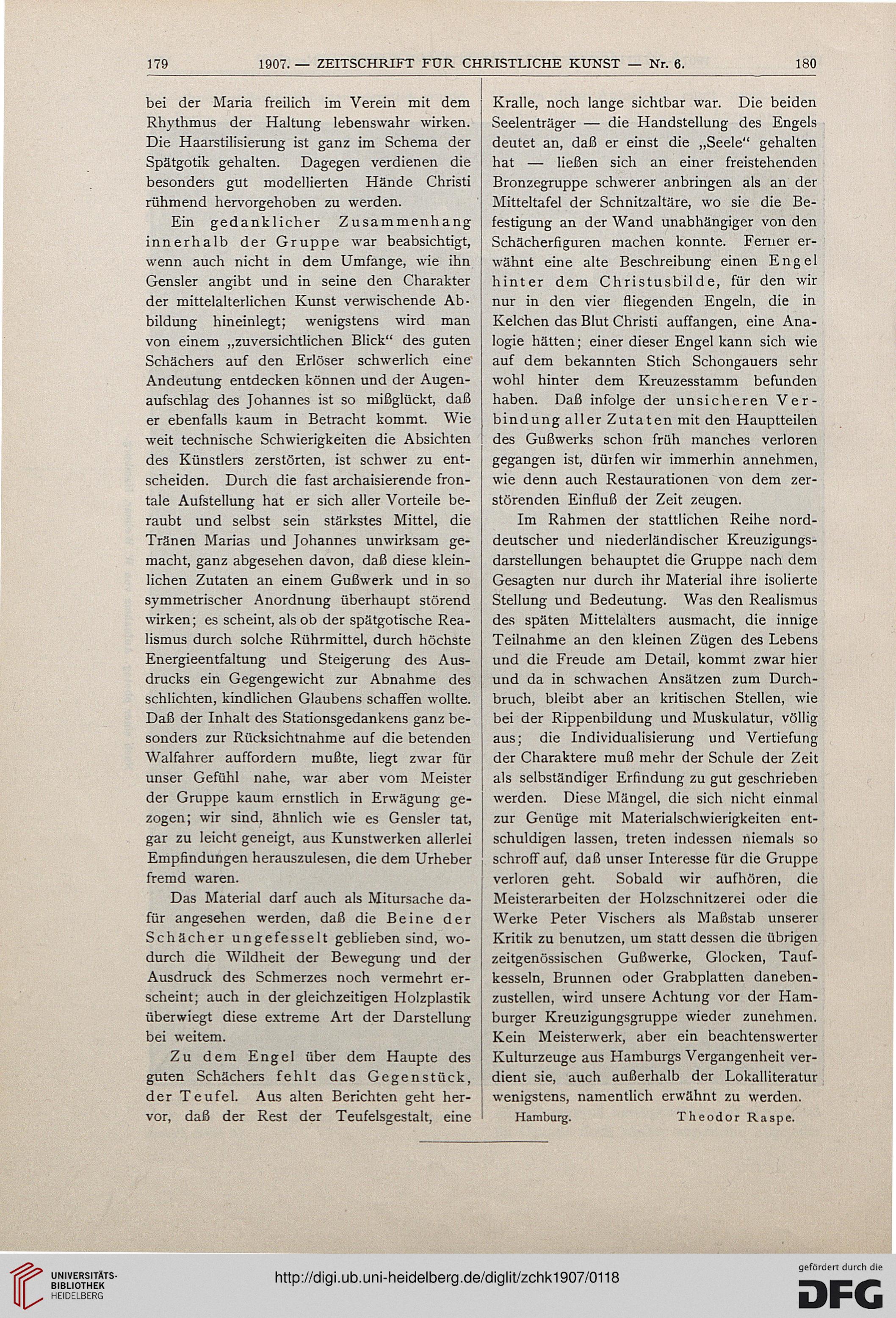179
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
180
bei der Maria freilich im Verein mit dem
Rhythmus der Haltung lebenswahr wirken.
Die Haarstilisierung ist ganz im Schema der
Spätgotik gehalten. Dagegen verdienen die
besonders gut modellierten Hände Christi
rühmend hervorgehoben zu werden.
Ein gedanklicher Zusammenhang
innerhalb der Gruppe war beabsichtigt,
wenn auch nicht in dem Umfange, wie ihn
Gensler angibt und in seine den Charakter
der mittelalterlichen Kunst verwischende Ab-
bildung hineinlegt; wenigstens wird man
von einem „zuversichtlichen Blick" des guten
Schachers auf den Erlöser schwerlich eine
Andeutung entdecken können und der Augen-
aufschlag des Johannes ist so mißglückt, daß
er ebenfalls kaum in Betracht kommt. Wie
weit technische Schwierigkeiten die Absichten
des Künstlers zerstörten, ist schwer zu ent-
scheiden. Durch die fast archaisierende fron-
tale Aufstellung hat er sich aller Vorteile be-
raubt und selbst sein stärkstes Mittel, die
Tränen Marias und Johannes unwirksam ge-
macht, ganz abgesehen davon, daß diese klein-
lichen Zutaten an einem Gußwerk und in so
symmetrischer Anordnung überhaupt störend
wirken; es scheint, als ob der spätgotische Rea-
lismus durch solche Rührmittel, durch höchste
Energieentfaltung und Steigerung des Aus-
drucks ein Gegengewicht zur Abnahme des
schlichten, kindlichen Glaubens schaffen wollte.
Daß der Inhalt des Stationsgedankens ganz be-
sonders zur Rücksichtnahme auf die betenden
Walfahrer auffordern mußte, liegt zwar für
unser Gefühl nahe, war aber vom Meister
der Gruppe kaum ernstlich in Erwägung ge-
zogen; wir sind, ähnlich wie es Gensler tat,
gar zu leicht geneigt, aus Kunstwerken allerlei
Empfindungen herauszulesen, die dem Urheber
fremd waren.
Das Material darf auch als Mitursache da-
für angesehen werden, daß die Beine der
Schacher ungefesselt geblieben sind, wo-
durch die Wildheit der Bewegung und der
Ausdruck des Schmerzes noch vermehrt er-
scheint; auch in der gleichzeitigen Holzplastik
überwiegt diese extreme Art der Darstellung
bei weitem.
Zu dem Engel über dem Haupte des
guten Schachers fehlt das Gegenstück,
der Teufel. Aus alten Berichten geht her-
vor, daß der Rest der Teufelsgestalt, eine
Kralle, noch lange sichtbar war. Die beiden
Seelenträger — die Handstellung des Engels
deutet an, daß er einst die „Seele" gehalten
hat — ließen sich an einer freistehenden
Bronzegruppe schwerer anbringen als an der
Mitteltafel der Schnitzaltäre, wo sie die Be-
festigung an der Wand unabhängiger von den
Schächerfiguren machen konnte. Ferner er-
wähnt eine alte Beschreibung einen Engel
hinter dem Christusbilde, für den wir
nur in den vier fliegenden Engeln, die in
Kelchen das Blut Christi auffangen, eine Ana-
logie hätten; einer dieser Engel kann sich wie
auf dem bekannten Stich Schongauers sehr
wohl hinter dem Kreuzesstamm befunden
haben. Daß infolge der unsicheren Ver-
bindung aller Zutaten mit den Hauptteilen
des Gußwerks schon früh manches verloren
gegangen ist, düifen wir immerhin annehmen,
wie denn auch Restaurationen von dem zer-
störenden Einfluß der Zeit zeugen.
Im Rahmen der stattlichen Reihe nord-
deutscher und niederländischer Kreuzigungs-
darstellungen behauptet die Gruppe nach dem
Gesagten nur durch ihr Material ihre isolierte
Stellung und Bedeutung. Was den Realismus
des späten Mittelalters ausmacht, die innige
Teilnahme an den kleinen Zügen des Lebens
und die Freude am Detail, kommt zwar hier
und da in schwachen Ansätzen zum Durch-
bruch, bleibt aber an kritischen Stellen, wie
bei der Rippenbildung und Muskulatur, völlig
aus; die Individualisierung und Vertiefung
der Charaktere muß mehr der Schule der Zeit
als selbständiger Erfindung zu gut geschrieben
werden. Diese Mängel, die sich nicht einmal
zur Genüge mit Materialschwierigkeiten ent-
schuldigen lassen, treten indessen niemals so
schroff auf, daß unser Interesse für die Gruppe
verloren geht. Sobald wir aufhören, die
Meisterarbeiten der Holzschnitzerei oder die
Werke Peter Vischers als Maßstab unserer
Kritik zu benutzen, um statt dessen die übrigen
zeitgenössischen Gußwerke, Glocken, Tauf-
kesseln, Brunnen oder Grabplatten daneben-
zustellen, wird unsere Achtung vor der Ham-
burger Kreuzigungsgruppe wieder zunehmen.
Kein Meisterwerk, aber ein beachtenswerter
Kulturzeuge aus Hamburgs Vergangenheit ver-
dient sie, auch außerhalb der Lokalliteratur
wenigstens, namentlich erwähnt zu werden.
Hamburg. Theodor Raspe.
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
180
bei der Maria freilich im Verein mit dem
Rhythmus der Haltung lebenswahr wirken.
Die Haarstilisierung ist ganz im Schema der
Spätgotik gehalten. Dagegen verdienen die
besonders gut modellierten Hände Christi
rühmend hervorgehoben zu werden.
Ein gedanklicher Zusammenhang
innerhalb der Gruppe war beabsichtigt,
wenn auch nicht in dem Umfange, wie ihn
Gensler angibt und in seine den Charakter
der mittelalterlichen Kunst verwischende Ab-
bildung hineinlegt; wenigstens wird man
von einem „zuversichtlichen Blick" des guten
Schachers auf den Erlöser schwerlich eine
Andeutung entdecken können und der Augen-
aufschlag des Johannes ist so mißglückt, daß
er ebenfalls kaum in Betracht kommt. Wie
weit technische Schwierigkeiten die Absichten
des Künstlers zerstörten, ist schwer zu ent-
scheiden. Durch die fast archaisierende fron-
tale Aufstellung hat er sich aller Vorteile be-
raubt und selbst sein stärkstes Mittel, die
Tränen Marias und Johannes unwirksam ge-
macht, ganz abgesehen davon, daß diese klein-
lichen Zutaten an einem Gußwerk und in so
symmetrischer Anordnung überhaupt störend
wirken; es scheint, als ob der spätgotische Rea-
lismus durch solche Rührmittel, durch höchste
Energieentfaltung und Steigerung des Aus-
drucks ein Gegengewicht zur Abnahme des
schlichten, kindlichen Glaubens schaffen wollte.
Daß der Inhalt des Stationsgedankens ganz be-
sonders zur Rücksichtnahme auf die betenden
Walfahrer auffordern mußte, liegt zwar für
unser Gefühl nahe, war aber vom Meister
der Gruppe kaum ernstlich in Erwägung ge-
zogen; wir sind, ähnlich wie es Gensler tat,
gar zu leicht geneigt, aus Kunstwerken allerlei
Empfindungen herauszulesen, die dem Urheber
fremd waren.
Das Material darf auch als Mitursache da-
für angesehen werden, daß die Beine der
Schacher ungefesselt geblieben sind, wo-
durch die Wildheit der Bewegung und der
Ausdruck des Schmerzes noch vermehrt er-
scheint; auch in der gleichzeitigen Holzplastik
überwiegt diese extreme Art der Darstellung
bei weitem.
Zu dem Engel über dem Haupte des
guten Schachers fehlt das Gegenstück,
der Teufel. Aus alten Berichten geht her-
vor, daß der Rest der Teufelsgestalt, eine
Kralle, noch lange sichtbar war. Die beiden
Seelenträger — die Handstellung des Engels
deutet an, daß er einst die „Seele" gehalten
hat — ließen sich an einer freistehenden
Bronzegruppe schwerer anbringen als an der
Mitteltafel der Schnitzaltäre, wo sie die Be-
festigung an der Wand unabhängiger von den
Schächerfiguren machen konnte. Ferner er-
wähnt eine alte Beschreibung einen Engel
hinter dem Christusbilde, für den wir
nur in den vier fliegenden Engeln, die in
Kelchen das Blut Christi auffangen, eine Ana-
logie hätten; einer dieser Engel kann sich wie
auf dem bekannten Stich Schongauers sehr
wohl hinter dem Kreuzesstamm befunden
haben. Daß infolge der unsicheren Ver-
bindung aller Zutaten mit den Hauptteilen
des Gußwerks schon früh manches verloren
gegangen ist, düifen wir immerhin annehmen,
wie denn auch Restaurationen von dem zer-
störenden Einfluß der Zeit zeugen.
Im Rahmen der stattlichen Reihe nord-
deutscher und niederländischer Kreuzigungs-
darstellungen behauptet die Gruppe nach dem
Gesagten nur durch ihr Material ihre isolierte
Stellung und Bedeutung. Was den Realismus
des späten Mittelalters ausmacht, die innige
Teilnahme an den kleinen Zügen des Lebens
und die Freude am Detail, kommt zwar hier
und da in schwachen Ansätzen zum Durch-
bruch, bleibt aber an kritischen Stellen, wie
bei der Rippenbildung und Muskulatur, völlig
aus; die Individualisierung und Vertiefung
der Charaktere muß mehr der Schule der Zeit
als selbständiger Erfindung zu gut geschrieben
werden. Diese Mängel, die sich nicht einmal
zur Genüge mit Materialschwierigkeiten ent-
schuldigen lassen, treten indessen niemals so
schroff auf, daß unser Interesse für die Gruppe
verloren geht. Sobald wir aufhören, die
Meisterarbeiten der Holzschnitzerei oder die
Werke Peter Vischers als Maßstab unserer
Kritik zu benutzen, um statt dessen die übrigen
zeitgenössischen Gußwerke, Glocken, Tauf-
kesseln, Brunnen oder Grabplatten daneben-
zustellen, wird unsere Achtung vor der Ham-
burger Kreuzigungsgruppe wieder zunehmen.
Kein Meisterwerk, aber ein beachtenswerter
Kulturzeuge aus Hamburgs Vergangenheit ver-
dient sie, auch außerhalb der Lokalliteratur
wenigstens, namentlich erwähnt zu werden.
Hamburg. Theodor Raspe.