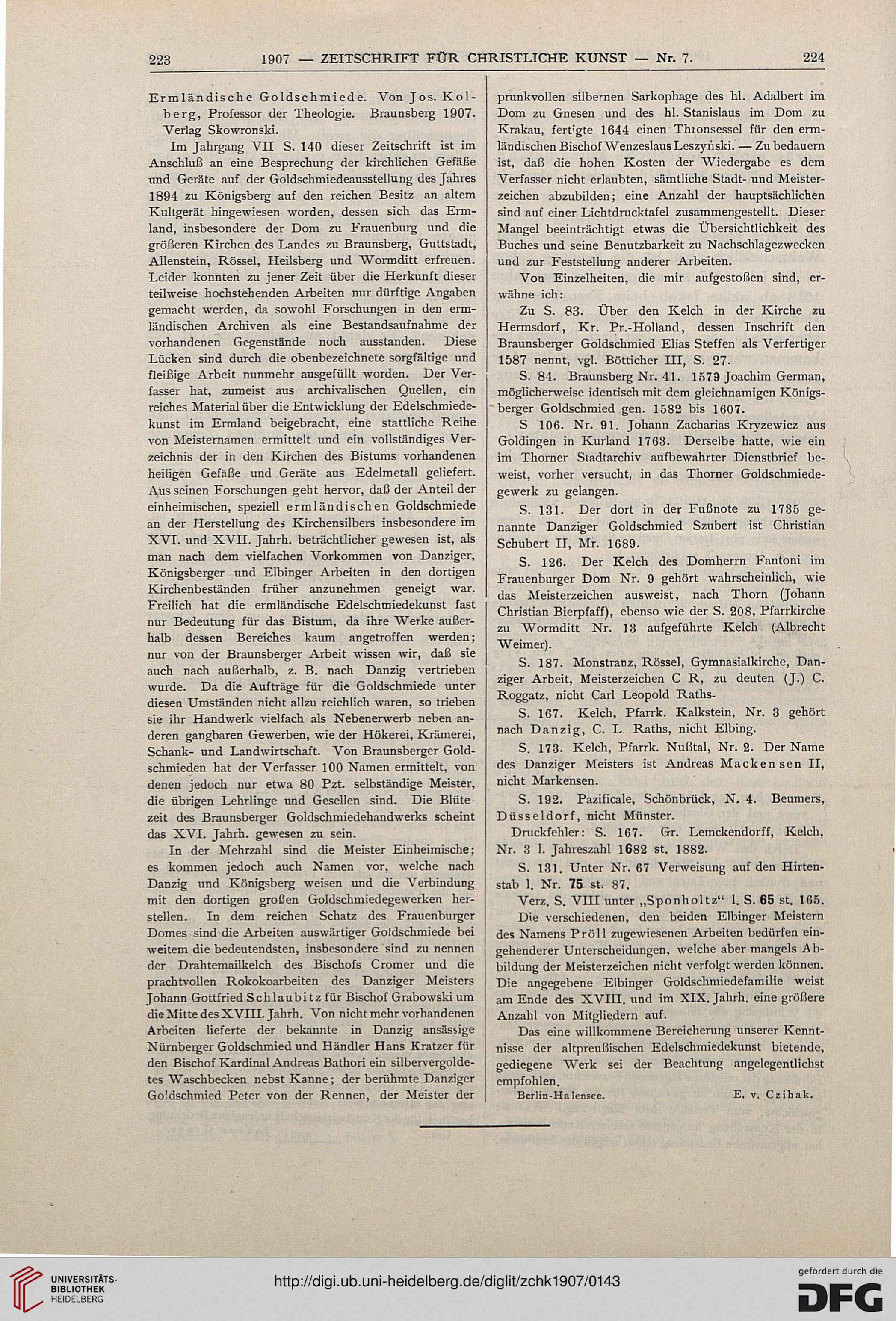223
1907
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
224
Ermländische Goldschmiede. Von Jos. Kol-
berg, Professor der Theologie. Braunsberg 1907.
Verlag Skowronski.
Im Jahrgang VII S. 140 dieser Zeitschrift ist im
Anschluß an eine Besprechung der kirchlichen Gefäße
und Geräte auf der Goldschmiedeausstellung des Jahres
1894 zu Königsberg auf den reichen Besitz an altem
Kultgerät hingewiesen worden, dessen sich das Erm-
land, insbesondere der Dom zu Frauenburg und die
größeren Kirchen des Landes zu Braunsberg, Guttstadt,
Alienstein, Rössel, Heilsberg und "Wormditt erfreuen.
Leider konnten zu jener Zeit über die Herkunft dieser
teilweise hochstehenden Arbeiten nur dürftige Angaben
gemacht werden, da sowohl Forschungen in den erm-
ländischen Archiven als eine Bestandsaufnahme der
vorhandenen Gegenstände noch ausstanden. Diese
Lücken sind durch die obenbezeichnete sorgfältige und
fleißige Arbeit nunmehr ausgefüllt worden. Der Ver-
fasser hat, zumeist aus archivalischen Quellen, ein
reiches Material über die Entwicklung der Edelschmiede-
kunst im Ermland beigebracht, eine stattliche Reihe
von Meisternamen ermittelt und ein vollständiges Ver-
zeichnis der in den Kirchen des Bistums vorhandenen
heiligen Gefäße und Geräte aus Edelmetall geliefert.
Aus seinen Forschungen geht hervor, daß der Anteil der
einheimischen, speziell ermländischen Goldschmiede
an der Herstellung des Kirchensilbers insbesondere im
XVI. und XVH. Jahrh. beträchtlicher gewesen ist, als
man nach dem vielfachen Vorkommen von Danziger,
Königsberger und Elbinger Arbeiten in den dortigen
Kirchenbeständen früher anzunehmen geneigt war.
Freilich hat die ermländische Edelschtniedekunst fast
nur Bedeutung für das Bistum, da ihre Werke außer-
halb dessen Bereiches kaum angetroffen werden;
nur von der Braunsberger Arbeit wissen wir, daß sie
auch nach außerhalb, z. B. nach Danzig vertrieben
wurde. Da die Aufträge für die Goldschmiede unter
diesen Umständen nicht allzu reichlich waren, so trieben
sie ihr Handwerk vielfach als Nebenerwerb neben an-
deren gangbaren Gewerben, wie der Hökerei, Kramerei,
Schank- und Landwirtschaft. Von Braunsberger Gold-
schmieden hat der Verfasser 100 Namen ermittelt, von
denen jedoch nur etwa 80 Pzt. selbständige Meister,
die übrigen Lehrlinge und Gesellen sind. Die Blüte-
zeit des Braunsberger Goldschmiedehandwerks scheint
das XVI. Jahrh. gewesen zu sein.
In der Mehrzahl sind die Meister Einheimische;
es kommen jedoch auch Namen vor, welche nach
Danzig und Königsberg weisen und die Verbindung
mit den dortigen großen Goldschmiedegewerken her-
stellen. In dem reichen Schatz des Frauenburger
Domes sind die Arbeiten auswärtiger Goldschmiede bei
weitem die bedeutendsten, insbesondere sind zu nennen
der Drahtemailkelch des Bischofs Cromer und die
prachtvollen Rokokoarbeiten des Danziger Meisters
Johann Gottfried Schlaubitz für Bischof Grabowski um
die Mitte des XVIII. Jahrh. Von nicht mehr vorhandenen
Arbeiten lieferte der bekannte in Danzig ansässige
Nürnberger Goldschmied und Händler Hans Kratzer für
den Bischof Kardinal Andreas Bathori ein silbervergolde-
tes Waschbecken nebst Kanne; der berühmte Danziger
Goldschmied Peter von der Rennen, der Meister der
prunkvollen silbernen Sarkophage des hl. Adalbert im
Dom zu Gnesen und des hl. Stanislaus im Dom zu
Krakau, fert'gte 1644 einen Thionsessel für den erm-
ländischen Bischof WenzeslausLeszyriski. — Zu bedauern
ist, daß die hohen Kosten der Wiedergabe es dem
Verfasser nicht erlaubten, sämtliche Stadt- und Meister-
zeichen abzubilden; eine Anzahl der hauptsächlichen
sind auf einer Lichtdrucktafel zusammengestellt. Dieser
Mangel beeinträchtigt etwas die Übersichtlichkeit des
Buches und seine Benutzbarkeit zu Nachschlagezwecken
und zur Feststellung anderer Arbeiten.
Von Einzelheiten, die mir aufgestoßen sind, er-
wähne ich:
Zu S. 83. Über den Kelch in der Kirche zu
Hermsdorf, Kr. Pr.-Holland, dessen Inschrift den
Braunsberger Goldschmied Elias Steffen als Verfertiger
1587 nennt, vgl. Bötticher III, S. 27.
S. 84. Braunsberg Nr. 41. 1579 Joachim German,
möglicherweise identisch mit dem gleichnamigen Königs-
berger Goldschmied gen. 1582 bis 1607.
S 106. Nr. 91. Johann Zacharias Kryzewicz aus
Goldingen in Kurland 1763. Derselbe hatte, wie ein
im Thorner Stadtarchiv aufbewahrter Dienstbrief be-
weist, vorher versucht, in das Thorner Goldschmiede-
gewerk zu gelangen.
S. 131. Der dort in der Fußnote zu 1735 ge-
nannte Danziger Goldschmied Szubert ist Christian
Schubert II, Mr. 1689.
S. 126. Der Kelch des Domherrn Fantoni im
Frauenburger Dom Nr. 9 gehört wahrscheinlich, wie
das Meisterzeichen ausweist, nach Thorn (Johann
Christian Bierpfaff), ebenso wie der S. 208, Pfarrkirche
zu Wormditt Nr. 13 aufgeführte Kelch (Albrecht
Weimer).
S. 187. Monstranz, Rössel, Gymnasialkirche, Dan-
ziger Arbeit, Meisterzeichen C R, zu deuten (J.) C.
Roggatz, nicht Carl Leopold Raths-
S. 167. Kelch, Pfarrk. Kalkstein, Nr. 3 gehört
nach Danzig, C. L Raths, nicht Elbing.
S. 173. Kelch, Pfarrk. Nußtal, Nr. 2. Der Name
des Danziger Meisters ist Andreas Macken sen II,
nicht Markensen.
S. 192. Pazificale, Schönbrück, N. 4. Beumers,
Düsseldorf, nicht Münster.
Druckfehler: S. 167. Gr. Lemckendorff, Kelch,
Nr. 3 1. Jahreszahl 1682 st. 1882.
S. 131. Unter Nr. 67 Verweisung auf den Hirten-
stab 1. Nr. 75 st. 87.
Verz. S. VIII unter „Sponholtz" 1. S. 65 st. 165.
Die verschiedenen, den beiden Elbinger Meistern
des Namens Pröll zugewiesenen Arbeiten bedürfen ein-
gehenderer Unterscheidungen, welche aber mangels Ab-
bildung der Meisterzeichen nicht verfolgt werden können.
Die angegebene Elbinger Goldschmiedefamilie weist
am Ende des XVIII. und im XIX. Jahrh. eine größere
Anzahl von Mitgliedern auf.
Das eine willkommene Bereicherung unserer Kennt-
nisse der altpreußischen Edelschmiedekunst bietende,
gediegene Werk sei der Beachtung angelegentlichst
empfohlen.
Berlin-Ha lensee.
E. v. Czihak.
1907
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
224
Ermländische Goldschmiede. Von Jos. Kol-
berg, Professor der Theologie. Braunsberg 1907.
Verlag Skowronski.
Im Jahrgang VII S. 140 dieser Zeitschrift ist im
Anschluß an eine Besprechung der kirchlichen Gefäße
und Geräte auf der Goldschmiedeausstellung des Jahres
1894 zu Königsberg auf den reichen Besitz an altem
Kultgerät hingewiesen worden, dessen sich das Erm-
land, insbesondere der Dom zu Frauenburg und die
größeren Kirchen des Landes zu Braunsberg, Guttstadt,
Alienstein, Rössel, Heilsberg und "Wormditt erfreuen.
Leider konnten zu jener Zeit über die Herkunft dieser
teilweise hochstehenden Arbeiten nur dürftige Angaben
gemacht werden, da sowohl Forschungen in den erm-
ländischen Archiven als eine Bestandsaufnahme der
vorhandenen Gegenstände noch ausstanden. Diese
Lücken sind durch die obenbezeichnete sorgfältige und
fleißige Arbeit nunmehr ausgefüllt worden. Der Ver-
fasser hat, zumeist aus archivalischen Quellen, ein
reiches Material über die Entwicklung der Edelschmiede-
kunst im Ermland beigebracht, eine stattliche Reihe
von Meisternamen ermittelt und ein vollständiges Ver-
zeichnis der in den Kirchen des Bistums vorhandenen
heiligen Gefäße und Geräte aus Edelmetall geliefert.
Aus seinen Forschungen geht hervor, daß der Anteil der
einheimischen, speziell ermländischen Goldschmiede
an der Herstellung des Kirchensilbers insbesondere im
XVI. und XVH. Jahrh. beträchtlicher gewesen ist, als
man nach dem vielfachen Vorkommen von Danziger,
Königsberger und Elbinger Arbeiten in den dortigen
Kirchenbeständen früher anzunehmen geneigt war.
Freilich hat die ermländische Edelschtniedekunst fast
nur Bedeutung für das Bistum, da ihre Werke außer-
halb dessen Bereiches kaum angetroffen werden;
nur von der Braunsberger Arbeit wissen wir, daß sie
auch nach außerhalb, z. B. nach Danzig vertrieben
wurde. Da die Aufträge für die Goldschmiede unter
diesen Umständen nicht allzu reichlich waren, so trieben
sie ihr Handwerk vielfach als Nebenerwerb neben an-
deren gangbaren Gewerben, wie der Hökerei, Kramerei,
Schank- und Landwirtschaft. Von Braunsberger Gold-
schmieden hat der Verfasser 100 Namen ermittelt, von
denen jedoch nur etwa 80 Pzt. selbständige Meister,
die übrigen Lehrlinge und Gesellen sind. Die Blüte-
zeit des Braunsberger Goldschmiedehandwerks scheint
das XVI. Jahrh. gewesen zu sein.
In der Mehrzahl sind die Meister Einheimische;
es kommen jedoch auch Namen vor, welche nach
Danzig und Königsberg weisen und die Verbindung
mit den dortigen großen Goldschmiedegewerken her-
stellen. In dem reichen Schatz des Frauenburger
Domes sind die Arbeiten auswärtiger Goldschmiede bei
weitem die bedeutendsten, insbesondere sind zu nennen
der Drahtemailkelch des Bischofs Cromer und die
prachtvollen Rokokoarbeiten des Danziger Meisters
Johann Gottfried Schlaubitz für Bischof Grabowski um
die Mitte des XVIII. Jahrh. Von nicht mehr vorhandenen
Arbeiten lieferte der bekannte in Danzig ansässige
Nürnberger Goldschmied und Händler Hans Kratzer für
den Bischof Kardinal Andreas Bathori ein silbervergolde-
tes Waschbecken nebst Kanne; der berühmte Danziger
Goldschmied Peter von der Rennen, der Meister der
prunkvollen silbernen Sarkophage des hl. Adalbert im
Dom zu Gnesen und des hl. Stanislaus im Dom zu
Krakau, fert'gte 1644 einen Thionsessel für den erm-
ländischen Bischof WenzeslausLeszyriski. — Zu bedauern
ist, daß die hohen Kosten der Wiedergabe es dem
Verfasser nicht erlaubten, sämtliche Stadt- und Meister-
zeichen abzubilden; eine Anzahl der hauptsächlichen
sind auf einer Lichtdrucktafel zusammengestellt. Dieser
Mangel beeinträchtigt etwas die Übersichtlichkeit des
Buches und seine Benutzbarkeit zu Nachschlagezwecken
und zur Feststellung anderer Arbeiten.
Von Einzelheiten, die mir aufgestoßen sind, er-
wähne ich:
Zu S. 83. Über den Kelch in der Kirche zu
Hermsdorf, Kr. Pr.-Holland, dessen Inschrift den
Braunsberger Goldschmied Elias Steffen als Verfertiger
1587 nennt, vgl. Bötticher III, S. 27.
S. 84. Braunsberg Nr. 41. 1579 Joachim German,
möglicherweise identisch mit dem gleichnamigen Königs-
berger Goldschmied gen. 1582 bis 1607.
S 106. Nr. 91. Johann Zacharias Kryzewicz aus
Goldingen in Kurland 1763. Derselbe hatte, wie ein
im Thorner Stadtarchiv aufbewahrter Dienstbrief be-
weist, vorher versucht, in das Thorner Goldschmiede-
gewerk zu gelangen.
S. 131. Der dort in der Fußnote zu 1735 ge-
nannte Danziger Goldschmied Szubert ist Christian
Schubert II, Mr. 1689.
S. 126. Der Kelch des Domherrn Fantoni im
Frauenburger Dom Nr. 9 gehört wahrscheinlich, wie
das Meisterzeichen ausweist, nach Thorn (Johann
Christian Bierpfaff), ebenso wie der S. 208, Pfarrkirche
zu Wormditt Nr. 13 aufgeführte Kelch (Albrecht
Weimer).
S. 187. Monstranz, Rössel, Gymnasialkirche, Dan-
ziger Arbeit, Meisterzeichen C R, zu deuten (J.) C.
Roggatz, nicht Carl Leopold Raths-
S. 167. Kelch, Pfarrk. Kalkstein, Nr. 3 gehört
nach Danzig, C. L Raths, nicht Elbing.
S. 173. Kelch, Pfarrk. Nußtal, Nr. 2. Der Name
des Danziger Meisters ist Andreas Macken sen II,
nicht Markensen.
S. 192. Pazificale, Schönbrück, N. 4. Beumers,
Düsseldorf, nicht Münster.
Druckfehler: S. 167. Gr. Lemckendorff, Kelch,
Nr. 3 1. Jahreszahl 1682 st. 1882.
S. 131. Unter Nr. 67 Verweisung auf den Hirten-
stab 1. Nr. 75 st. 87.
Verz. S. VIII unter „Sponholtz" 1. S. 65 st. 165.
Die verschiedenen, den beiden Elbinger Meistern
des Namens Pröll zugewiesenen Arbeiten bedürfen ein-
gehenderer Unterscheidungen, welche aber mangels Ab-
bildung der Meisterzeichen nicht verfolgt werden können.
Die angegebene Elbinger Goldschmiedefamilie weist
am Ende des XVIII. und im XIX. Jahrh. eine größere
Anzahl von Mitgliedern auf.
Das eine willkommene Bereicherung unserer Kennt-
nisse der altpreußischen Edelschmiedekunst bietende,
gediegene Werk sei der Beachtung angelegentlichst
empfohlen.
Berlin-Ha lensee.
E. v. Czihak.