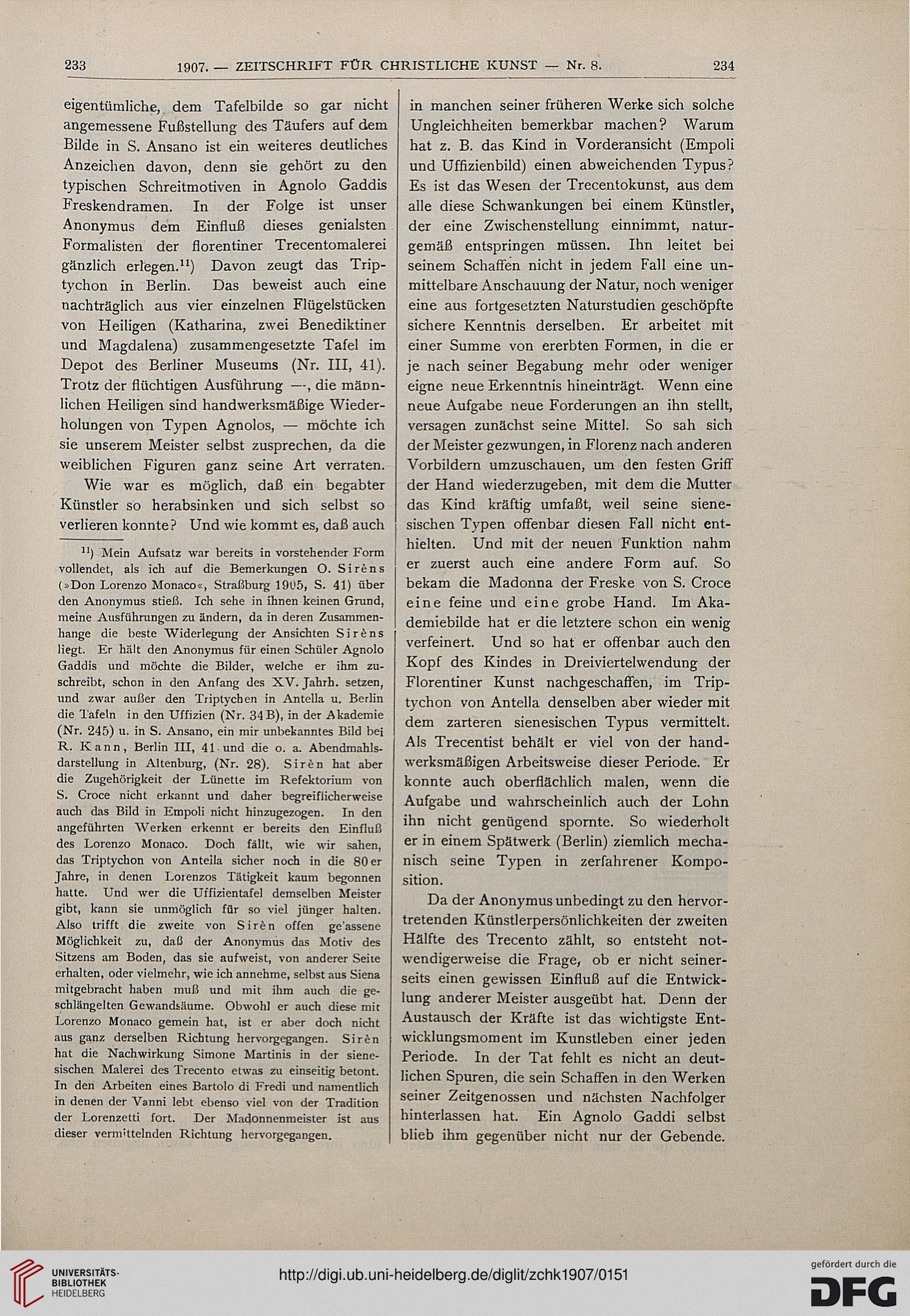233
1907.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
234
eigentümliche, dem Tafelbilde so gar nicht
angemessene Fußstellung des Täufers auf dem
Bilde in S. Ansano ist ein weiteres deutliches
Anzeichen davon, denn sie gehört zu den
typischen Schreitmotiven in Agnolo Gaddis
Freskendramen. In der Folge ist unser
Anonymus dem Einfluß dieses genialsten
Formalisten der florentiner Trecentomalerei
gänzlich erlegen.11) Davon zeugt das Trip-
tychon in Berlin. Das beweist auch eine
nachträglich aus vier einzelnen Flügelstücken
von Heiligen (Katharina, zwei Benediktiner
und Magdalena) zusammengesetzte Tafel im
Depot des Berliner Museums (Nr. III, 41).
Trotz der flüchtigen Ausführung —, die männ-
lichen Heiligen sind handwerksmäßige Wieder-
holungen von Typen Agnolos, — möchte ich
sie unserem Meister selbst zusprechen, da die
weiblichen Figuren ganz seine Art verraten.
Wie war es möglich, daß ein begabter
Künstler so herabsinken und sich selbst so
verlieren konnte? Und wie kommt es, daß auch
H) Mein Aufsatz war bereits in vorstehender Form
vollendet, als ich auf die Bemerkungen O. Sirens
(»Don Lorenzo Monaco«, Straßburg 1905, S. 41) über
den Anonymus stieß. Ich sehe in ihnen keinen Grund,
meine Ausführungen zu ändern, da in deren Zusammen-
hange die beste Widerlegung der Ansichten Sirens
liegt. Er hält den Anonymus für einen Schüler Agnolo
Gaddis und möchte die Bilder, welche er ihm zu-
schreibt, schon in den Anfang des XV. Jahrh. setzen,
und zwar außer den Triptychen in Antella u. Berlin
die Tafeln in den TJffizien (Nr. 34 B), in der Akademie
(Nr. 245) u. in S. Ansano, ein mir unbekanntes Bild bei
R. Kann, Berlin III, 41 und die o. a. Abendmahls-
darstellung in Altenburg, (Nr. 28). Siren hat aber
die Zugehörigkeit der Lünetle im Refektorium von
S. Croce nicht erkannt und daher begreiflicherweise
auch das Bild in Empoli nicht hinzugezogen. In den
angeführten Werken erkennt er bereits den Einfluß
des Lorenzo Monaco. Doch fällt, wie wir sahen,
das Triptychon von Anteila sicher noch in die 80 er
Jahre, in denen Lorenzos Tätigkeit kaum begonnen
halte. Und wer die Uffizientafel demselben Meister
gibt, kann sie unmöglich für so viel jünger halten.
Also trifft die zweite von Siren offen ge'assene
Möglichkeit zu, daß der Anonymus das Motiv des
Sitzens am Boden, das sie aufweist, von anderer Seite
erhalten, oder vielmehr, wie ich annehme, selbst aus Siena
mitgebracht haben muß und mit ihm auch die ge-
schlängelten Gewandsäume. Obwohl er auch diese mit
Lorenzo Monaco gemein hat, ist er aber doch nicht
aus ganz derselben Richtung hervorgegangen. Siren
hat die Nachwirkung Simone Martinis in der siene-
sischen Malerei des Trecento etwas zu einseitig betont.
In den Arbeiten eines Bartolo di Fredi und namentlich
in denen der Vanni lebt ebenso viel von der Tradition
der Lorenzetti fort. Der Madonnenmeister ist aus
dieser vermittelnden Richtung hervorgegangen.
in manchen seiner früheren Werke sich solche
Ungleichheiten bemerkbar machen? Warum
hat z. B. das Kind in Vorderansicht (Empoli
und Uffizienbild) einen abweichenden Typus?
Es ist das Wesen der Trecentokunst, aus dem
alle diese Schwankungen bei einem Künstler,
der eine Zwischenstellung einnimmt, natur-
gemäß entspringen müssen. Ihn leitet bei
seinem Schaffen nicht in jedem Fall eine un-
mittelbare Anschauung der Natur, noch weniger
eine aus fortgesetzten Naturstudien geschöpfte
sichere Kenntnis derselben. Er arbeitet mit
einer Summe von ererbten Formen, in die er
je nach seiner Begabung mehr oder weniger
eigne neue Erkenntnis hineinträgt. Wenn eine
neue Aufgabe neue Forderungen an ihn stellt,
versagen zunächst seine Mittel. So sah sich
der Meister gezwungen, in Florenz nach anderen
Vorbildern umzuschauen, um den festen Griff
der Hand wiederzugeben, mit dem die Mutter
das Kind kräftig umfaßt, weil seine siene-
sischen Typen offenbar diesen Fall nicht ent-
hielten. Und mit der neuen Funktion nahm
er zuerst auch eine andere Form auf. So
bekam die Madonna der Freske von S. Croce
eine feine und eine grobe Hand. Im Aka-
demiebilde hat er die letztere schon ein wenig
verfeinert. Und so hat er offenbar auch den
Kopf des Kindes in Dreiviertelwendung der
Florentiner Kunst nachgeschaffen, im Trip-
tychon von Antella denselben aber wieder mit
dem zarteren sienesischen Typus vermittelt.
Als Trecentist behält er viel von der hand-
werksmäßigen Arbeitsweise dieser Periode. Er
konnte auch oberflächlich malen, wenn die
Aufgabe und wahrscheinlich auch der Lohn
ihn nicht genügend spornte. So wiederholt
er in einem Spätwerk (Berlin) ziemlich mecha-
nisch seine Typen in zerfahrener Kompo-
sition.
Da der Anonymus unbedingt zu den hervor-
tretenden Künstlerpersönlichkeiten der zweiten
Hälfte des Trecento zählt, so entsteht not-
wendigerweise die Frage, ob er nicht seiner-
seits einen gewissen Einfluß auf die Entwick-
lung anderer Meister ausgeübt hat. Denn der
Austausch der Kräfte ist das wichtigste Ent-
wicklungsmoment im Kunstleben einer jeden
Periode. In der Tat fehlt es nicht an deut-
lichen Spuren, die sein Schaffen in den Werken
seiner Zeitgenossen und nächsten Nachfolger
hinterlassen hat. Ein Agnolo Gaddi selbst
blieb ihm gegenüber nicht nur der Gebende.
1907.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
234
eigentümliche, dem Tafelbilde so gar nicht
angemessene Fußstellung des Täufers auf dem
Bilde in S. Ansano ist ein weiteres deutliches
Anzeichen davon, denn sie gehört zu den
typischen Schreitmotiven in Agnolo Gaddis
Freskendramen. In der Folge ist unser
Anonymus dem Einfluß dieses genialsten
Formalisten der florentiner Trecentomalerei
gänzlich erlegen.11) Davon zeugt das Trip-
tychon in Berlin. Das beweist auch eine
nachträglich aus vier einzelnen Flügelstücken
von Heiligen (Katharina, zwei Benediktiner
und Magdalena) zusammengesetzte Tafel im
Depot des Berliner Museums (Nr. III, 41).
Trotz der flüchtigen Ausführung —, die männ-
lichen Heiligen sind handwerksmäßige Wieder-
holungen von Typen Agnolos, — möchte ich
sie unserem Meister selbst zusprechen, da die
weiblichen Figuren ganz seine Art verraten.
Wie war es möglich, daß ein begabter
Künstler so herabsinken und sich selbst so
verlieren konnte? Und wie kommt es, daß auch
H) Mein Aufsatz war bereits in vorstehender Form
vollendet, als ich auf die Bemerkungen O. Sirens
(»Don Lorenzo Monaco«, Straßburg 1905, S. 41) über
den Anonymus stieß. Ich sehe in ihnen keinen Grund,
meine Ausführungen zu ändern, da in deren Zusammen-
hange die beste Widerlegung der Ansichten Sirens
liegt. Er hält den Anonymus für einen Schüler Agnolo
Gaddis und möchte die Bilder, welche er ihm zu-
schreibt, schon in den Anfang des XV. Jahrh. setzen,
und zwar außer den Triptychen in Antella u. Berlin
die Tafeln in den TJffizien (Nr. 34 B), in der Akademie
(Nr. 245) u. in S. Ansano, ein mir unbekanntes Bild bei
R. Kann, Berlin III, 41 und die o. a. Abendmahls-
darstellung in Altenburg, (Nr. 28). Siren hat aber
die Zugehörigkeit der Lünetle im Refektorium von
S. Croce nicht erkannt und daher begreiflicherweise
auch das Bild in Empoli nicht hinzugezogen. In den
angeführten Werken erkennt er bereits den Einfluß
des Lorenzo Monaco. Doch fällt, wie wir sahen,
das Triptychon von Anteila sicher noch in die 80 er
Jahre, in denen Lorenzos Tätigkeit kaum begonnen
halte. Und wer die Uffizientafel demselben Meister
gibt, kann sie unmöglich für so viel jünger halten.
Also trifft die zweite von Siren offen ge'assene
Möglichkeit zu, daß der Anonymus das Motiv des
Sitzens am Boden, das sie aufweist, von anderer Seite
erhalten, oder vielmehr, wie ich annehme, selbst aus Siena
mitgebracht haben muß und mit ihm auch die ge-
schlängelten Gewandsäume. Obwohl er auch diese mit
Lorenzo Monaco gemein hat, ist er aber doch nicht
aus ganz derselben Richtung hervorgegangen. Siren
hat die Nachwirkung Simone Martinis in der siene-
sischen Malerei des Trecento etwas zu einseitig betont.
In den Arbeiten eines Bartolo di Fredi und namentlich
in denen der Vanni lebt ebenso viel von der Tradition
der Lorenzetti fort. Der Madonnenmeister ist aus
dieser vermittelnden Richtung hervorgegangen.
in manchen seiner früheren Werke sich solche
Ungleichheiten bemerkbar machen? Warum
hat z. B. das Kind in Vorderansicht (Empoli
und Uffizienbild) einen abweichenden Typus?
Es ist das Wesen der Trecentokunst, aus dem
alle diese Schwankungen bei einem Künstler,
der eine Zwischenstellung einnimmt, natur-
gemäß entspringen müssen. Ihn leitet bei
seinem Schaffen nicht in jedem Fall eine un-
mittelbare Anschauung der Natur, noch weniger
eine aus fortgesetzten Naturstudien geschöpfte
sichere Kenntnis derselben. Er arbeitet mit
einer Summe von ererbten Formen, in die er
je nach seiner Begabung mehr oder weniger
eigne neue Erkenntnis hineinträgt. Wenn eine
neue Aufgabe neue Forderungen an ihn stellt,
versagen zunächst seine Mittel. So sah sich
der Meister gezwungen, in Florenz nach anderen
Vorbildern umzuschauen, um den festen Griff
der Hand wiederzugeben, mit dem die Mutter
das Kind kräftig umfaßt, weil seine siene-
sischen Typen offenbar diesen Fall nicht ent-
hielten. Und mit der neuen Funktion nahm
er zuerst auch eine andere Form auf. So
bekam die Madonna der Freske von S. Croce
eine feine und eine grobe Hand. Im Aka-
demiebilde hat er die letztere schon ein wenig
verfeinert. Und so hat er offenbar auch den
Kopf des Kindes in Dreiviertelwendung der
Florentiner Kunst nachgeschaffen, im Trip-
tychon von Antella denselben aber wieder mit
dem zarteren sienesischen Typus vermittelt.
Als Trecentist behält er viel von der hand-
werksmäßigen Arbeitsweise dieser Periode. Er
konnte auch oberflächlich malen, wenn die
Aufgabe und wahrscheinlich auch der Lohn
ihn nicht genügend spornte. So wiederholt
er in einem Spätwerk (Berlin) ziemlich mecha-
nisch seine Typen in zerfahrener Kompo-
sition.
Da der Anonymus unbedingt zu den hervor-
tretenden Künstlerpersönlichkeiten der zweiten
Hälfte des Trecento zählt, so entsteht not-
wendigerweise die Frage, ob er nicht seiner-
seits einen gewissen Einfluß auf die Entwick-
lung anderer Meister ausgeübt hat. Denn der
Austausch der Kräfte ist das wichtigste Ent-
wicklungsmoment im Kunstleben einer jeden
Periode. In der Tat fehlt es nicht an deut-
lichen Spuren, die sein Schaffen in den Werken
seiner Zeitgenossen und nächsten Nachfolger
hinterlassen hat. Ein Agnolo Gaddi selbst
blieb ihm gegenüber nicht nur der Gebende.