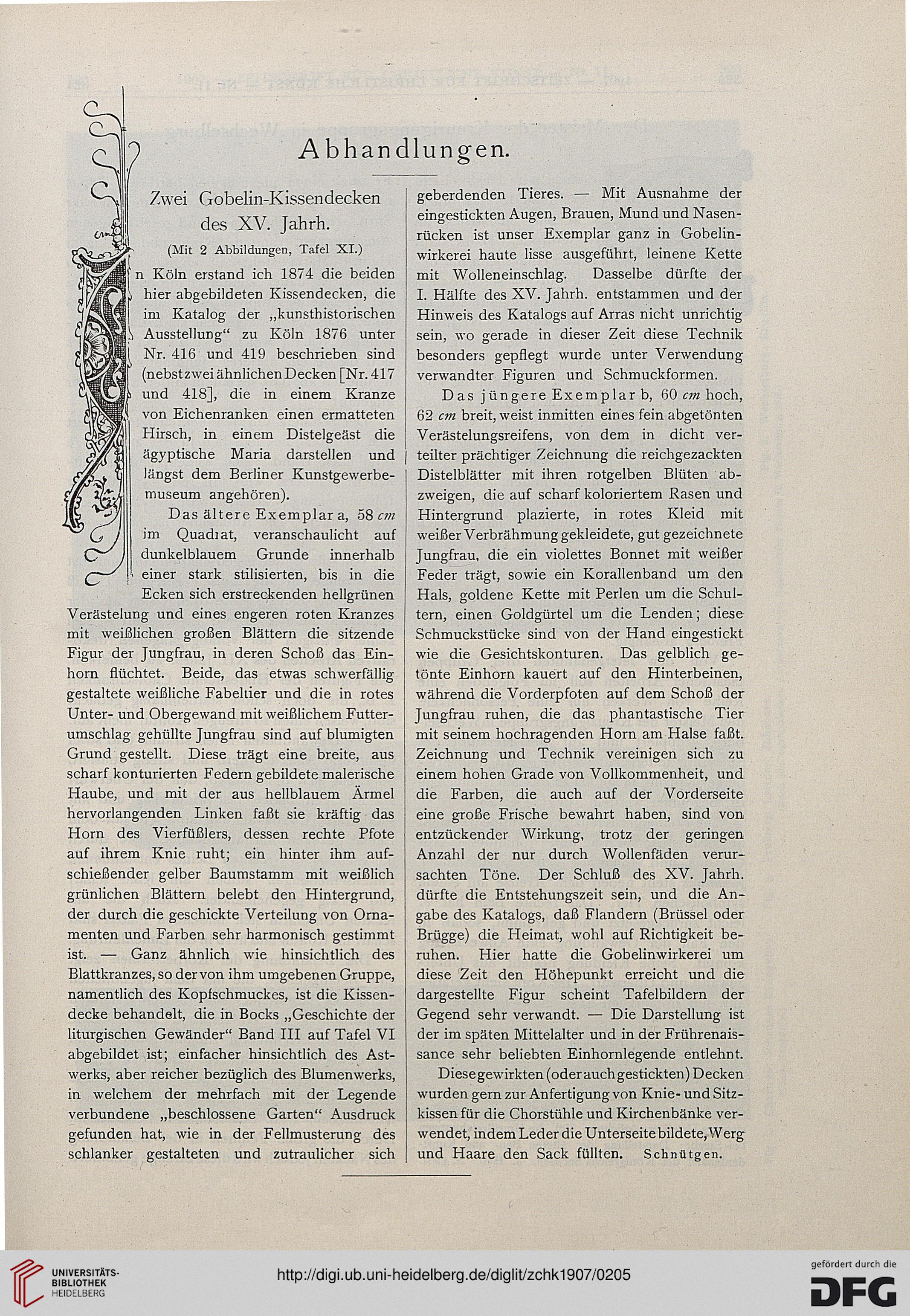C/v*
Abhandlungen.
ii
Zwei Gobelin-Kissendecken
des XV. Jahrh.
(Mit 2 Abbildungen, Tafel XL)
'n Köln erstand ich 1874 die beiden
hier abgebildeten Kissendecken, die
im Katalog der „kunsthistorischen
|S Ausstellung" zu Köln 1876 unter
Nr. 416 und 419 beschrieben sind
(nebstzwei ähnlichen Decken [Nr. 417
und 418], die in einem Kranze
von Eichenranken einen ermatteten
Hirsch, in einem Distelgeäst die
ägyptische Maria darstellen und
längst dem Berliner Kunstgewerbe-
museum angehören).
Das ältere Exemplar a, 58««
im Quadiat, veranschaulicht auf
dunkelblauem Grunde innerhalb
einer stark stilisierten, bis in die
Ecken sich erstreckenden hellgrünen
Verästelung und eines engeren roten Kranzes
mit weißlichen großen Blättern die sitzende
Figur der Jungfrau, in deren Schoß das Ein-
horn flüchtet. Beide, das etwas schwerfällig
gestaltete weißliche Fabeltier und die in rotes
Unter- und Obergewand mit weißlichem Futter-
umschlag gehüllte Jungfrau sind auf blumigten
Grund gestellt. Diese trägt eine breite, aus
scharf konturierten Federn gebildete malerische
Haube, und mit der aus hellblauem Ärmel
hervorlangenden Linken faßt sie kräftig das
Hörn des Vierfüßlers, dessen rechte Pfote
auf ihrem Knie ruht; ein hinter ihm auf-
schießender gelber Baumstamm mit weißlich
grünlichen Blättern belebt den Hintergrund,
der durch die geschickte Verteilung von Orna-
menten und Farben sehr harmonisch gestimmt
ist. — Ganz ähnlich wie hinsichtlich des
Blattkranzes, so der von ihm umgebenen Gruppe,
namentlich des Kopfschmuckes, ist die Kissen-
decke behandelt, die in Bocks „Geschichte der
liturgischen Gewänder" Band III auf Tafel VI
abgebildet ist; einfacher hinsichtlich des Ast-
werks, aber reicher bezüglich des Blumenwerks,
in welchem der mehrfach mit der Legende
verbundene „beschlossene Garten" Ausdruck
gefunden hat, wie in der Fellmusterung des
schlanker gestalteten und zutraulicher sich
geberdenden Tieres. — Mit Ausnahme der
eingestickten Augen, Brauen, Mund und Nasen-
rücken ist unser Exemplar ganz in Gobelin-
wirkerei haute lisse ausgeführt, leinene Kette
mit Wolleneinschlag. Dasselbe dürfte der
I. Hälfte des XV. Jahrh. entstammen und der
Hinweis des Katalogs auf Arras nicht unrichtig
sein, wo gerade in dieser Zeit diese Technik
besonders gepflegt wurde unter Verwendung
verwandter Figuren und Schmuck formen.
Das jüngere Exemplar b, 60 cm hoch,
62 cm breit, weist inmitten eines fein abgetönten
Verästelungsreifens, von dem in dicht ver-
teilter prächtiger Zeichnung die reichgezackten
Distelblätter mit ihren rotgelben Blüten ab-
zweigen, die auf scharf koloriertem Rasen und
Hintergrund plazierte, in rotes Kleid mit
weißer Verbrähmung gekleidete, gut gezeichnete
Jungfrau, die ein violettes Bonnet mit weißer
Feder trägt, sowie ein Korallenband um den
Hals, goldene Kette mit Perlen um die Schul-
tern, einen Goldgürtel um die Lenden; diese
Schmuckstücke sind von der Hand eingestickt
wie die Gesichtskonturen. Das gelblich ge-
tönte Einhorn kauert auf den Hinterbeinen,
während die Vorderpfoten auf dem Schoß der
Jungfrau ruhen, die das phantastische Tier
mit seinem hochragenden Hörn am Halse faßt.
Zeichnung und Technik vereinigen sich zu
einem hohen Grade von Vollkommenheit, und
die Farben, die auch auf der Vorderseite
eine große Frische bewahrt haben, sind von
entzückender Wirkung, trotz der geringen
Anzahl der nur durch Wollenfäden verur-
sachten Töne. Der Schluß des XV. Jahrh.
dürfte die Entstehungszeit sein, und die An-
gabe des Katalogs, daß Flandern (Brüssel oder
Brügge) die Heimat, wohl auf Richtigkeit be-
ruhen. Hier hatte die Gobelinwirkerei um
diese Zeit den Höhepunkt erreicht und die
dargestellte Figur scheint Tafelbildern der
Gegend sehr verwandt. — Die Darstellung ist
der im späten Mittelalter und in der Frührenais-
sance sehr beliebten Einhornlegende entlehnt.
Diesegewirkten (oderauchgestickten) Decken
wurden gern zur Anfertigung von Knie- und Sitz-
kissen für die Chorstühle und Kirchenbänke ver-
wendet, indem Leder die Unterseite bildete, Werg
und Haare den Sack füllten. Schnütgen.
Abhandlungen.
ii
Zwei Gobelin-Kissendecken
des XV. Jahrh.
(Mit 2 Abbildungen, Tafel XL)
'n Köln erstand ich 1874 die beiden
hier abgebildeten Kissendecken, die
im Katalog der „kunsthistorischen
|S Ausstellung" zu Köln 1876 unter
Nr. 416 und 419 beschrieben sind
(nebstzwei ähnlichen Decken [Nr. 417
und 418], die in einem Kranze
von Eichenranken einen ermatteten
Hirsch, in einem Distelgeäst die
ägyptische Maria darstellen und
längst dem Berliner Kunstgewerbe-
museum angehören).
Das ältere Exemplar a, 58««
im Quadiat, veranschaulicht auf
dunkelblauem Grunde innerhalb
einer stark stilisierten, bis in die
Ecken sich erstreckenden hellgrünen
Verästelung und eines engeren roten Kranzes
mit weißlichen großen Blättern die sitzende
Figur der Jungfrau, in deren Schoß das Ein-
horn flüchtet. Beide, das etwas schwerfällig
gestaltete weißliche Fabeltier und die in rotes
Unter- und Obergewand mit weißlichem Futter-
umschlag gehüllte Jungfrau sind auf blumigten
Grund gestellt. Diese trägt eine breite, aus
scharf konturierten Federn gebildete malerische
Haube, und mit der aus hellblauem Ärmel
hervorlangenden Linken faßt sie kräftig das
Hörn des Vierfüßlers, dessen rechte Pfote
auf ihrem Knie ruht; ein hinter ihm auf-
schießender gelber Baumstamm mit weißlich
grünlichen Blättern belebt den Hintergrund,
der durch die geschickte Verteilung von Orna-
menten und Farben sehr harmonisch gestimmt
ist. — Ganz ähnlich wie hinsichtlich des
Blattkranzes, so der von ihm umgebenen Gruppe,
namentlich des Kopfschmuckes, ist die Kissen-
decke behandelt, die in Bocks „Geschichte der
liturgischen Gewänder" Band III auf Tafel VI
abgebildet ist; einfacher hinsichtlich des Ast-
werks, aber reicher bezüglich des Blumenwerks,
in welchem der mehrfach mit der Legende
verbundene „beschlossene Garten" Ausdruck
gefunden hat, wie in der Fellmusterung des
schlanker gestalteten und zutraulicher sich
geberdenden Tieres. — Mit Ausnahme der
eingestickten Augen, Brauen, Mund und Nasen-
rücken ist unser Exemplar ganz in Gobelin-
wirkerei haute lisse ausgeführt, leinene Kette
mit Wolleneinschlag. Dasselbe dürfte der
I. Hälfte des XV. Jahrh. entstammen und der
Hinweis des Katalogs auf Arras nicht unrichtig
sein, wo gerade in dieser Zeit diese Technik
besonders gepflegt wurde unter Verwendung
verwandter Figuren und Schmuck formen.
Das jüngere Exemplar b, 60 cm hoch,
62 cm breit, weist inmitten eines fein abgetönten
Verästelungsreifens, von dem in dicht ver-
teilter prächtiger Zeichnung die reichgezackten
Distelblätter mit ihren rotgelben Blüten ab-
zweigen, die auf scharf koloriertem Rasen und
Hintergrund plazierte, in rotes Kleid mit
weißer Verbrähmung gekleidete, gut gezeichnete
Jungfrau, die ein violettes Bonnet mit weißer
Feder trägt, sowie ein Korallenband um den
Hals, goldene Kette mit Perlen um die Schul-
tern, einen Goldgürtel um die Lenden; diese
Schmuckstücke sind von der Hand eingestickt
wie die Gesichtskonturen. Das gelblich ge-
tönte Einhorn kauert auf den Hinterbeinen,
während die Vorderpfoten auf dem Schoß der
Jungfrau ruhen, die das phantastische Tier
mit seinem hochragenden Hörn am Halse faßt.
Zeichnung und Technik vereinigen sich zu
einem hohen Grade von Vollkommenheit, und
die Farben, die auch auf der Vorderseite
eine große Frische bewahrt haben, sind von
entzückender Wirkung, trotz der geringen
Anzahl der nur durch Wollenfäden verur-
sachten Töne. Der Schluß des XV. Jahrh.
dürfte die Entstehungszeit sein, und die An-
gabe des Katalogs, daß Flandern (Brüssel oder
Brügge) die Heimat, wohl auf Richtigkeit be-
ruhen. Hier hatte die Gobelinwirkerei um
diese Zeit den Höhepunkt erreicht und die
dargestellte Figur scheint Tafelbildern der
Gegend sehr verwandt. — Die Darstellung ist
der im späten Mittelalter und in der Frührenais-
sance sehr beliebten Einhornlegende entlehnt.
Diesegewirkten (oderauchgestickten) Decken
wurden gern zur Anfertigung von Knie- und Sitz-
kissen für die Chorstühle und Kirchenbänke ver-
wendet, indem Leder die Unterseite bildete, Werg
und Haare den Sack füllten. Schnütgen.